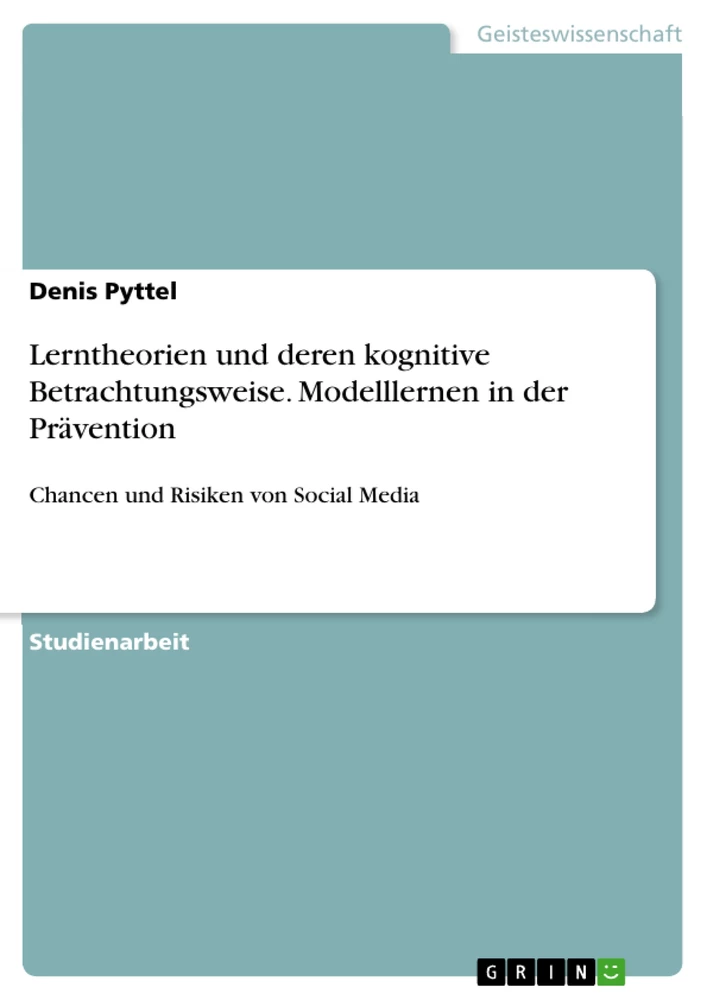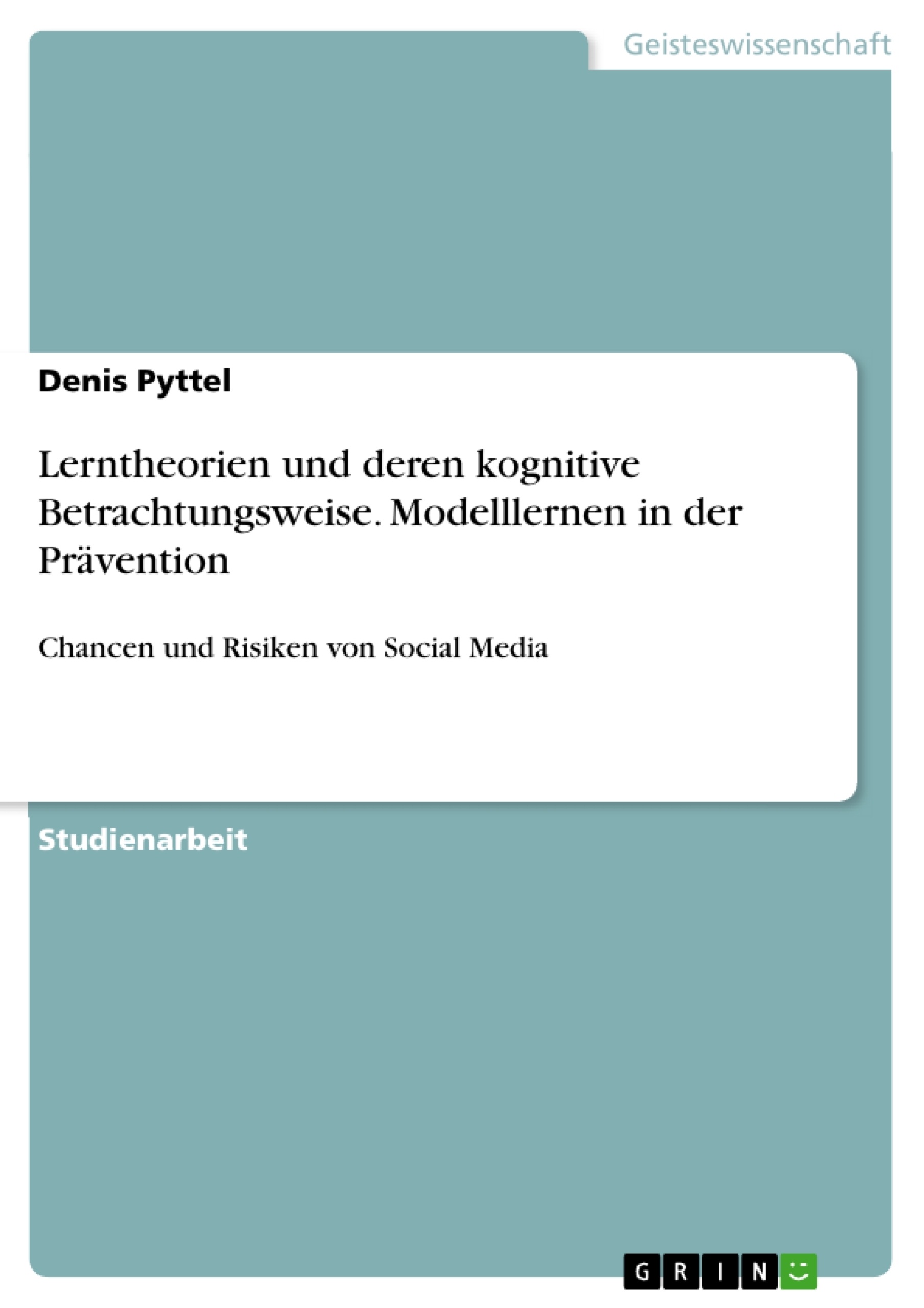Ziel dieser Arbeit ist es, zu verdeutlichen, dass Kognitionen einen Einfluss auf die Lerntheorien haben und dass man das Modelllernen gut in der Praxis, in dieser Arbeit mit dem Fokus auf die Prävention, einsetzen kann.
Um die unterschiedlichen Lerntheorien zu verdeutlichen, beschäftigt sich Kapitel 2 mit den einzelnen Lerntheorien, also der Habituation, der klassischen und operanten Konditionierung, dem kognitiven Lernen sowie dem Modelllernen. Hierbei wird auch der Einfluss der Kognitionen in den jeweiligen Lerntheorien verdeutlicht.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
2 Lernen
2.1 Habituationslernen
2.1.1 Erklärung des Konzepts: Habituationslernen
2.1.2 Einfluss von Kognition auf Habituationslernen
2.2 Klassische Konditionierung
2.2.1 Erklärung des Konzepts: Klassische Konditionierung
2.2.2 Einfluss von Kognition auf klassische Konditionierung
2.3 Operante Konditionierung
2.3.1 Erklärung des Konzepts: Operante Konditionierung
2.3.2 Einfluss von Kognition auf operante Konditionierung
2.4 Kognitives Lernen
2.5 Modelllernen
2.5.1 Erklärung des Konzepts: Modelllernen
2.5.2 Einfluss von Kognitionen auf Modelllernen
2.5.3 Imitation und Nacheifern
2.6 Zusammenfassung
3 Modelllernen in der Praxis
3.1 Modelllernen in der Prävention
3.2 Einfluss von Social Media auf das Modelllernen in der Prävention
3.3 Zusammenfassung
4 Diskussion
5 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis