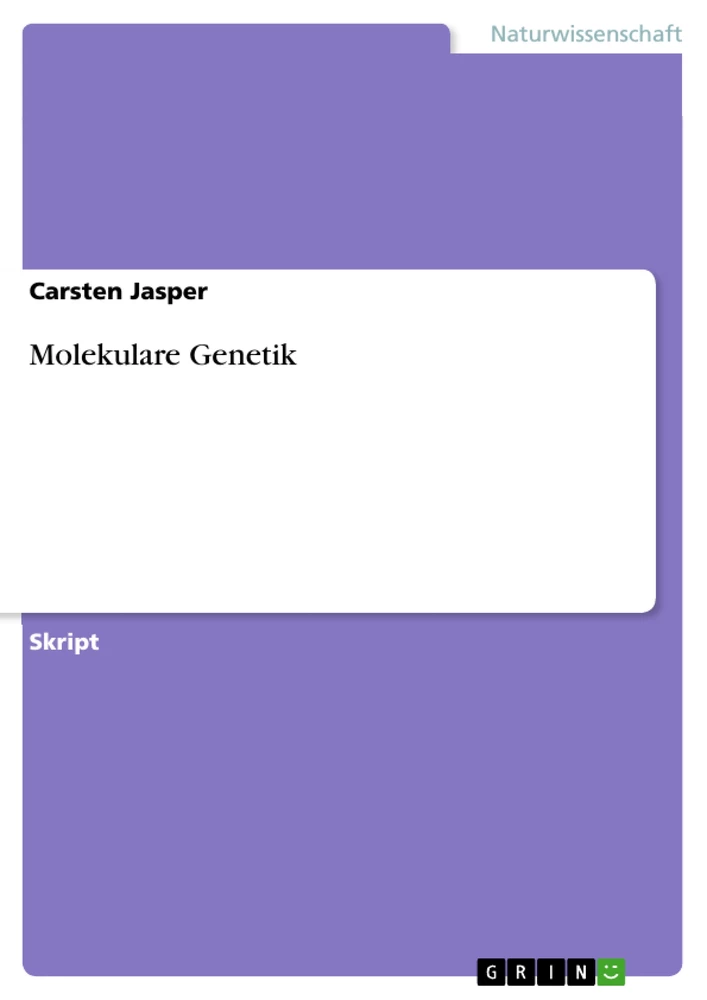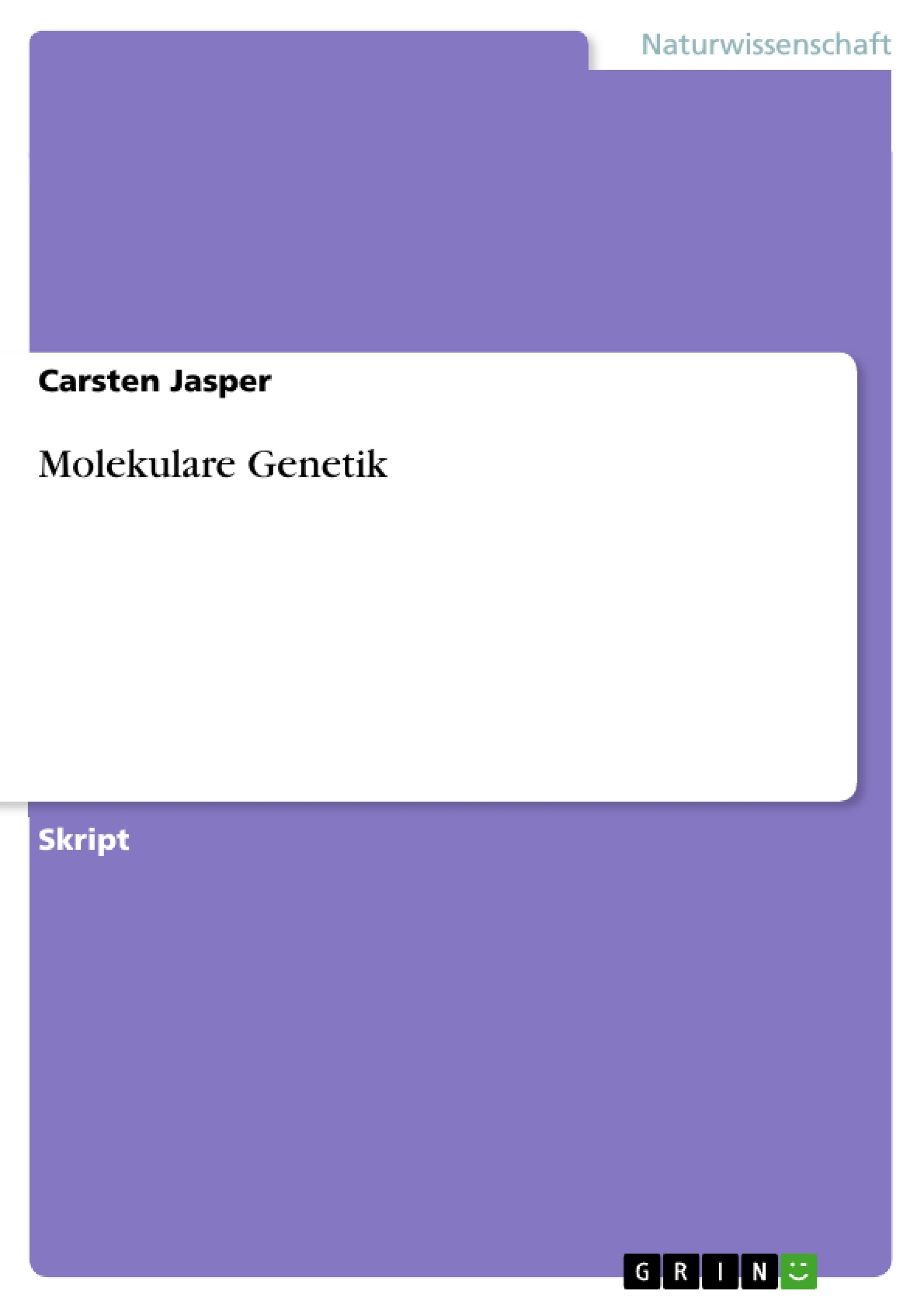1. Schematischer Aufbau der DNS
DNS = Desoxiribonucleinsäure (engl. –acid, daher DNA)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. Die Basenpaare der DNS
Innerhalb der DNS kommen immer nur bestimmte Basenpaare vor, diese sind:
Adenin - T hymin
Guanin - Cytosin
Adenin und Guanin sind Purinbasen und Guanin und Cytosin sind Pyrimidinbasen.
Beispiel einer solchen Andordnung von Basenpaaren in einem DNS-Abschnitt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Die RNS (engl. RNA)
Im Gegensatz zur DNS ist sie einsträngig. Das Thymin wird durch Uracil ersetzt, aber die Paare bleiben gleich.
4. Speicherung von Informationen im genetischen Code
4.1. Grundlagen
Die Informationen werden durch unterschiedliche Abfolge der Basen in der DNS codiert. Und zwar in der Form eines sogenannten Triplett-Codes, bei dem immer drei aufeinander folgende Basen eine Aminsoäure codieren.
4.2. Vorgang des Ablesens
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Es wird nur eine Seite der DNS ausgelesen, was auf der anderen Seite ist, ist unerheblich.
Die m-RNA (Boten-RNA) wird aus der DNS gebildet und wandert zu den Ribosomen, die aus einer grossen und einer kleinen Untereinheit bestehen. Dort wird die m-RNA von t-RNA’s ausgelesen. Diese haben eine Kleeblattform. Auf der einen Seite haben sie den genetischen Code und auf der anderen Seite die dazu passende Aminosäure. Trifft die t-RNA nun in einem Ribosom an der a-Stelle auf einen passenden m-RNA-Code, setzt sie die Aminosäure frei. Die m-RNA wandert weiter und der Vorgang wiederholt sich solange, bis das Kettenende durch ein Triplett signalisiert wird.
Die Aminsoäuren verbinden sich während des Ablesevorgangs zu einer Kette, die dann das Protein bilden. Dabei verbinden sich immer die an der p-Stelle vorhanden Aminosäuren mit der Aminosäure an der a-Stelle. Danach rutscht die gesamte Kette, wieder weiter auf die p-Stelle und an der a-Stelle kann wieder eine t-RNA ankoppeln.
Siehe hierzu auch im Linder auf den Seiten 363-366
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.3. Beispiel für Umwandlung von DNS in Proteine
Für die Umwandlung von der t-RNA in Proteine wird die Codesonne verwendet. Diese zeigt die einzelnen Aminosäuren auf, die zusammen dann das Protein bilden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5. Peptidbindungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6. Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Prokaryoten und Eukaryoten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Erläuterungen:
* Swendbergkonstante: Konstante die angibt, wie schwer etwas ist. Desto größer die Zahl umso schwerer ist es.
*1 Polysacharid
7. Bakteriophagen
7.1. Aufbau einer Bakteriophage
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bakteriophagen sind Viren, die sich nur mit der Hilfe von Bakterien vermehren können.
7.2. Vermehrung von Bakteriophagen
1. Adsorption: Die Bakteriophagen landen auf einer Bakterie und docken an.
2. Injektion der DNS: Genmaterial wird in die Zelle gespritzt; Es bleibt nur die leere Hülle der Bakteriophage über, die sich auflöst
3. Vermehrung der Phagenbestandteile in der Bakterie
4. Lyse: Auflösen der Zellwand der Bakterie; Freisetzen der Phagen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8. Bakterien (hier als Beispiel: Escherichia coli)
8.1. Aufbau von Escherichia coli
Wandaußenschicht (aus Lipiden und Proteinen)
Bakterienchromosom
Pili
Speicherkörner
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8.2. Wachstum von E. coli
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8.3. Keimzahlbestimmung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8.4. Flukutationstest
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ergebnis: Mutanten treten spontan und zufällig auf. Es gibt keine Regelmäßigkeiten, wie der rechte Versuch zeigt, dort gibt es mal mehr und mal weniger resistente Bakterien.
8.5. Genfaktoren bei Bakterien
Bakterien könen Stoffe synthetisieren. Mutanten einer Bakterien-Art wiederum nicht (solche Bakterien werden auch Mangelmutante genannt). Das heißt, das in den Erbinformationen die Informationen für das Bilden eines Stoffes nicht vorhanden sind. Dies wird durch ein Minus gekennzeichnet, zum Beispiel leu- heißt, daß die Bakterie nicht in der Lage ist Leucin zu bilden, weil ihr das nötige Erbgut fehlt. Bei leu+ hingegen wäre diese Bakterie in der Lage Leucin zu bilden. Diese Schreibweise kann auch mit beliebigen Buchstaben (z. B. A, B, C, etc., außer F) erfolgen, wobei die Buchstaben dann für beliebige Eigenschaften stehen können.
9. Genübertragung bei Bakterien
9.1. Genübertragung zwischen Bakterien
9.1.1. Versuch zu Genübertragung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nach Entfernen des Filters, wachsen die Bakterien auf dem Minimalnährboden. Schaut man sich das Erbgut dieser Bakterien an, so ergibt sich dieses Bild:
A+, B+, C+, D+. Daraus ergibt sich, daß die Bakterien Genaustausch betrieben haben und daher nun auf dem Minimalnährboden wachsen können, weil sie alle Stoffe, die sie zum Wachsen brauchen, nun aus dem Minimalnährboden syntetisieren können. Daraus ergibt sich als Ergebnis:
Genaustausch ist nur dann möglich, wenn die Bakterien direkten Kontakt miteinander haben, und eine Plasmabrücke aufbauen können.
9.1.2. Der Fertilitätsfaktor
Der Fertilitätsfaktor (abgekürzt: F) befähigt eine Bakterie eine Plasmabrücke auszubilden. Es gibt verschiedene Arten:
F+ = Der Fertilitätsfaktor ist vorhanden, und befindet sich frei im Plasma, als Plasmid; die Bakterie kann eine Plasmabrücke aufbauen
F- = Der Fertilitätsfaktor ist nicht vorhanden, die Bakterie kann keine Plasmabrücke aufbauen
Hfr = Der F-Faktor ist in dem Chromosom der Bakterie eingebaut (kann jedoch auch wieder heraus gehen), daher sind Bakterien dieser Art bei der Teilung immer F+
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei einer Konjugation, also dem Bilden einer Plasmabrücke zwischen zwei Bakterien, von dem eine F+ und die andere F- ist, wird der F+-Faktor auf die F- Bakterie übertragen, daher sind im Anschluss beide F+. Es kommen jedoch trotzdem immer wieder F- Bakterien vor, weil bei der Meiose der F- Faktor in einer Bakterie verbleibt und daher eine Bakterie F+ und eine F- ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Sonderfall:
Es kann bei der Hfr-Bakterie passieren, daß wenn sich der F-Faktor aus dem Chromsom herauslöst, er einen Teil des Erbgutes mit sich nimmt. Diese Bakterien bezeichnet man als F‘, und den Vorgang als Sexduktion.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Übersicht:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten