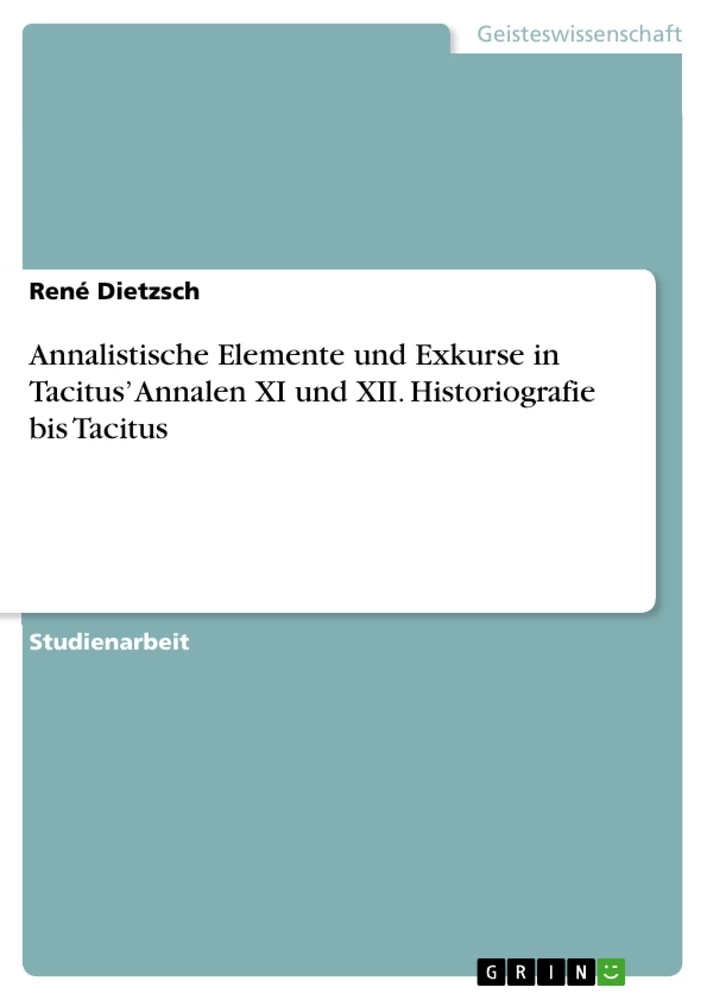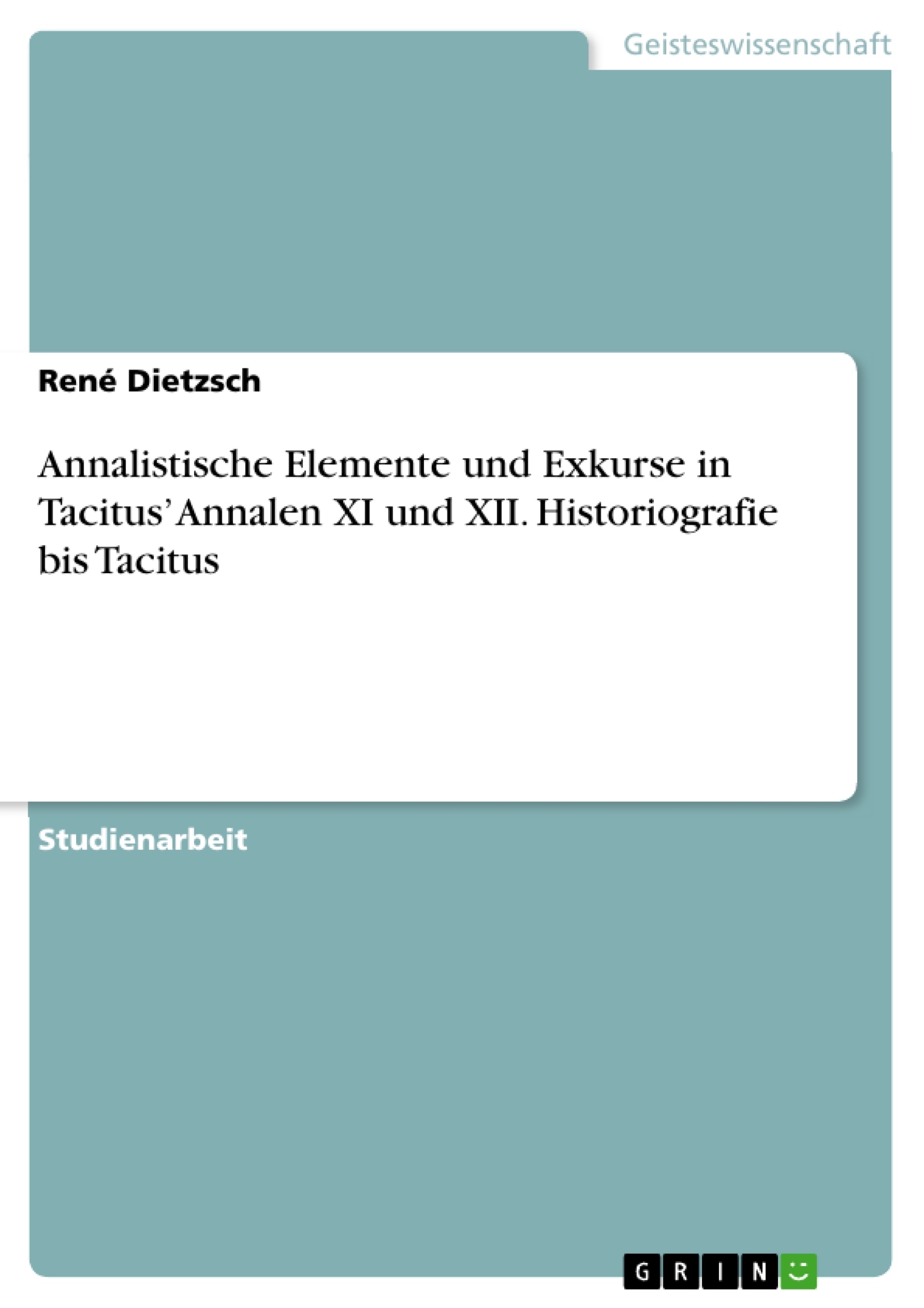In dieser Arbeit werden die Bücher 11 und 12 aus Tacitus’ "annales" im Hinblick auf die Erfüllung annalistischer Prämissen untersucht. Ausgangspunkt bildet eine Definition des 'annalistischen Schemas von Beck und Walter. Textelemente sollen im taciteischen Korpus nachgewiesen werden. Im Anschluss sollen Stellen aufgespürt werden, an denen Tacitus das restriktive Gerüst der Jahr-für-Jahr-Darstellung verlässt, um größere Zeitabschnitte resümierend wiederzugeben oder in Form eines Exkurses vom eigentlichen Gegenstand abzuweichen. Es soll dabei versucht werden, diese 'digressiones' aus dem inhaltlichen Zusammenhang heraus zu rechtfertigen. Als Resultat kann eingeschätzt werden, ob Tacitus eher ein traditioneller oder aber ein innovativer Annalist ist.
Die Geschehnisse der Zeit festzuhalten und Vergangenes historisch aufzuarbeiten – beides mit dem Anspruch, Zeugnis über die Bewegungen auf der geschichtlichen Bühne abzulegen, darf bereits in der Antike als Zielformulierung der Geschichtsschreiber gelten. Im antiken Rom beginnt dies mit dem Römer Q. Fabius Pictor (ca. 270–216 v. Chr.), der in griechischer Sprache und annalistischer Form die historischen Ereignisse, mit der Frühgeschichte beginnend und bis in seine Gegenwart weiterführend, festhält.
Das annalistische Schema, das er dafür wählt, ist als Anleihe an die geweißten Tafeln zu sehen, auf denen das religiöse Oberhaupt Roms die Geschehnisse Jahr für Jahr schriftlich festgehalten und für jedermann lesbar vor seinem Amtssitz aufgestellt hat. Diese Praxis reicht bis ins 4. vorchristliche Jahrhundert zurück und findet erst ein Ende, als P. Mucius Scaevola, Pontifex Maximus ab 130 v. Chr., diesen Brauch abschafft. Als thematische Schwerpunkte lassen sich sakral bedeutsame Vorkommnisse wie Prodigien, Tempelweihungen, Ernteausfälle und Finsternisse feststellen.
Inhalt
1. Einleitung: Historiografie bis Tacitus
2. Annalistik und Exkursionen in Tacitus, annales 11–12
2.1. Inhalt der Claudiusbücher
2.2. Annalistische Merkmale
2.3. Tacitus als ‚emanzipierter‘ Annalist
3. Zusammenfassung
4. Bibliografie