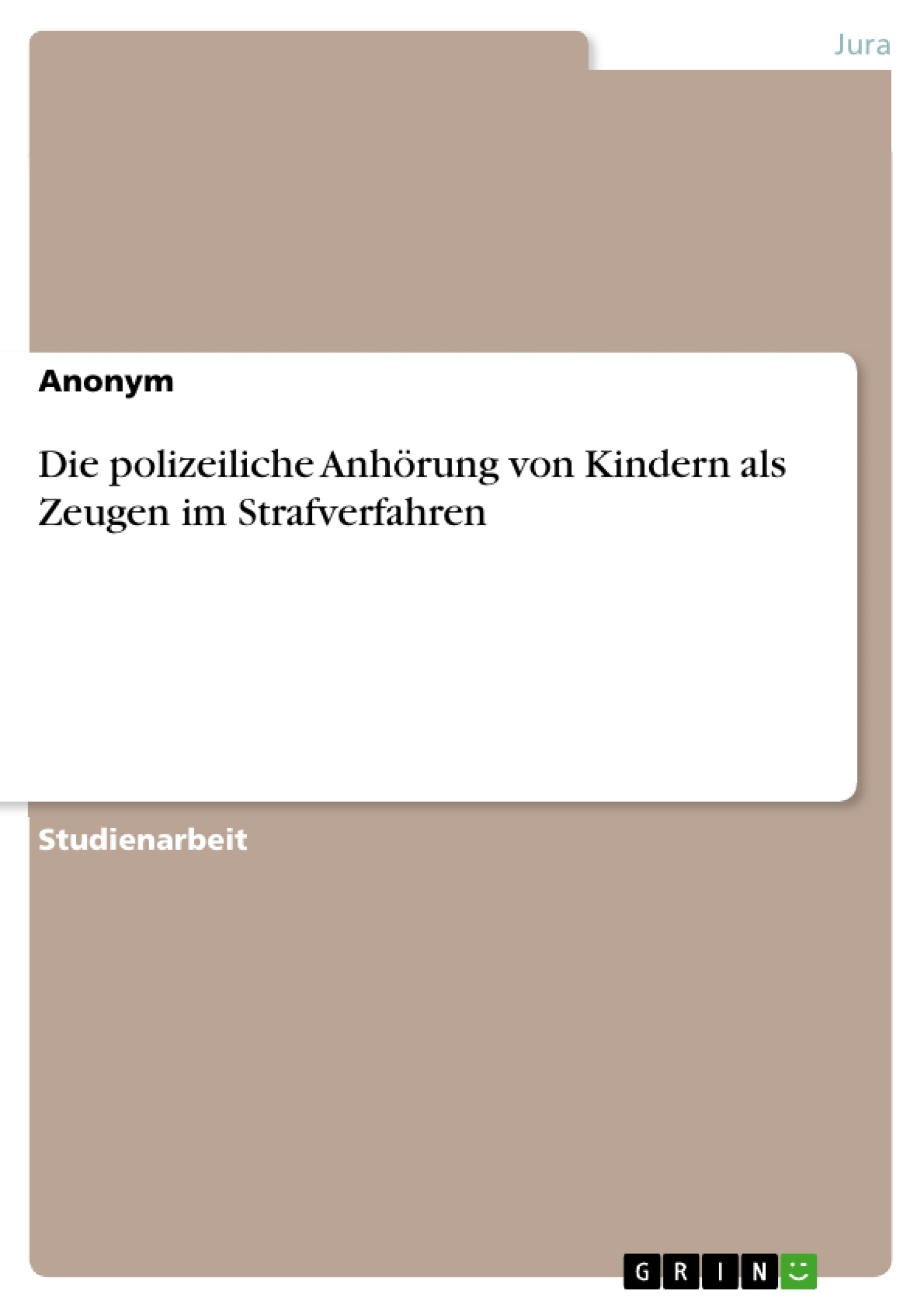Diese Seminararbeit mit dem Titel "Die polizeiliche Anhörung von Kindern als Zeugen im Strafverfahren" aus dem Fachbereich "kriminalistische Fallanalyse" umfasst u.a. die folgenden Inhalte: Kinder als Zeugen in Strafverfahren, altersbezogene Merkmale und Vernehmung kindlicher Zeugen.
Die polizeiliche Anhörung von Kindern als Zeugen im Strafverfahren
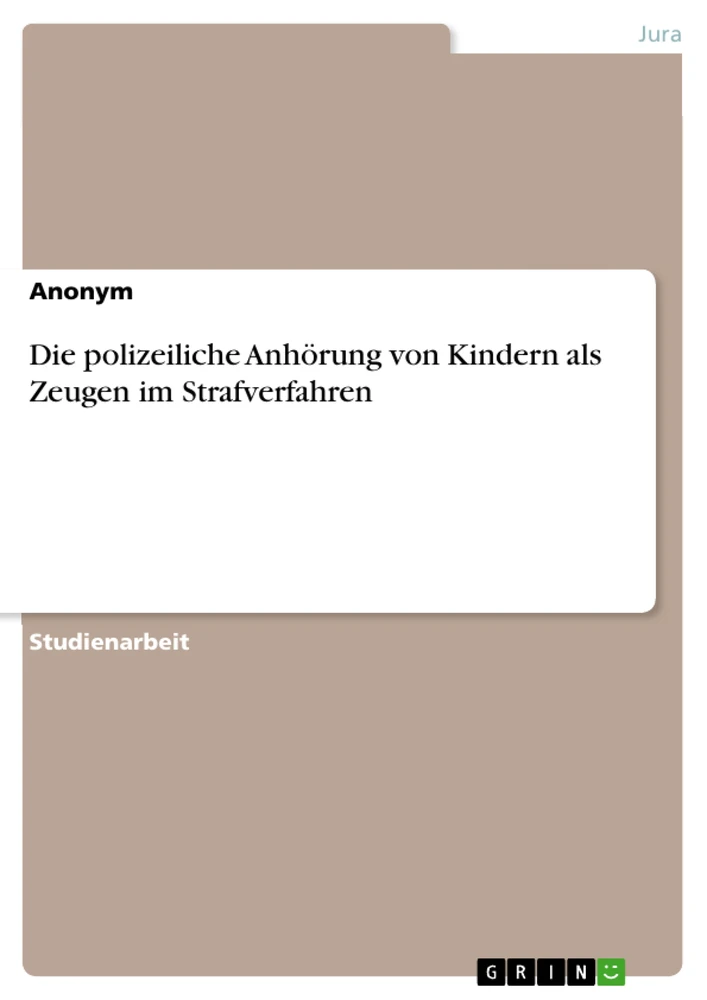
Hausarbeit (Hauptseminar) , 2020 , 18 Seiten , Note: 2,0
Jura - Strafprozessrecht, Kriminologie, Strafvollzug
Leseprobe & Details Blick ins Buch