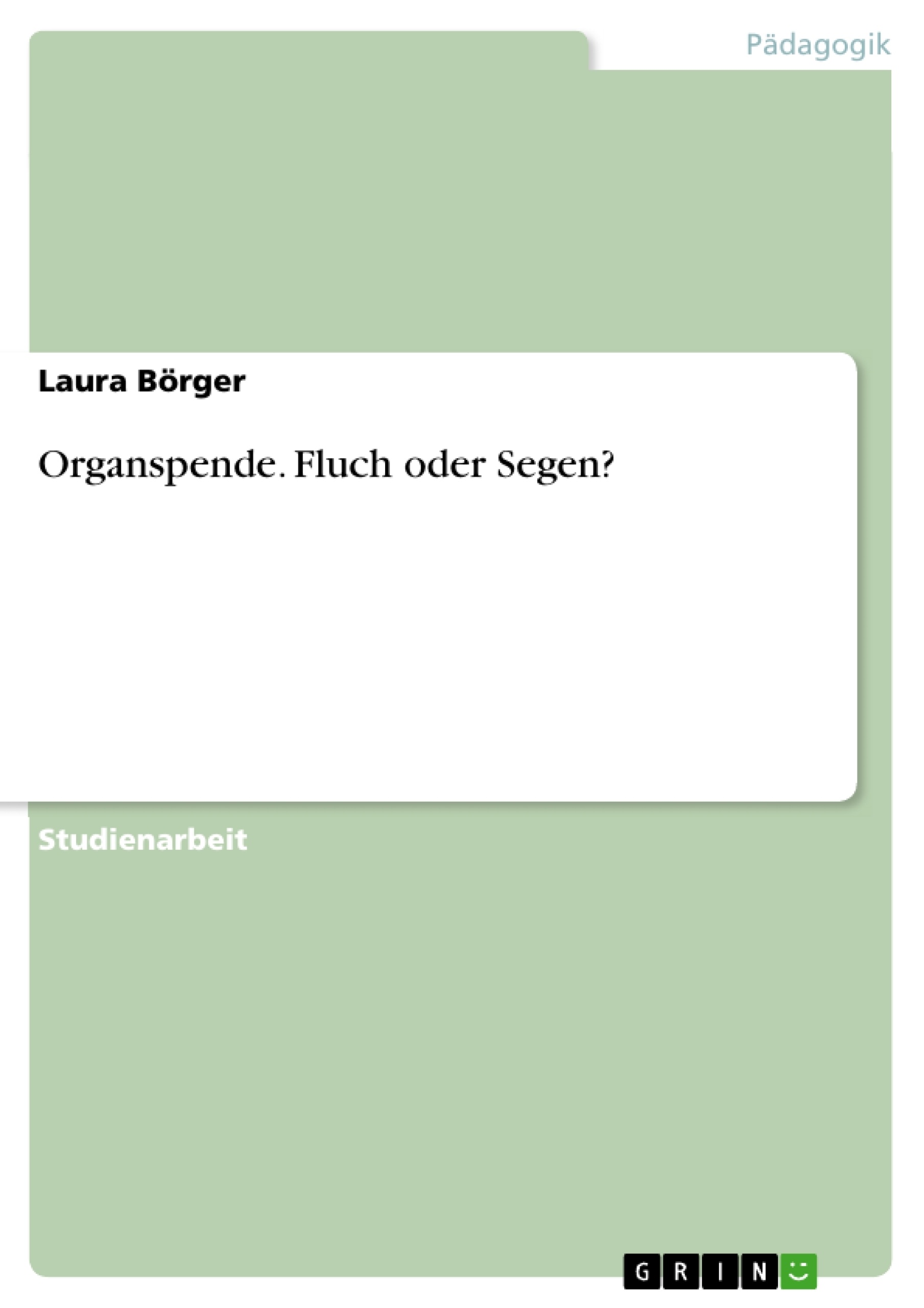Diese Hausarbeit setzt sich mit wichtigen Informationen bezüglich der Organspende auseinander, beginnend mit dem entsprechenden Gesetz und der Definition. Die Arbeit befasst sich dann ausführlich mit der Hirntodfeststellung, dem Ablauf und dem Organspendeausweis. Außerdem führt sie aktuelle politische Diskussionen, sowie mögliche Lösungen für das Organspenderproblem auf. Weiterhin geht die Hausarbeit auf religiöse Sichtweisen und die Organspende in anderen Ländern ein. Den Abschluss der Arbeit bildet eine Zusammenfassung der literarischen Erkenntnisse und eine mögliche Antwort auf die Frage, was Organspende denn nun eigentlich ist: Fluch oder Segen?
Hört man das Wort Organspende so fällt einem als erstes das Wort „Tod“ ein, aber im gleichen Atemzug dazu gegenteilig das Wort „Leben“. Denn so nah liegen diese beiden Zustände bei der Organspende beieinander. Wo ein Mensch stirbt, überlebt dafür ein anderer. Das Thema, womit sich diese Hausarbeit beschäftigt ist stets aktuell und doch wird viel zu wenig darüber gesprochen, denn es ist mit einem hohen Unbehagen behaftet. Niemand möchte gerne über seinen Tod nachdenken, geschweige denn darüber reden. Doch wie wichtig es dennoch ist sich über das Thema Organspende auszutauschen, ist wenigen Menschen so bewusst. Die Spende ist gleichermaßen Chance wie Zumutung. Eine richtige oder falsche Antwort dazu gibt es nicht. Jeden Einzelnen kann die Situation der Organspende betreffen. Sei es durch einen Unfall, der einen selbst betrifft oder den nächsten Angehörigen. In diesem Moment muss eine Entscheidung getroffen werden, wenn der Verstorbene keine Zustimmung oder Ablehnung hinsichtlich der Spende getroffen hat. Aus diesem Grund sollte jeder Mensch einen Organspendeausweis haben, indem die jeweilige Entscheidung festgehalten wurde. Auch in der Medizin gewinnt die Organspende immer weiter an Bedeutung. Problematisch ist die Anzahl an Spendern, denn 2018 standen etwa 9500 Menschen auf der Warteliste für eine Transplantation. Während sich durch die immer weiterentwickelnde Medizin die Lebensdauer des Einzelnen erhöht wird, sinkt auf der anderen Seite die Geburtenrate und somit potenzielle Spender. Viele Menschen stehen einer Organspende positiv gegenüber, andere aber auch negativ. Fakt ist, viel zu wenige besitzen einen Organspendeausweis. Hintergrund dafür könnte das mangelnde oder falsche Wissen zur Organspende sein.
Organspende. Fluch oder Segen?
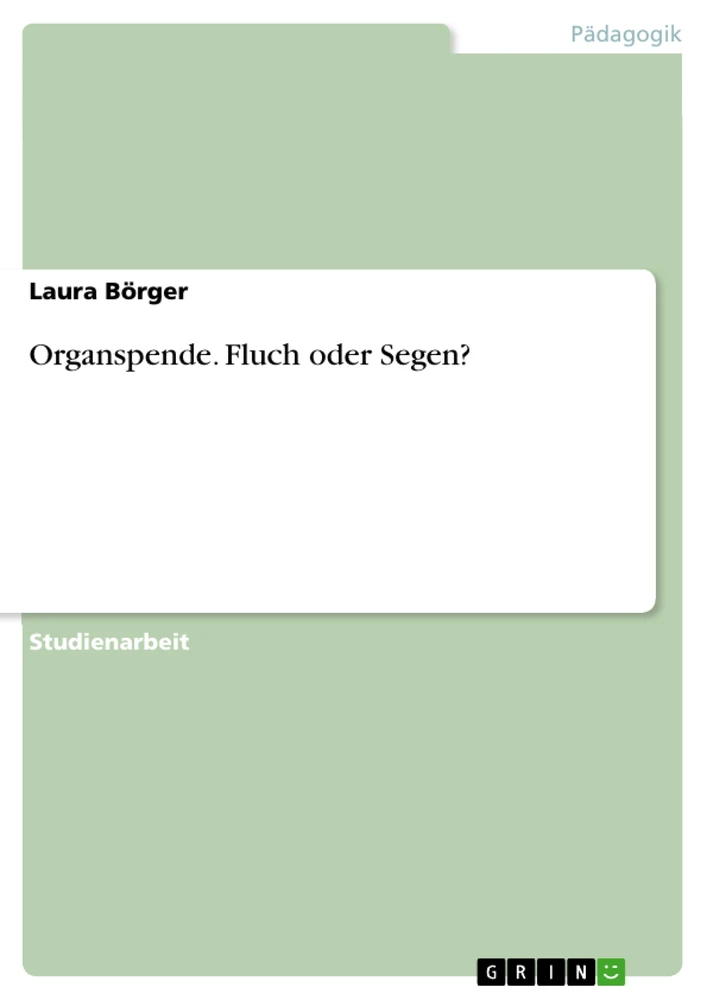
Hausarbeit , 2019 , 14 Seiten , Note: 1,7
Autor:in: Laura Börger (Autor:in)
Leseprobe & Details Blick ins Buch