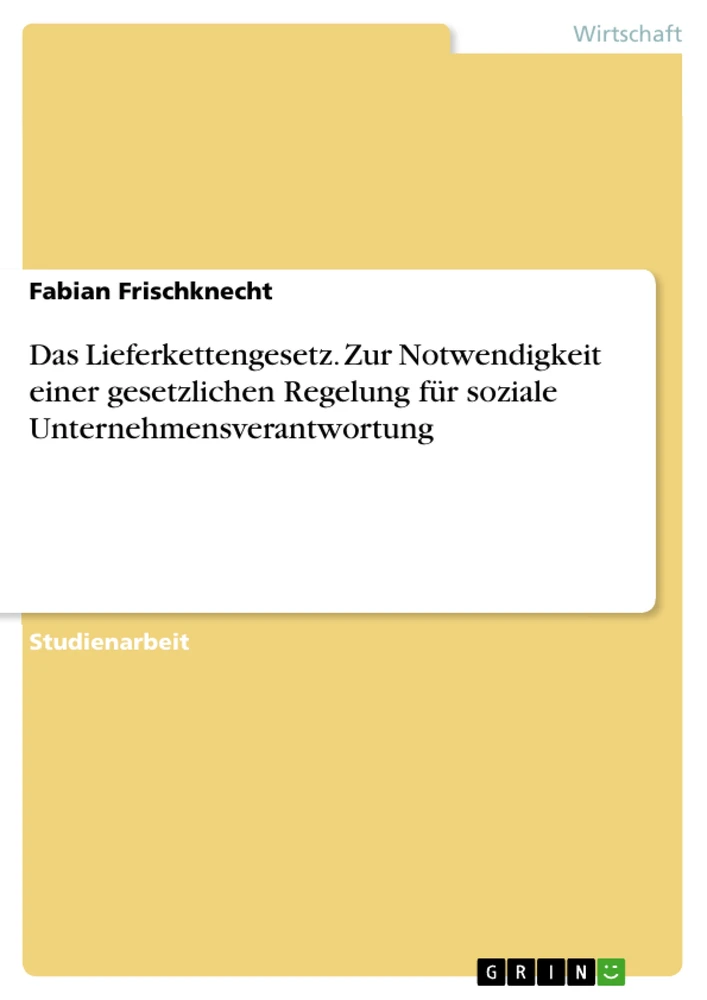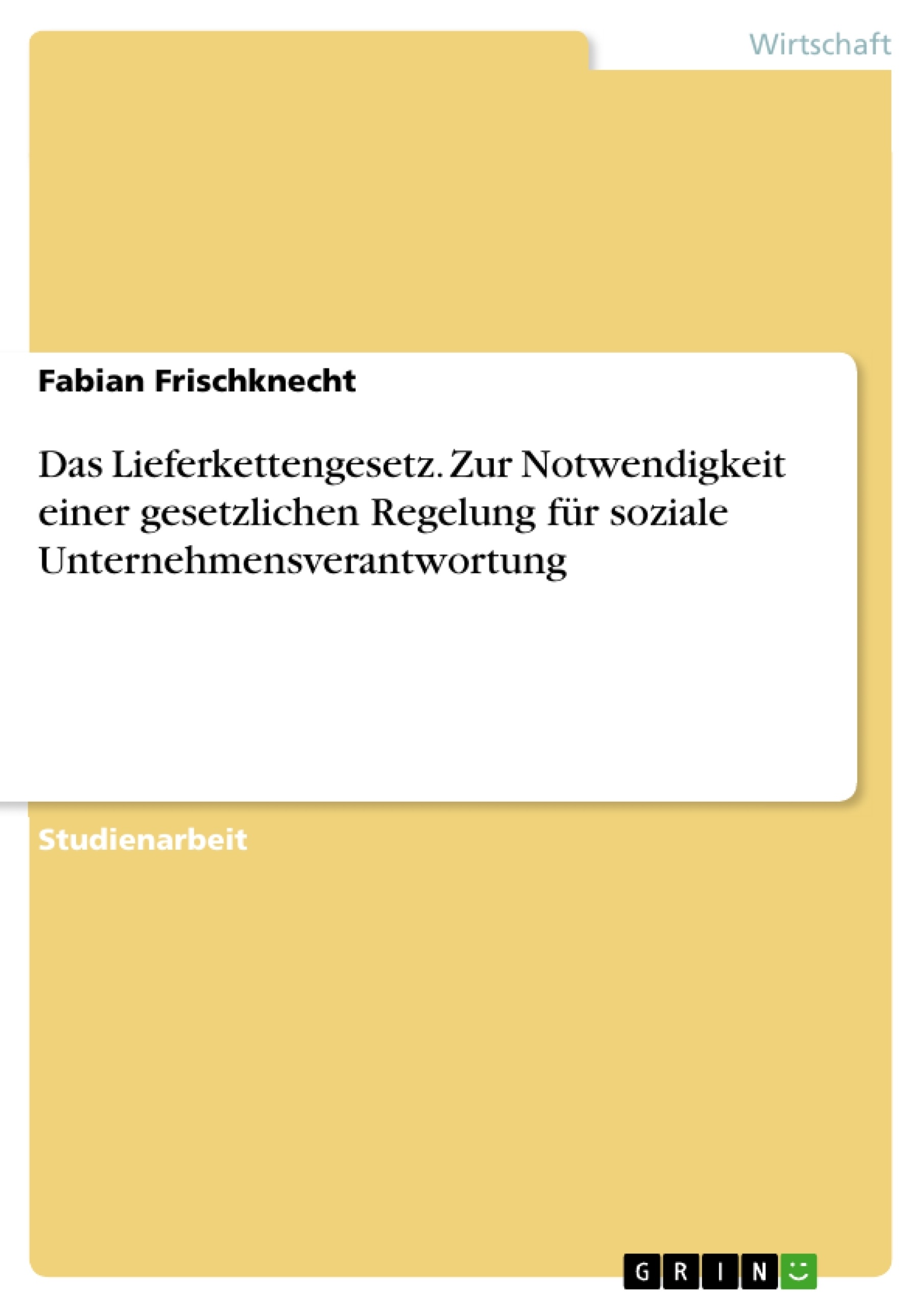In diesem Thesenpapier wird die Fragestellung bearbeitet, inwiefern eine gesetzliche Verankerung von Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten notwendig ist und ob beziehungsweise wie damit entsprechende Verbesserungen hinsichtlich sozialer und ökologischer Faktoren erreicht werden können.
Hierzu wird in Kapitel 2 die Verantwortung von Unternehmen in der Wertschöpfungskette im Allgemeinen aufgegriffen und konkrete notwendige Bestandteile einer gesetzlichen Regelung sowie die Auswirkungen auf entsprechend betroffene Unternehmen aufgeführt. Im darauffolgenden Kapitel wird Bezug auf die aktuelle Rechtslage genommen, um am Ende ein Fazit zu ziehen und dort etwaige Gegenargumente aufzuführen
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Verantwortung in der Wertschöpfungskette
3. Aktuelle Rechtslage
4. Fazit
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
CSR Corporate Social Responsibility
ESG Environment Social Governance
EU Europäische Union
NAP Nationaler Aktionsplan
1. Einleitung
Im Jahr 2012 kamen bei einem Brand in einer pakistanischen Textilfabrik mehr als 250 Menschen ums Leben. Ursächlich für die Katastrophe soll der unzureichende Brandschutz innerhalb der Firma gewesen sein. Vergitterte Fenster und verschlossene Notausgänge werden hierbei genannt. Produziert hatte dort der Textildiscounter KiK. Sieben Jahre später wurde eine Klage von vier Pakistanern abgewiesen, die den deutschen Textildiscounter auf Schmerzensgeld verklagt hatten. Grund war die Verjährung der Ansprüche nach pakistanischem Recht. Damit blieb die Frage ungeklärt, ob ein Unternehmen für die Verfehlungen seiner Zulieferer aufgrund der unternehmerischen Sorgfaltspflicht haftbar gemacht werden kann.1
Das Beispiel zeigt die Präsenz und das Ausmaß der Fragestellung, inwieweit Unternehmen für deren Wertschöpfungskette verantwortlich sind und dementsprechend haftbar für etwaige Vergehen der Zulieferer gemacht werden können. Diese Thematik ist auch in der Politik hochaktuell. Momentan wird in der deutschen Regierung über die Ausgestaltung eines Lieferkettengesetzes (oftmals auch Sorgfaltspflichtengesetz genannt) diskutiert. Dabei zeigt sich, dass aufgrund verschiedener Interessensgruppen (auch innerhalb der Regierung) ein entsprechender Gesetzesentwurf schwieriger ist als erwartet. Der Druck ist dabei hoch. Zum einen durch Menschenrechtsorganisationen wie die „Initiative Lieferkettengesetz“, zum anderen, weil im aktuellen Koalitionsvertrag die Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes bereits als Ziel genannt wurde.2
Neben der bereits aufgeführten Textilbranche gibt es Negativbeispiele vor allem auch der Elektronikbranche (z. B. Menschenrechtsverletzungen in der Rohstoffgewinnung) oder im Bereich von Lebensmitteln (z. B. Kinderarbeit auf Plantagen). Dort ist die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung somit am größten.
Es soll im folgenden Thesenpapier also die Fragestellung bearbeitet werden, inwiefern eine gesetzliche Verankerung von Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten notwendig ist und ob, bzw. wie damit entsprechende Verbesserungen hinsichtlich sozialer und ökologischer Faktoren erreicht werden können. Hierzu wird in Kapitel 2 die Verantwortung von Unternehmen in der Wertschöpfungskette im Allgemeinen aufgegriffen und konkrete notwendige Bestandteile einer gesetzlichen Regelung sowie die Auswirkungen auf entsprechend betroffene Unternehmen aufgeführt. Im darauffolgenden Kapitel wird Bezug auf die aktuelle Rechtslage genommen, um am Ende ein Fazit zu ziehen und dort etwaige Gegenargumente aufzuführen.
2. Verantwortung in der Wertschöpfungskette
Der Einfluss von Unternehmen auf soziale und ökologische Bedingungen ist auf der gesamten Welt immens. Auf der einen Seite versuchen sich viele Unternehmen (oft vor allem große multinationale Konzerne) der daraus entstehenden Verantwortung zu entziehen.3 Auf der anderen Seite geben laut einer aktuellen Befragung 43 Prozent der Finanzverantwortlichen an, bei ihren Lieferanten stärker auf Nachhaltigkeit zu achten. Dabei sind CO2-Reduktion, Menschenrechte, humane Arbeitsbedingungen sowie Energieeffizienz die Kernaspekte.4 Vielen Unternehmen ist damit der nachhaltige Umgang mit Ressourcen, auch über das eigene Unternehmen hinaus, entlang deren Lieferkette, wichtig. An die in Kapitel 3 angesprochene freiwillige Selbstverpflichtung im Zuge des Nationalen Aktionsplans (NAP) halten sich im Moment allerdings nur ca. 22 Prozent der zuletzt befragten Unternehmen.5 Dies zeigt, dass eine entsprechende freiwillige Regelung, wie sie bisher umgesetzt war, nicht funktioniert. Dabei wäre zu erwarten, dass Unternehmen zumindest in einem größeren Umfang, gewissen ethischen Grundsätzen folgen, ohne dass diese gesetzlich geregelt werden müssen. Nach den traditionellen Grundsätzen der Moral von Immanuel Kant wäre zu schlussfolgern, dass Unternehmen bereits so handeln müssten, wie es nun durch die Gesetzgebung vorgesehen ist. Er beschreibt zudem, dass bereits die reine Vernunft dem Menschen ein Sittengesetz gebe, nach welchem dieser handle.6 Diese moralische Norm als Teil der Pflichtenethik sollte in der heutigen Zeit gerade Aspekte wie Menschenrechtsverletzungen oder Umweltzerstörung abdecken. In der Theorie hat eine Missachtung entsprechender Konventionen allerdings Sanktionen, in Form von gesellschaftlicher Ächtung, zur Folge.7 Dies würde bedeuten, dass Endverbraucher die Produkte von Unternehmen, die diesen Grundsätzen nicht folgen, nicht kaufen würden. Es zeigt sich allerdings, dass Sanktionen so bisher nicht stattgefunden haben und somit Unternehmen nicht gezwungen waren, sich an entsprechende Konventionen zu halten.
In Zeiten von „Fridays for Future” oder dem „Übereinkommen von Paris“ sind Themen wie Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung allgegenwärtig. Dementsprechend steigt der Druck von Finanzmarktteilnehmern und anderen Stakeholdern auf Unternehmen. Sie sollen Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) stärker berücksichtigen. Bisher gibt es die systematische und nachhaltige Berücksichtigung von ESG-Faktoren, wenn überhaupt, am Kapitalmarkt. Zum einen schaffte die Europäische Union dort einen einheitlichen Rahmen durch die Transparenz- und Taxonomieverordnung, die Vorgaben für nachhaltige Investitionen und entsprechende Offenlegungspflichten definiert.8 Zum anderen wurden und werden Anleger sensibler für das Thema und die Investitionen in nachhaltige Investments steigen seit vielen Jahren an. So haben sich entsprechende Investitionen von 2017 bis 2019 etwa verdoppelt.9
Folglich liegt auf der Hand, dass Unternehmen aus eigenem Interesse unternehmerische Gesellschaftsverantwortung (Corporate Social Responsibility (CSR)) priorisieren sollten. Es kann ein direkter Zusammenhang von CSR und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen gezeigt werden. Vor allem im Bereich Humanressourcen, Risiko- und Reputationsmanagement sowie Innovationen zeigt sich ein positiver Einfluss von CSR. So steigt die Relevanz von CSR bei der Rekrutierung von Mitarbeitern auf wettbewerbsintensiven Arbeitsmärkten. Darüber hinaus können Risiken durch CSR-Aspekte wie Transparenz und Menschenrechte vermieden und damit auch Reputationsschäden minimiert werden. Indirekt kann somit auch (z. B. durch arbeitnehmerfreundliche Arbeitsplätze) die Innovationskraft des Unternehmens gesteigert und somit ein höherer Unternehmenswert erzielt werden.10 Zudem konnten Studien zeigen, dass Unternehmen mit einer CSR-Implementierung bis zu 12,4 Prozent höhere Gewinnmargen aufwiesen als Konkurrenzunternehmen ohne entsprechende Berücksichtigung.11
Es stellt sich jedoch die Frage, welche konkreten Maßnahmen verfolgt werden müssen, um tatsächliche Verbesserungen entlang der Wertschöpfungskette in sozialen und ökologischen Aspekten zu erreichen. Die sachlichen Anwendungsbereiche müssen dabei nicht neu definiert werden. Es könnte auf das UN-Leitprinzip 12 verwiesen werden und so mindestens eine Verpflichtung der kodifizierten Menschen- und Arbeitsrechtskonventionen implementiert werden. Eine allgemeine Sorgfaltspflicht ist bisher bereits im Bürgerlichen Gesetzbuch ((§§ 823 Abs. 1, 276 Abs. 2 BGB) verankert. Es ist jedoch weder festgehalten, dass diese im grenzüberschreitenden Verkehr gilt, noch ist definiert, wie diese auszusehen hat.12 Dr. Miriam Saage-Maaß hat für den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des deutschen Bundestages fünf konkrete Punkte ausgearbeitet, die Bestandteil eines wirksamen Lieferkettengesetzes sein müssten:
- Grundsatzerklärung: Öffentliche Erklärung des Unternehmens zur Achtung der Menschenrechte.
- Risikoanalyse: Tatsächliche/potenzielle Auswirkungen der Geschäftstätigkeit müssen regelmäßig und vor jeder strategischen Geschäftsentscheidung ermittelt und bewertet werden. So kann ein Überblick und Transparenz über die Lieferketten erlangt werden.
- Gegenmaßnahmen: Maßnahmenergreifung, um Beeinträchtigungen zu verhindern, bzw. bestehende zu beenden, abzumildern oder wiedergutzumachen.
- Berichterstattung: Identifizierte Risiken sowie Präventions- und Abhilfemaßnahmen müssen veröffentlich werden.
- Unmittelbarer Beschwerdemechanismus: Betroffene müssen unmittelbare Beschwerdemöglichkeit haben.13
Der tatsächliche Mehrwert eines Lieferkettengesetzes hängt vor allem von den Abhilfemaßnahmen der Unternehmen ab. Gemäß UN-Leitprinzipien sollten folgende Kriterien berücksichtigt werden: Die zu erwartende Schwere, das Ausmaß sowie die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung; länder-, schutzgut- und branchenspezifische Risiken; die Unmittelbarkeit des Verursachungsbeitrages; die Nähe zum Schadensereignis; die Größe des Unternehmens.14
Darüber hinaus wird ein solcher Mechanismus nur funktionieren, wenn bei Nichteinhaltung Sanktionen die Folge sind. So wäre ein Bußgeld in Abhängigkeit vom Umsatz, wie dies auch in vielen anderen Bereichen Anwendung findet, denkbar.15
Eine bisher offene, allerdings sehr weitreichende Fragestellung, ist die nach dem Umfang der Verantwortlichkeit eines Unternehmens. Sprich, ob dies lediglich für den direkten Lieferanten gilt oder wiederum auch für dessen Lieferanten, bzw. entlang der gesamten Lieferkette. Je weitreichender die Regelung, desto wirksamer wird sie sein. Dies hat jedoch auch einen deutlichen Mehraufwand für die Unternehmen zur Folge und bedeutet weitreichendere Haftung.16
Insgesamt muss die Motivation zur Umsetzung von ökologischen und sozialen Standards zwischen Unternehmen und sonstigen Stakeholdern unterschieden werden. Die Motivation von Unternehmen wird meist wirtschaftlicher Natur sein, um die zuvor beschriebenen Vorteile realisieren und damit einen betriebswirtschaftlichen Mehrwert generieren zu können. Sonstige Stakeholder erwarten von Unternehmen jedoch tatsächlich nachhaltig Verantwortung im sozialen sowie ökologischen Sinn für deren Handeln zu übernehmen, was wiederum deren Lieferanten miteinschließt.17
3. Aktuelle Rechtslage
Die aktuellen Debatten in Deutschland über die Notwendigkeit eines Lieferkettengesetzes resultieren aus dem NAP zur Umsetzung der VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Dort wurde bisher auf eine freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen gesetzt.18 Im aktuellen Koalitionsvertrag ist vorgesehen, national gesetzlich tätig zu werden, sollte die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht ausreichen.19 Bisher konnten sich die verschiedenen Interessengruppen allerdings nicht auf einen Gesetzesentwurf einigen. Vor allem im Wirtschaftsministerium ist die Sorge über Zusatzbelastungen für Unternehmen groß. Bundesentwicklungsminister Müller sowie Arbeitsminister Heil drängen wiederum auf eine zeitnahe Einigung und Umsetzung eines Lieferkettengesetzes. Dies soll noch in der laufenden Legislaturperiode geschehen.20
Verschiedene Staaten wie z. B. Frankreich, Großbritannien oder die Niederlande haben auf nationaler Ebene bereits Gesetzte, die zumindest in Teilen das abdecken, was ein Lieferkettengesetz in Deutschland berücksichtigen soll.21 Das französische Sorgfaltspflichtgesetz ist dabei das bisher weitreichendste weltweit und kann entsprechend als Vorbild gesehen werden.22
Auch in der Europäischen Union (EU) soll im Jahr 2021 ein Gesetzesentwurf für ein europäisches Lieferkettengesetz eingereicht werden. Damit soll auf Basis der aktuell laufenden öffentlichen Konsultation ein Regelungsvorschlag erstellt werden, der die Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung gemäß des europäischen Grünen Deals verankert.23 Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sollte dabei genutzt werden, um eine entsprechende EU-weite Regelung voranzutreiben.24 So konnte erreicht werden, dass der EU-Rat Anfang Dezember die Schlussfolgerung zu Menschenrechten und menschenwürdiger Arbeit in globalen Lieferketten angenommen hat. Die EU-Kommission wird somit aufgefordert, im Jahr 2021 einen EU-Rechtsrahmen für nachhaltige Unternehmensführung, wozu auch nachhaltige Lieferketten, Förderung von Menschenrechten und soziale sowie ökologische Standards zählen, vorzulegen.25 Eine Einigung in Deutschland, in Form eines weitreichenden Lieferkettengesetztes, könnte einer europäischen Regelung Nachdruck verleihen und hätte Vorbildcharakter.26
[...]
1 Initiative Lieferkettengesetz (2020); Marquart (2019).
2 Bundesregierung (2018), S. 156; Koch; Specht (2020).
3 Polotzek u. a. (2020), S. 227.
4 Dentz (2020), S. 8.
5 Riedel; Specht (2020).
6 Kant (1913), S. 31 ff.
7 Kant (1913), S. 37.
8 Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088, ABL L 2020/198, 13
9 Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (2020), S. 8.
10 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2008), S. 10 f.
11 Stibbe (2019), S. 47.
12 Saage-Maaß (2020), S. 4.
13 Saage-Maaß (2020), S. 4 ff.
14 Saage-Maaß (2020), S. 6.
15 Leifker (2020), S. 9; Saage-Maaß (2020), S. 7 f.
16 Koch; Specht (2020).
17 Stibbe (2019), S. 46 f.
18 Saage-Maaß (2020), S. 1.
19 Bundesregierung (2018), S. 156.
20 Koch; Specht (2020).
21 Niederfranke (2020), S. 1.
22 Deutscher Bundestag (2020).
23 Europäische Kommission (2020), S. 4.
24 Bundesregierung (2018), S. 156.
25 Council of the European Union (2020), S. 2 ff.
26 Saage-Maaß (2020), S. 2.