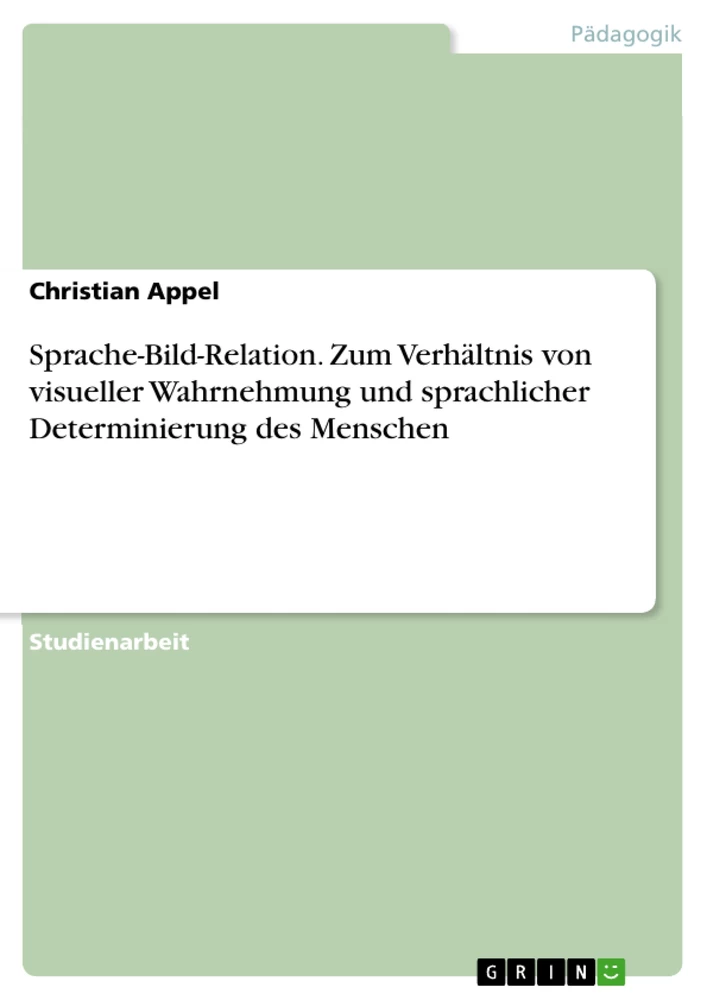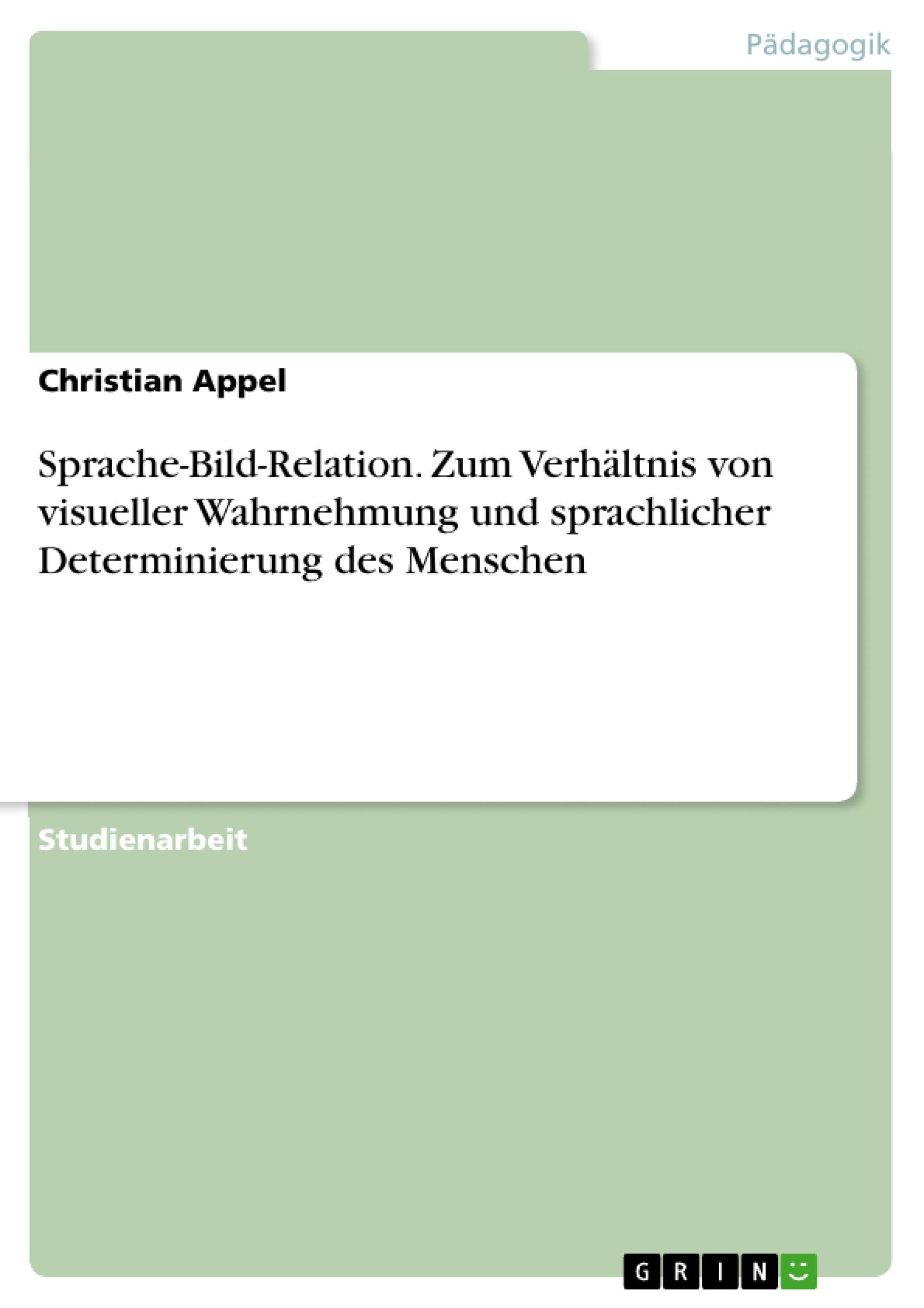Ist die hohe Position der visuellen Wahrnehmung innerhalb der Sinneshierarchie des modernen Menschen tatsächlich auf eine verstärkte Masse medialer Vermittlungsprozesse zurückzuführen, oder ist der Mensch von Natur aus im Rahmen seiner empirischen Wahrnehmung auf visuelle Dominanz angewiesen? Und wenn dies der Fall ist, wie lässt sich gerade wegen dieser Entwicklung das Bildungspotential von Bildern trotz allem zutage führen? Diesen Fragen geht die vorliegende Arbeit nach.
Den Thesen, unter anderem von Postman, wurden im Seminar zunächst drei unterschiedliche Theorien zum kognitiven Bildbegriff aus der Semiotik (Ferdinand de Saussurre), der Philosophie (Platon) und der Psychologie bzw. Erziehungswissenschaft (Dehn) gegenübergestellt, um sich schließlich in einem zweiten Teil der Sitzung anhand von Beispielen dem tatsächlichen Bildungspotential von Bildern im Vergleich zum Text zu widmen.
Die Wahrnehmung jüngerer Generationen ist zwangsläufig aufgrund von Werbung, Filmen, Fotoapparaten zunehmend visuell geprägt. Daran kann es keine Zweifel geben. Dadurch stellt sich im Allgemeinen jedoch bekanntermaßen die Frage, ob durch die zunehmend visuelle Wahrnehmung nicht verlernt wird, sich die Welt (im Sinne des klassischen Bildungsbegriffs) sinnlich, durch eigene Erfahrungen, die nicht mittels Bildschirm als Medium übermittelt sind, anzueignen. Die eben genannten Aussagen gipfeln letztlich sogar in der Auffassung, dass der Mensch heutzutage sogar quasi Geißel seiner eigenen Mediennutzung und somit vollkommen unfähig zur direkten Erfahrung der Welt geworden ist bzw. werden wird.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Darstellung verschiedener Theorien zum kognitiven Bildbegriff
2.1 Das kognitive Bild in der Semiotik
2.2 Das kognitive Bild in der Philosophie
2.3 Der psychologisch-erziehungswissenschaftliche Bildbegriff
3 Überlegungen zum Bildungsgehalt von Bildern
4 Das Konzept der Visual literacy
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis
7. Anhang