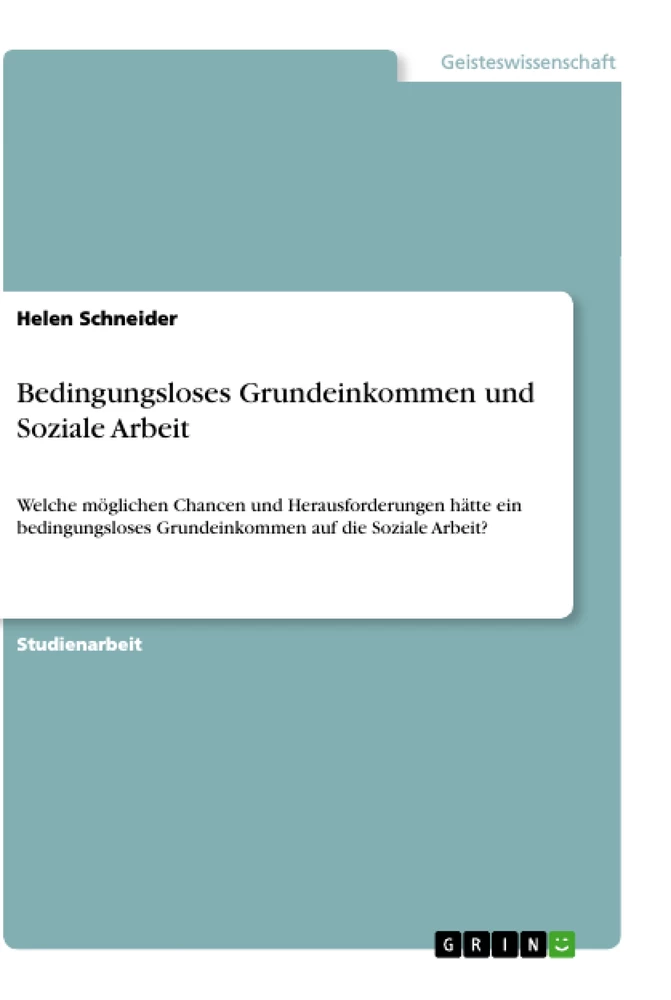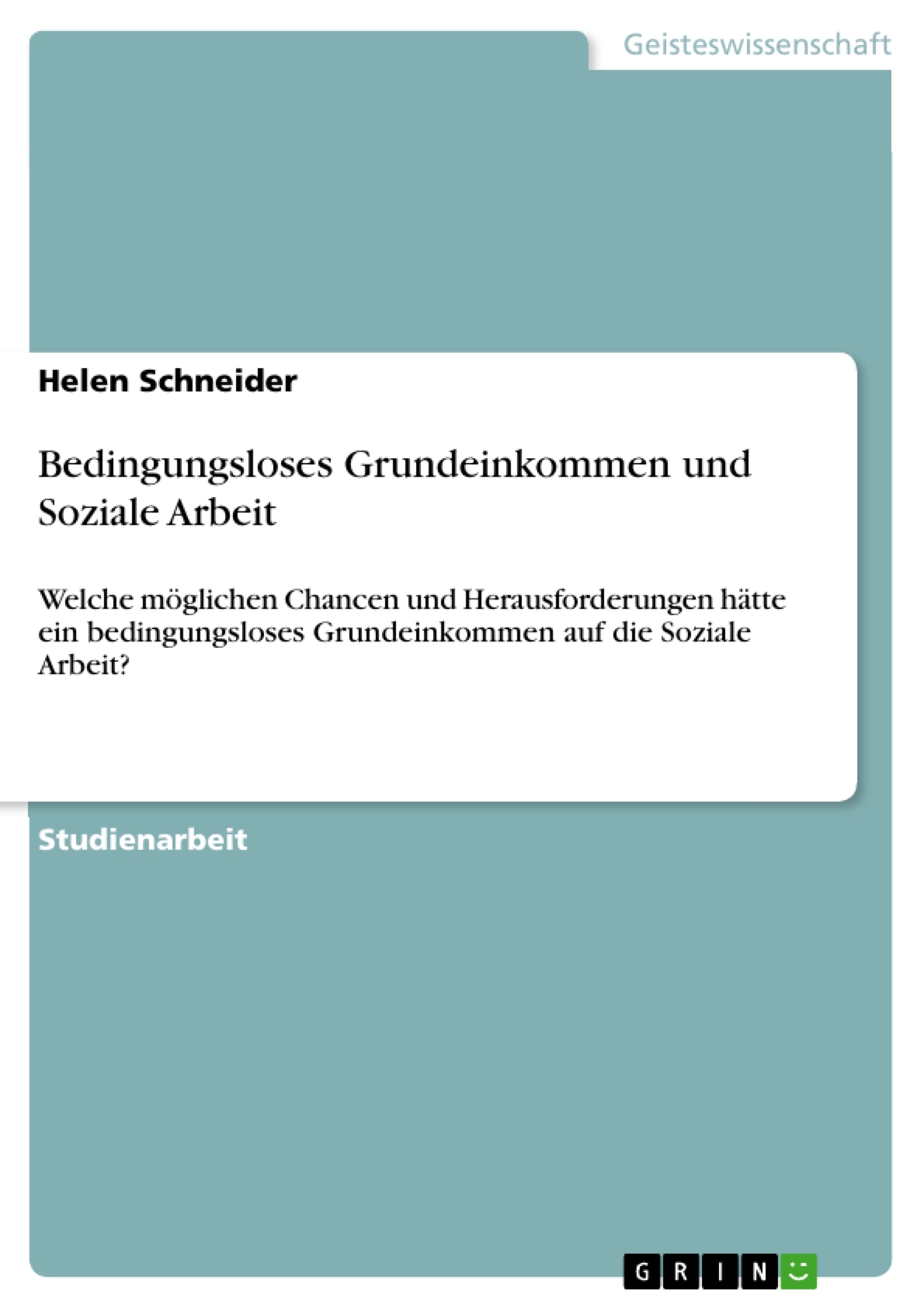Welches Potential steckt hinter dem BGE Konzept? Eher Utopie oder schon in naher Zukunft realisierbar? Und welche möglichen Chancen und Herausforderungen könnte ein BGE auf die Soziale Arbeit haben? Diesen Fragen soll die vorliegende Arbeit nachgehen.
Inhalte dieser Arbeit sind die Auseinandersetzung mit dem BGE. Welche grundliegenden Konzepte und Ideen stecken dahinter? Es werden die historischen Wurzeln des BGE beleuchtet. Die vorliegende Arbeit wird keine speziellen Konzepte des BGEs erläutern, sondern die grundlegenden Vor- und Nachteile dieser Einkommensart darlegen. Außerdem werden die möglichen Auswirkungen eines BGEs dargestellt. Bezug wird hierbei auf die Ökonomie, die Sozialpolitik und die Gesellschaft genommen. Die Finanzierbarkeit des BGEs ist im wissenschaftlichen Diskurs ein breit erörtertes Thema. Dennoch wird das Thema der Finanzierbarkeit nicht Inhalt dieser Arbeit sein, da der inhaltliche Schwerpunkt auf den Auswirkungen für die Soziale Arbeit liegt.
Im dritten Kapitel liegt der Schwerpunkt auf der Sozialen Arbeit. Es wird näher auf die Beziehung zwischen Sozialpolitik und Sozialer Arbeit eingegangen und welche Möglichkeiten und Chancen sich ergeben, wenn Sozialarbeitende politisch handeln und sich in diesen politischen Diskurs einbringen. Das vierte Kapitel verbindet die Soziale Arbeit und das BGE. Welche möglichen Effekte könnte ein BGE auf die Praxis der Sozialarbeitenden haben? Außerdem werden auch die möglichen Herausforderungen beschrieben, welche eine Einführung des BGE mit sich bringen würde.
Im Fazit werden nochmals alle relevanten Punkte aufgeführt und abschließend versucht, die Leitfrage der vorliegenden Hausarbeit anhand der genannten Gesichtspunkte zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Das BGE
2.1 Die Grundidee des BGE
2.2 Die historischen Wurzeln
3 Auswirkungen des BGEs auf
3.1 die Ökonomie
3.2 die Sozialpolitik
3.3 die Gesellschaft
4 Soziale Arbeit und Politik
5 Soziale Arbeit und BGE
6 Fazit
7 Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
NGO Non Governmental Organisation (Nichtregierungsorganisation)
BGE Bedingungsloses Grundeinkommen
ALG II Arbeitslosengeld II (Hartz-IV)
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Bedürfnispyramide nach Maslow
1 Einleitung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
So formuliert das „Netzwerk Grundeinkommen“ den Einstieg ihrer Informationsbroschüre zur Forderung der Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens (kurz: BGE) in Deutschland. Dieses Thema ist momentan allgegenwärtig und erfährt eine derartige Medienpräsenz, obwohl es schon seit einigen Jahren immer wieder diskutiert wird. Vor allem im Zuge der Corona-Pandemie entfachte der Diskurs erneut. Aber auch durch die aktiven Bemühungen der Non-governmental organization (kurz: NGO) „Mein Grundeinkommen“ gewinnt das Thema zunehmend an Attraktivität. Erst im August dieses Jahres startete das Pilotprojekt Grundeinkommen der NGO. Unter den vielen Befürworter*innen, wie zum Beispiel Götz Werner, Gründer des dm-drogerie markt, häufen sich auch die negativen Stimmen. Das BGE wird von den Kritiker*innen als Utopie abgetan und als unrealistisch angesehen. Doch welches Potential steckt hinter dem BGE Konzept? Eher Utopie oder schon in naher Zukunft realisierbar? Und welche möglichen Chancen und Herausforderungen könnte ein BGE auf die Soziale Arbeit haben? Diesen Fragen soll die vorliegende Arbeit nachgehen.
Inhalte dieser Arbeit sind im folgenden Kapitel die Auseinandersetzung mit dem BGE. Welche grundliegenden Konzepte und Ideen stecken dahinter? Es werden die historischen Wurzeln des BGE beleuchtet. Die vorliegende Arbeit wird keine speziellen Konzepte des BGEs erläutern, sondern die grundlegenden Vor- und Nachteile dieser Einkommensart darlegen. Außerdem werden die möglichen Auswirkungen eines BGEs dargestellt. Bezug wird hierbei auf die Ökonomie, die Sozialpolitik und die Gesellschaft genommen. Die Finanzierbarkeit des BGEs ist im wissenschaftlichen Diskurs ein breit erörtertes Thema. Dennoch wird das Thema der Finanzierbarkeit nicht Inhalt dieser Arbeit sein, da der inhaltliche Schwerpunkt auf den Auswirkungen für die Soziale Arbeit liegt.
Im dritten Kapitel liegt der Schwerpunkt auf der Sozialen Arbeit. Es wird näher auf die Beziehung zwischen Sozialpolitik und Sozialer Arbeit eingegangen und welche Möglichkeiten und Chancen sich ergeben, wenn Sozialarbeitende politisch handeln und sich in diesen politischen Diskurs einbringen. Das vierte Kapitel verbindet die Soziale Arbeit und das BGE. Welche möglichen Effekte könnte ein BGE auf die Praxis der Sozialarbeitenden haben? Außerdem werden auch die möglichen Herausforderungen beschrieben, welche eine Einführung des BGE mit sich bringen würde.
Im Fazit werden nochmals alle relevanten Punkte aufgeführt und abschließend versucht, die Leitfrage der vorliegenden Hausarbeit anhand der genannten Gesichtspunkte zu beantworten.
2 Das BGE
Im Folgenden wird näher auf das Bedingungslose Grundeinkommen eingegangen. Es wird zum einen auf die Grundidee des BGEs eingegangen, sowie die historischen Wurzeln beleuchtet.
2.1 Die Grundidee des BGE
Zunächst ist wichtig zu bemerken, dass es nicht ein konkretes Modell des BGEs gibt. Im wissenschaftlichen und politischen Diskurs findet sich eine Vielzahl verschiedener Modelle. Im wissenschaftlichen Diskurs wird teilweise auch vom Solidarischen Bürgergeld oder von negativen Einkommenssteuern gesprochen (vgl. Brenner 2012, S. 100f.). Die Grundidee bleibt dennoch dieselbe. Auch die Herkunft der Modelle ist sehr divers. Einige Modelle werden eher dem linken Politikspektrum zugeordnet, andere basieren auf einer sehr neoliberalen Sichtweise (vgl. Bäcker/Naegle/Bispinck 2020, S. 303). Dennoch gibt es einige Aspekte, welche alle Modelle vereinen. Unter dem BGE wird ein Einkommen verstanden, dass jeder Person ohne Bedürftigkeitsprüfung zur Verfügung steht. Es ist an keine Bedingungen oder Gegenleistungen geknüpft, sondern soll bedingungslos an alle Bürger*innen der Bundesrepublik Deutschland ausgezahlt werden (vgl. ebd.). Die Ziele eines BGEs sollen die Vereinfachung des Sozialsystems darstellen, vor allem hinsichtlich der bürokratischen Abläufe. Außerdem soll das BGE die finanzielle Existenz der Bürger*innen sichern, ohne dass diese unbedingt einer Erwerbsarbeit nachgehen müssen. Des Weiteren verspricht man sich von dem BGE, dass soziale Schieflagen und vor allem Armut besser bekämpft werden können, indem das BGE ausgezahlt wird. Dies dient vor allem der Entstigmatisierung langjähriger Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger*innen (vgl. ebd.). Ziel des Grundeinkommens ist es, dass niemand unterhalb des Existenzminimums leben muss und es jede Person, egal welchen Alters, welchen Geschlechts, Beruf oder Familienstand erhält (vgl. Hohenleitner/Straubhaar 2007, S. 14).
Baudach und Zink identifizieren aus den gängigen Definitionen des BGEs drei Merkmale, die sich auf alle Konzepte übertragen lassen. Zum einen der „individuelle Anspruch“. Das bedeutet, dass das Einkommen an alle Individuen ausgezahlt wird, nicht etwa an Haushalte oder haushaltsähnliche Gemeinschaften. Außerdem findet vor der Auszahlung keine Bedürftigkeitsprüfung statt. Das Geld erhält jede Person unabhängig davon, ob sie bedürftig ist oder nicht. Das dritte Merkmal ist die Bedingungslosigkeit, die sich schon im Namen des BGEs wiederfindet. Die Auszahlung ist „nicht an Bedingungen geknüpft, wie etwa der Bereitschaft zu arbeiten“ (Baudach/Zink 2019, S. 252). Das BGE versteht sich nicht als Lohn einer Erwerbstätigkeit bzw. einer Leistung, sondern soll viel mehr als „Leistungen und Tätigkeiten aller Art“ angesehen werden (Fischer 2013, S. 79).
Nicht nur in Deutschland wird über das Grundeinkommen diskutiert. Auch in anderen Ländern, wie beispielsweise in Finnland, der Schweiz oder sogar in Namibia (vgl. ebd., S. 272f.). In der Schweiz wurde im Jahr 2016 sogar über eine mögliche Einführung eines Grundeinkommens per Volksentscheid abgestimmt. 78% der Bürger*innen entschieden sich gegen ein Grundeinkommen, nur 22% der Bürger*innen stimmten dafür. Einer der wichtigsten Gründe, warum viele gegen ein Grundeinkommen gestimmt hatten, waren die Unklarheiten über die Finanzierungsmöglichkeiten (vgl. ZEIT Online 2016, o.S.). Das Schweizer Grundeinkommensmodell basierte eher auf einem neoliberalen Ansatz, welches natürlich die Existenzsicherung aller Menschen zum Ziel hat, vorrangig aber das Ziel verfolgt, die staatlichen Sozialausgaben zu reduzieren (vgl. ebd., S. 274). Dieses Modell steht dem humanistischen bzw. emanzipatorischen Modell, welches beispielsweise Götz Werner vertritt, gegenüber. Das humanistische Modell geht davon aus, dass trotz der zusätzlichen Transferzahlung die Arbeitsmotivation der Bürger*innen nicht verloren geht (vgl. ebd.). Werner vertritt die Auffassung, dass wenn die Menschen „nicht mehr allein auf Erwerbseinkommen angewiesen sind, werden sie eher bereit sein, weniger zu arbeiten bzw. anders. Durch ein Grundeinkommen würde die schöpferische Entfaltung in der Familien-, Erziehungs-, Pflege-, und Bildungsarbeit, in Wissenschaft und Kunst – also der Kulturarbeit im weitesten Sinn – ermöglicht“ (Werner/Häussner 2006, S. 31).
Baudach und Zink unterstreichen, dass diese grundsätzlich verschiedenen Annahmen der beiden Modelle dafür sorgen, dass der Diskurs um ein BGE in zwei verschiedene „Lager“ aufgeteilt ist (vgl. ebd.). Auch über die Höhe eines möglichen Einkommens herrscht in der Grundeinkommensdebatte noch kein Konsens. In Finnland wurde seit 2017 für die Dauer von zwei Jahren, ein Betrag in Höhe von 560€ an 2.000 arbeitslose Bürger*innen ausbezahlt. Dieser Betrag ersetzte das Arbeitslosengeld, sowie das Krankengeld. Nicht mit einberechnet wurde das Geld für die Sozialversicherung. Dieses erhielten sie zusätzlich (vgl. ebd., S. 272). Eine Zwischenbefragung ergab, dass die Programmteilnehmer*innen weniger Stress hatten und motivierter waren, sich eigenständig um einen neuen Arbeitsplatz kümmerten. Aus diesen Ergebnissen, welche auch andere Modellländer zeigten, bestand durch eine Grundeinkommensauszahlung nicht die Gefahr, dass die Leistungsmotivation stark abfiel. Die Teilnehmer*innen berichteten eher von einer deutlich verbesserten Lebensqualität, welche die Motivation, einer Arbeit nachzugehen, eher noch befeuerte (vgl. ebd., S. 273). Dennoch betonen Baudach und Zink, dass die Modellprojekte nicht die tatsächlichen Auswirkungen einer umfassenden Systemumstellung in Deutschland widerspiegeln können. Ein Grund dafür ist, dass andere Länder sich von ihren sozialpolitischen und sozioökonomischen Rahmenbedingungen natürlich stark von deutschen Verhältnissen unterscheiden (vgl. ebd., S. 270). Dennoch geben die bisherigen Versuche einen Einblick, wie sich ein mögliches Grundeinkommen auswirken könnte.
2.2 Die historischen Wurzeln
Das BGE wird nicht erst seit diesem Jahr diskutiert. Schon weit vor dieser Zeit gab es die ersten Ideen für ein Grundeinkommen für alle. Die ersten Gedanken lassen sich im 16. Jahrhundert von Morus und Vives verzeichnen, welche im 18. Jahrhundert von Thomas Paine und Thomas Spence weiter konkretisiert wurden (vgl. Vanderborght/Van Parijs 2005, S. 15-22). Im Jahre 1795 wurde als Reaktion auf die Brotaufstände und die Hungersnot im südenglischen Speen das sogenannte Speenhamland-System als Gesetz erlassen. Dieses sah vor, dass alle armen Arbeiter*innen einen, an den Getreidepreis und die Haushaltsgröße angepassten Geldbetrag der Kommunen erhielten, um zumindest die nötigsten Dinge zu finanzieren (vgl. ebd., S. 17). Das Speenhamland-System wurde jedoch von einigen kritisiert, unter anderem von Thomas Malthus.
Er schrieb in seinem „Essay on the Principle of Population“, dass die Ausweitung der Hilfeleistungen nur dazu führen würde, dass die Bedürftigen weniger oder nicht mehr arbeiten würden und mehr Kinder bekommen würden. Etwa 40 Jahre später, wurde das stark kritisierte Speenhamland-System wieder abgeschafft (vgl. ebd.).
Thomas Paine legte im Jahre 1797 in seinem Buch „Agrarische Gerechtigkeit“ dar, dass allen Bürger*innen ab Vollendung ihres 20. Lebensjahres ein gewisser Betrag ausbezahlt werden soll. Außerdem soll allen Bürger*innen ab ihrem 50. Lebensjahr bis zum Lebensende eine weitere Summe ausgezahlt werden. Paine unterstreicht, dass diese Beiträge alle Bürger*innen erhalten sollen, unabhängig ihres eigenen Vermögens (vgl. ebd., S. 21). Er rechtfertigt seine Überlegungen damit, dass die Erde jedem*r Bürger*in zu gleichen Teilen gehört und deswegen auch jede*r ein Anrecht auf eine gewisse Geldsumme hat. Thomas Spence, ein Zeitgenosse Paines, kritisiert diese Überlegungen vehement. In seinem Werk „Die Rechte der Kinder“ legt er seine Kritikpunkte dar und formuliert eigene Überlegungen. Seine Idee ist, dass jede Gemeinde ihre Immobilien versteigern solle und aus diesem Gewinn, sowie der Regierungssteuer die Gemeindeausgaben decken solle. Der Überschuss aus diesen Geldern, solle vierteljährlich allen Einwohner*innen gleichermaßen ausbezahlt werden (vgl. ebd., S. 23). Auch er spricht sich dafür aus, dass alle Bürger*innen, unabhängig ihres Einkommens, gesellschaftlichem oder familiären Status diese finanzielle Unterstützung erhalten sollen. Spences Konzept wird einige Jahre später noch immer diskutiert, wird aber letztendlich über den Haufen geworfen (vgl. ebd.). Ähnlich wie Spences Idee, fordert der Franzose Charles Fourier eine materielle Grundversorgung für alle (vgl. ebd.; vgl. Schloen 2019, S. 14). Erst Mitte des 20. Jahrhunderts entfachte die Debatte eines Grundeinkommens erneut. Befeuert wurde diese vor allem durch Milton Friedman und James Tobin. Aber auch diese Debatte fand in der breiten Bevölkerung wenig Anklang. Erst in den 1980er Jahren entbrannte in Nordeuropa die Debatte um ein Grundeinkommen (vgl. ebd., S. 31). Hauptsächlich wurde die Debatte von J.P. Kuiper angeführt und sogar die Partei „Politieke Partij Radicalen“ nimmt das Grundeinkommen in ihr Wahlprogramm auf (ebd.). Gleichzeitig entfachte die Diskussion auch in anderen europäischen Ländern, es wurde aber nie vollumfänglich umgesetzt (vgl. ebd.).
3 Auswirkungen des BGEs auf…
Dieses Kapitel beleuchtet die möglichen Auswirkungen eines BGEs auf die Ökonomie, die Sozialpolitik sowie auf die Gesellschaft. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass die Effekte und Entwicklungsrichtungen nicht mit voller Sicherheit prognostiziert werden können. Viel mehr können nur Vermutungen getroffen werden, welche Auswirkungen ein BGE haben könnte (vgl. Petersen 2017, S. 630). Es wurden bereits in einigen Ländern (Finnland, Kanada, Namibia) Studien durchgeführt, in denen das Grundeinkommen für einen gewissen Zeitraum ausgezahlt wurde. Anhand dieser Studien können sich auch Vermutungen definieren lassen, welche Effekte ein BGE auf Deutschland hätte. Allerdings hängen diese auch immer mit der Höhe des ausgezahlten Einkommens zusammen (vgl. Baudach/Zink 2019 , S. 269).
Dies muss bei allen hypothetischen Auswirkungen bedacht werden. Auch die Konzepte (neoliberal oder humanistisch), welche dem BGE zugrunde liegen, fließen in die möglichen Auswirkungen mit ein.
3.1 … die Ökonomie
Petersen, Senior Adviser der Bertelsmann Stiftung legt dar, dass ein BGE den Zwang reduzieren könnte einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Er untermauert dies mit der Aussage, dass die Volkswirtschaftslehre in der Regel davon ausgeht, „(…) dass Menschen weitgehend extrinsisch motiviert sind, um tätig zu werden. Eine Erwerbsarbeit wird nur aufgenommen, wenn dafür ein Lohn gezahlt wird.“ (vgl. Petersen 2017, S. 630). Er geht von verschiedenen Szenarien aus. Zum einen wäre es denkbar, das unliebsame Arbeiten welche schlecht bezahlt und gesellschaftlich nicht anerkannt sind nur noch sporadisch ausgeübt werden. Durch ein BGE wäre vor allem im Niedriglohnsektor nicht mehr der Druck da, diesen Tätigkeiten nachzugehen. Eine wünschenswerte Reaktion seitens der Arbeitgeber und der Politik wäre, dass Tätigkeiten im Niedriglohnsektor, welche gesellschaftlich notwendig sind, nun endlich auch finanziell anerkannt werden. Eine andere mögliche Entwicklung könnte außerdem sein, dass die Arbeiten im Niedriglohnsektor zunehmen und diese als zusätzliche Einnahmequelle neben dem BGE dienen (vgl. ebd. S. 631). Dies könnte unter anderem auch damit begründet werden, dass gering qualifizierte Personen, welche zuvor Sozialhilfeleistungen erhielten, wieder einer Erwerbstätigkeit nachgehen. In einigen Fällen liegt nämlich die erhaltene Sozialhilfeleistung nur geringfügig unter einem möglichen Erwerbseinkommen (vgl. ebd.). Auch die fortschreitende Digitalisierung beinhaltet, dass in Zukunft mehr menschliche Arbeitskräfte durch moderne Automatisierungstechnologien ersetzt werden könnten (vgl. Baudach/Zink 2019, S. 248). Dies bedeutet im schlimmsten Falle die Arbeitslosigkeit für einige Personen. Diese könnten dann durch das BGE aufgefangen werden. Grundsätzlich gehen die Expert*innen aber auch davon aus, dass wegfallende Arbeitslätze auf kurz oder lang durch neue Arbeitsplätze ersetzt werden können. Allerdings könnten diese neue Qualifikations – oder Kompetenzanforderungen fordern. Hier wäre es möglich, das BGE für Fort- und Weiterbildungen zu nutzen (vgl. ebd., S. 249). Die Befürworter*innen des BGEs sehen die Chance, das Personen vermehrt Gründen und Innovationen auf den Markt bringen. Dies wäre mithilfe eines BGEs möglich, da vielen Menschen das ausreichende Startkapital für ein Unternehmen fehlt (vgl. ebd., S. 269). Auch haben sie die Hoffnung, dass die Kaufkraft wächst und das Einkommen vermehrt in den Konsum fließt, um so die Wirtschaft anzukurbeln und durch die Mehrwertsteuer den Staatshaushalt aufzubessern (vgl. ebd.). Kritiker*innen befürchten, dass eine höhere Konsumsteuer folgen könnte um das BGE zu finanzieren. So würden die Einkommensschwächeren Personen oder Haushalte wieder belastet werden, da ein größerer Anteil des Einkommens erneut in den Konsum fließt. Außerdem kritisieren sie, dass die Arbeitnehmer dann nicht mehr in der Verantwortung wären die Löhne zu erhöhen, da die Arbeitnehmer*innen durch das BGE abgesichert wären (vgl. ebd.)
[...]