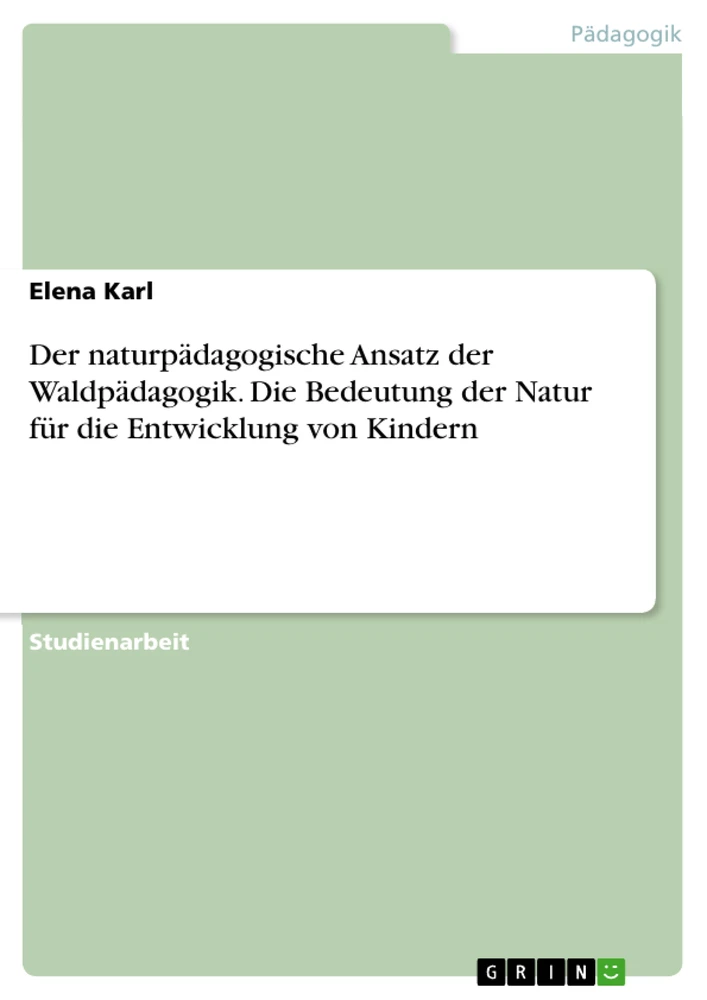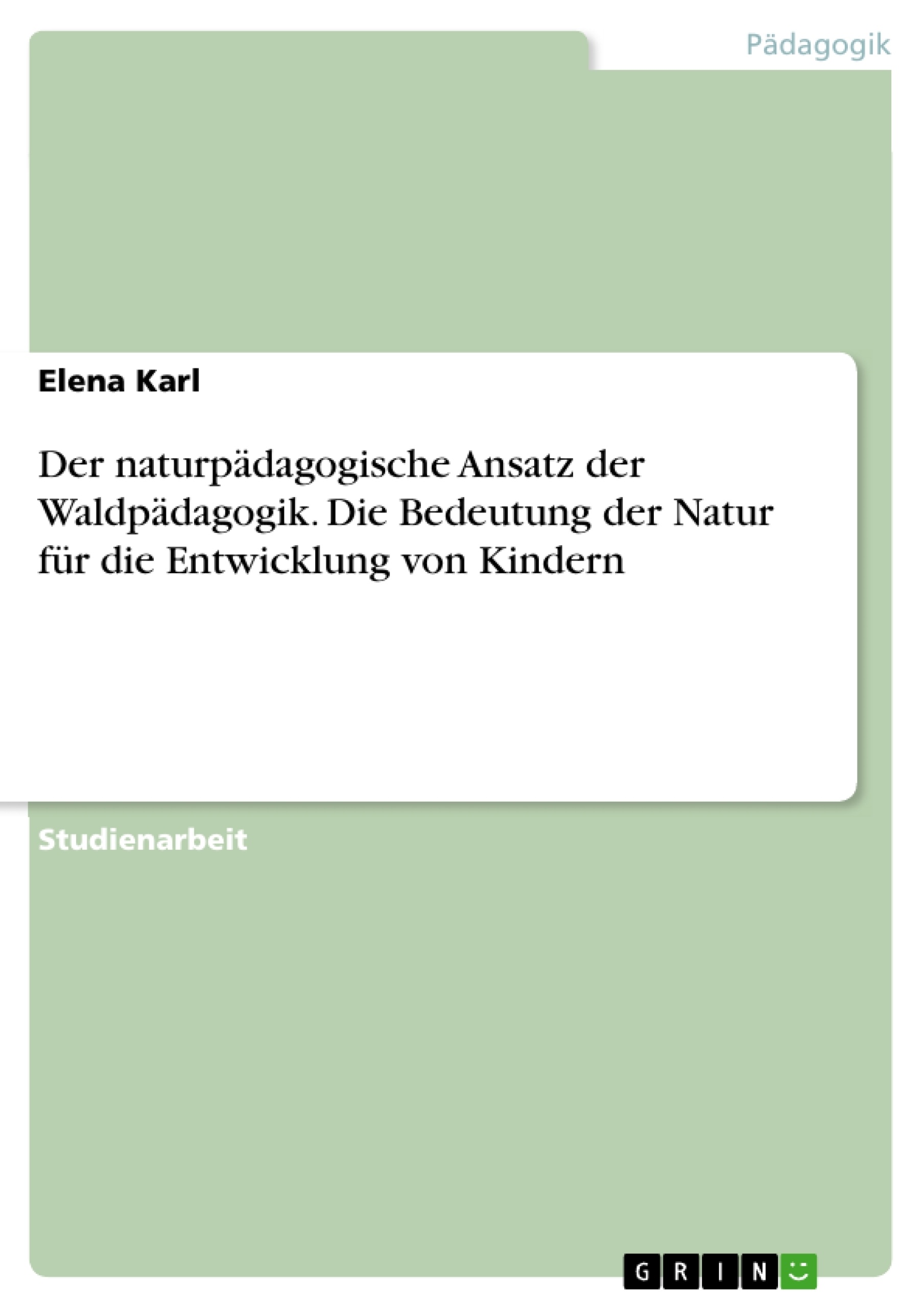Der Aktionsradius der Menschen verlagert sich heutzutage zunehmend ins Hausinnere und die Zeit draußen an der frischen Luft schwindet immer mehr. Vor allem Naturerfahrungen für Kinder sind heute nicht mehr selbstverständlich. Durch das immer seltenere, hautnahe Erleben in dem vielfältigen Lebensraum Wald entsteht Naturentfremdung. Warum es jedoch gerade für Kinder so essentiell ist, viel Zeit draußen zu verbringen, soll in dieser Arbeit geschildert werden.
Die Waldpädagogik bietet einige Anstöße und Möglichkeiten dieser Entfremdung entgegenzuwirken und vor allem Kindern wieder eine tiefere Beziehung zur Natur zu ermöglichen.
Zu Beginn soll auf den Wald als Gegenstand der Pädagogik eingegangen werden und beschrieben werden, auf welche Weise, vielfältige Naturerfahrungen essentiell für Kinder sein können. Dabei werden vier Quellen kindlicher Entwicklung unterschieden, welche im Wald ausgeschöpft werden können. Diese werden untergliedert in Sinneswahrnehmungen, Freiheit, Grenzen und Verbundenheit. Daraufhin wird beschrieben, welche Auswirkungen ein regelmäßiger Aufenthalt in der Natur auf die Gesundheit von Kindern, als auch auf die von Erwachsenen hat. Nach einer Bestimmung des Begriffs der Waldpädagogik werden das Wesen pädagogischer Konzepte und deren Grundlagen erläutert und am Beispiel von Pestalozzis ganzheitlichem Ansatz von Lernen mit Kopf, Herz und Hand weiter ausgeführt.
Im Anschluss wird ein Leitfaden für die Didaktik und Methodik in der Waldpädagogik dargelegt. Eine Zusammenfassung, sowie ein Ausblick schließen diese Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
1. Wald und Gesellschaft - Naturverstandnis im Wandel der Zeit
1. Wald als Gegenstand der Padagogik
2.1 Naturerfahrung
2.1.1 Sinneswahrnehmungen
2.1.2 Freiheit
2.1.3 Grenzen
2.1.4 Verbundenheit
2.2 Natur und Gesundheit
2.3 Begriffsbestimmung Waldpadagogik
2. Padagogische Konzepte und deren Grundlagen
3.1 Schlusselkompetenzen
3.2 Kompetenzkonzepte
3.3 padagogisches Konzept nach Pestalozzi
4. Didaktik und Methodik der Waldpadagogik
5. Fazit und Ausblick
6. Literatur
1. Wald und Gesellschaft
Der Wald gilt als Inbegriff der Natur. Er dient nicht nur als vielfaltiger Lebensraum fur diverse Pflanzen- und Tierarten, sondern pragt unser Landschaftsbild schon seit Tausenden von Jahren und beeinflusst unsere Gesellschaft seit Anbeginn der Menschheit maBgeblich. Er spielt eine groBe Rolle im Schutz von Wasser und Luft, dient als Erholungsraum fur die Menschen und wird durch den nachwachsenden Rohstoff Holz vielseitig genutzt (vgl. Kuster, 2013, S. 7ff.).
Die Bedeutung des Waldes und die Haltung gegenuber der Natur der Menschen hat sich im Laufe der Geschichte stetig verandert, wovon heute noch Marchen und Sagen zeugen (vgl. Volker, 2018). Die unberuhrte Wildnis, in der Jager und Sammler der Altsteinzeit die Natur und vor allem den Wald, als Lebensraum und Nahrungsquelle nutzten, existiert heutzutage schon lange nichtmehr (vgl. Hart- Davis, Fagan, 2018, S.30-31). Der Aktionsradius der Menschen verlagert sich heutzutage zunehmend ins Hausinnere und die Zeit drauBen an der frischen Luft schwindet immer mehr. Vor allem Naturerfahrungen fur Kinder sind heute nicht mehr selbstverstandlich. Durch das immer seltenere, hautnahe Erleben in dem vielfaltigen Lebensraum Wald entsteht Naturentfremdung. Warum es jedoch gerade fur Kinder so essentiell ist, viel Zeit drauBen zu verbringen, soll in dieser Arbeit geschildert werden. Die Waldpadagogik bietet einige AnstoBe und Moglichkeiten dieser Entfremdung entgegenzuwirken und vor allem Kindern wieder eine tiefere Beziehung zur Natur zu ermoglichen.
Zu Beginn soll auf den Wald als Gegenstand der Padagogik eingegangen werden und beschrieben werden, auf welche Weise, vielfaltige Naturerfahrungen essentiell fur Kinder sein konnen. Dabei werden vier Quellen kindlicher Entwicklung unterschieden, welche im Wald ausgeschopft werden konnen. Diese werden untergliedert in Sinneswahrnehmungen, Freiheit, Grenzen und Verbundenheit. Daraufhin wird beschrieben, welche Auswirkungen ein regelmaBiger Aufenthalt in der Natur auf die Gesundheit von Kindern, als auch auf die von Erwachsenen hat. Nach einer Bestimmung des Begriffs der Waldpadagogik, werden das Wesen padagogischer Konzepte und deren Grundlagen erlautert und am Beispiel von Pestalozzis ganzheitlichem Ansatz von Lernen mit Kopf, Herz und Hand weiter ausgefuhrt. Im Anschluss wird ein Leitfaden fur die Didaktik und Methodik in der Waldpadagogik dargelegt. Eine Zusammenfassung, sowie ein Ausblick schlieBen diese Arbeit ab.
2. Wald als Gegenstand der Padagogik
2.1 Naturerfahrung
Die kindliche Entwicklung bildet das Fundament fur die Ausbildung von wesentlichen Lebenskompetenzen und ist fur die Entwicklung der Personlichkeit ausschlaggebend. Besonders Natur- und Waldkindergarten tragen zu einer Starkung und Stabilisierung der kindlichen Entwicklung bei. Im Wald konnen Kinder nicht nur ihren angeborenen Bewegungsdrang ausleben, sondern auch ihre motorischen Fahigkeiten schulen. Der Wald bietet ihnen die ideale Umwelt, vielfaltige eigene Erfahrungen zu machen, Mut und Vertrauen in die eigenen Fahigkeiten zu entwickeln und selbst wirksam zu sein. Die auBeren Gegebenheiten wie der unbegrenzte Raum und die Ruhe helfen auBerdem dabei emotionale Stabilitat, Konzentrationsfahigkeit und Ausgeglichenheit zu verbessern. Im Vordergrund bei Naturerfahrungen steht, dass die Jungen und Madchen selbst eine aktive Rolle einnehmen und sich selbst organisieren. Das Nichtvorhandensein von vorgefertigten Spielsachen zum Beispiel, regt die Kreativitat und Phantasie an. Die Kinder haben im Wald die Moglichkeit sich neuen Herausforderungen zu stellen, Losungen fur Probleme zu finden und sich auf neue Situationen einzustellen. Die Natur bietet sowohl Kontinuitat und damit Sicherheit, als auch verschiedenste Anreize fur Kinder, die schier unerschopflich sind, da sich die Natur aufgrund von wechselnden Jahreszeiten in standigem Wandel befindet. Im Wald stoBen die Jungen und Madchen deshalb immer wieder auf neue Abenteuer. Durch den Aufenthalt in der Natur lernen die Kinder den Wald kennen und entwickeln nach und nach ein intuitives Umweltbewusstsein. (vgl. Steffen, 2019)
2.1.1 Sinneswahrnehmungen
Im Wald lernen Kinder mit all ihren Sinnen. Ihr ganzer Korper kommt zum Einsatz, wenn sie klettern, bauen, herumtoben oder nur die Vogel zwitschern horen. Der Wald bietet eine konkrete Erfahrungswelt, abseits von einem immer weniger erfahrbarem, virtuellen Raum in unserer technisierten Umwelt, in der Informationen immer ofter, nur noch durch Sehen und Horen aufgenommen werden. Das unmittelbare Leben spielt sich meist in einem sehr kleinen Radius ab. Im Gegensatz dazu, reicht die virtuelle Welt, in der wir uns bewegen, schier ins Unendliche, indem wir durch Internet, Handy und Fernsehen quasi standig und uberall auf der Welt unterwegs sein konnen. Wenn man in dieser Welt groB wird, fallt es oft schwer, Halt im Leben zu finden und sich irgendwo zuhause zu fuhlen. In der Natur sind Kinder in der Lage unmittelbare und vielfaltige Erfahrungen zu machen, die ein Fundament fur das Leben „da DrauBen“ bilden konnen. (vgl. Renz-Polster und Huther, 2016, S. 43-46)
2.1.2 Freiheit
Wenn man Kinder fragt, warum sie so gerne drauBen spielen, hort man oft, dass sie dort das machen konnen, was sie mochten. Durch das freie Spiel konnen Kinder selbst wirksam sein, sich selbst organisieren und sich ausprobieren. Betrachtet man nur wie stolz viele Kinder sind, wenn sie nach einem Tag drauBen ihre Erfolgsgeschichten erzahlen konnen, merkt man, dass sie sich selbst am meisten bestarken, wenn sie eine Herausforderung erfolgreich gemeistert haben. Kein Lob von anderen, Eltern oder Padagogen und Padagoginnen, starkt die Kinder derart in ihrem Selbstbewusstsein. Zahlreiche Studien weisen auBerdem darauf hin, dass Kinder sehr viel kreativer in einem naturlichem Umfeld spielen, als wenn sie sich mit vorgefertigten Spielzeug beschaftigen. Der kreative Instinkt der Kinder kommt zum Vorschein, wenn sie ihr Spielzeug selbst erfinden und z.B. aus Asten, Pfeil und Bogen bauen und sich dazu Geschichten ausdenken. Kinder sind in der Lage, sich im freien Spiel zusammen mit Spielkameraden ihre Umwelt genau nach ihren Bedurfnissen zu erschaffen. (vgl. Renz-Polster und Huther, 2016, S. 46-50)
2.1.3 Grenzen
Kinder erleben jedoch nicht ausschlieBlich Freiheit im Wald, sondern erfahren gleichzeitig dessen Widerstandigkeit. Die Natur passt sich nicht an uns Menschen an, sondern wir mussen uns anpassen, um uns zurechtzufinden. Im Wald gibt es nunmal keine Heizung, die man aufdrehen kann, wenn es im Herbst kalter wird. Um auch dann der Kalte zu trotzen, muss man dann zum Beispiel ein Feuer machen. Wenn die Kinder diese Leistungen aufbringen mussen, wie Stocke sammeln, das Holz aufbahren, Feuer entzunden und es aufrechterhalten, lernen sie auf sich selbst und ihre Erfahrungen zu vertrauen und Probleme selbstbewusst zu bewaltigen. Die Neugier der Kinder lockt sie immer wieder zu neuen Abenteuern, bei welchen sie immer wieder auf ihre eigenen Grenzen stoBen werden und sich ihren Angsten stellen mussen. (vgl. Renz-Polster und Huther, 2016, S. 50-53)
2.1.4 Verbundenheit
Wenn Kinder im Wald spielen, erforschen sie das unbekannte Terrain meist mit ihren Freunden. Dadurch lernen die Jungen und Madchen sich zu organisieren, finden ihre eigene Rolle in der Gruppe und erfahren das Gefuhl von Verbundenheit untereinander (vgl. Lenz, 2019, S. 10). Neben dem Erwerb von sozialer Kompetenz und dem Vertrauen zu anderen Menschen, entstehen tiefe Beziehungen zu Pflanzen, Baumen, Tieren oder besonderen Orten. Besonders Tiere spielen schon seit Tausenden von Jahren eine zentrale Rolle fur die Menschen, indem sie eine Art Brucke zwischen der wilden Natur und der Welt der Menschen schlagen (vgl. Weber, GEO online).
Die Beziehung der Kinder zur Natur erschafft ein Heimatgefuhl, welches es ermoglicht sich zufrieden und geborgen zu fuhlen. Dieses sog. „Koharenzgefuhl“ wird empfunden, wenn wir uns selbst als kompetent, also selbstwirksam wahrnehmen, soziale Anerkennung erfahren und selbstbestimmt agieren. (vgl. Renz-Polster und Huther, 2016, S. 54-56)
2.2 Natur und Gesundheit
Im Waldkindergarten ist das Thema Gesundheit immer wieder von zentraler Bedeutung. Es wird vermutet, dass Kinder, die einen Waldkindergarten besuchen, gesunder sind als gleichaltrige Kinder, eines Regelkindergartens. Da der Gesundheitsbegriff jedoch sehr subjektiv ist und unterschiedlich definiert werden kann und es noch nicht ausreichend erforscht ist, konnen nur offensichtliche Vorteile genannt werden, die sich aus dem Aufenthalt in der Natur ergeben. Durch die Bewegung in der Natur, wird das Immunsystem und die korpereigenen Abwehrkrafte gestarkt. Indem das Immunsystem auf eine Vielzahl von Keimen und Bakterien im Wald trifft, lernt das Immunsystem sich auf verschiedene Bedingungen einzustellen, was dazu fuhrt dass Kinder weniger krank werden und Allergien entgegenwirken. Gerade auch die Sonne, der naturliche Lieferant fur Vitamin D, starkt das Immunsystem zusatzlich und wirkt starkend fur die Knochen. Durch die zahlreichen Bewegungsmoglichkeiten wird der Stoffwechsel angeregt, Herz-Kreislauferkrankungen vorgebeugt und das Wachstum der Kinder gefordert. AuBerdem werden durch das Spielen im Wald Muskeln ganz naturlich aufgebaut und Ausdauer, sowie Koordination trainiert. (vgl. Renz-Polster und Huther, 2016, S. 79ff.) Laut einer Studie australischer Forscher, kann der Aufenthalt im Freien auBerdem die Sehkraft von Kindern verbessern und das Risiko von Kurzsichtigkeit bei Kindern um einiges senken (vgl. Spiegel online, 2009).
Nicht weniger bedeutsam, sind die positiven Effekte auf die Psyche der Kinder. Wenn Kinder viel Zeit im Freien verbringen, in der sie selbstwirksam sein konnen, sind sie ausgeglichener, konnen besser schlafen und weisen eine hohere Resilienz, auch im Erwachsenenalter auf (vgl. Renz-Polster und Huther, 2016, S. 84-86).
2.3 Begriffsbestimmung Waldpadagogik
In den letzten Jahren wird der Wald zunehmend als padagogischer Raum erkannt und genutzt. Waldpadagogik ist ein Teilbereich der Natur- und Umweltpadagogik im Lebensraum Wald. „Die Waldpadagogik soll die Bedeutung des Waldes ganzheitlich durch praktisches Erleben und Lernen im Wald aufzeigen und das Problembewusstsein fur die Umwelt scharfen. Die Waldpadagogik kann nicht nur zur Festigung einer gefuhlsmaBigen Bindung zum Wald als Teil der Natur fuhren, sondern uber das Verstandnis fur den Wald auch zu mehr Verstandnis fur die Natur und die Umwelt im Ganzen; dadurch kann der allgemeinen Naturentfremdung entgegengewirkt werden.“ (Bolay und Reichle, 2019, S. 33). Im Vordergrund steht hierbei stets das Wahrnehmen und Erleben mit allen Sinnen.
Waldsterben und weitere Probleme, die durch den Klimawandel bedingt werden, sind den Menschen durchaus bewusst. Zwar berichten die Medien ununterbrochen von Umweltkatastrophen wie Gletscherschmelzen, Waldbranden, Hitzewellen und Korallensterben, jedoch sind wir meist nicht unmittelbar betroffen. Vielen Menschen der Industrienationen ist ihre Verantwortung nicht bewusst, da ihr ummittelbares Naturverstandnis und das damit einhergehende Mitgefuhl verloren gegangen ist. Das Ziel der Waldpadagogik ist es, dieses Verstandnis und die Zusammenhange in der Natur erfahrbar zu machen, um die Beziehung zwischen Mensch und Natur wieder herzustellen.
Als praktische Umsetzung dieser Uberlegungen entstanden bereits Ende des 19. Jahrhunderts erste Wald- und Naturkindergarten in Danemark. Nach einigen privaten Initiativen, wurde im Jahr 1993 der erste Waldkindergarten in Flensburg gegrundet. Seit dem erganzen nun circa 1000 Natur- und Waldkindergarten die umweltpadagogisch-orientierten Bildungseinrichtungen in Deutschland (vgl. Jahn, 2019).
[...]