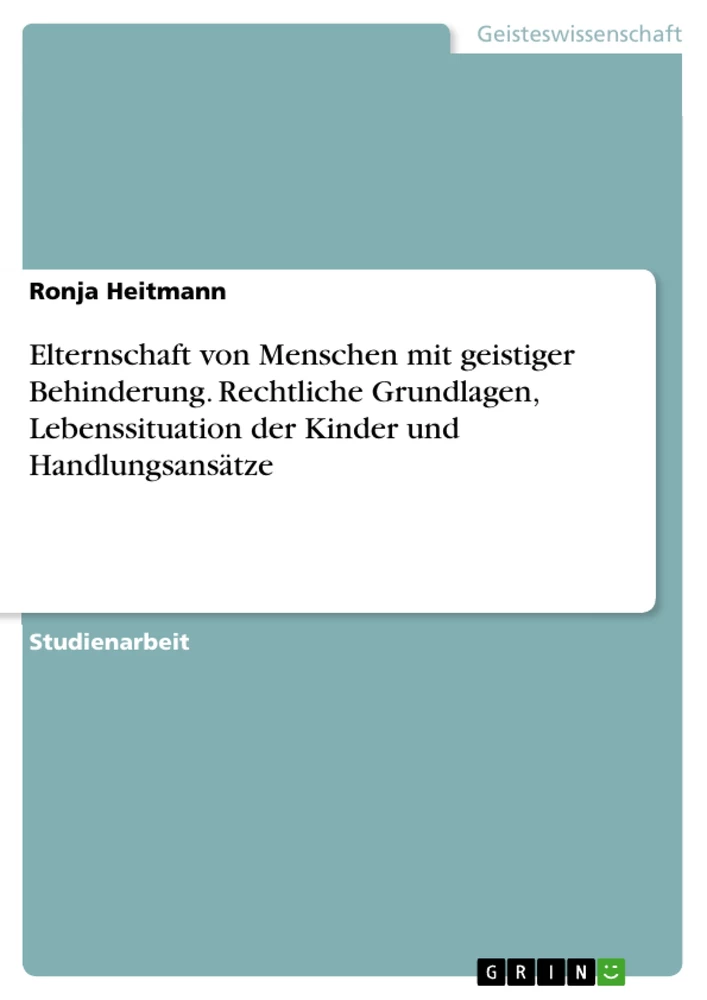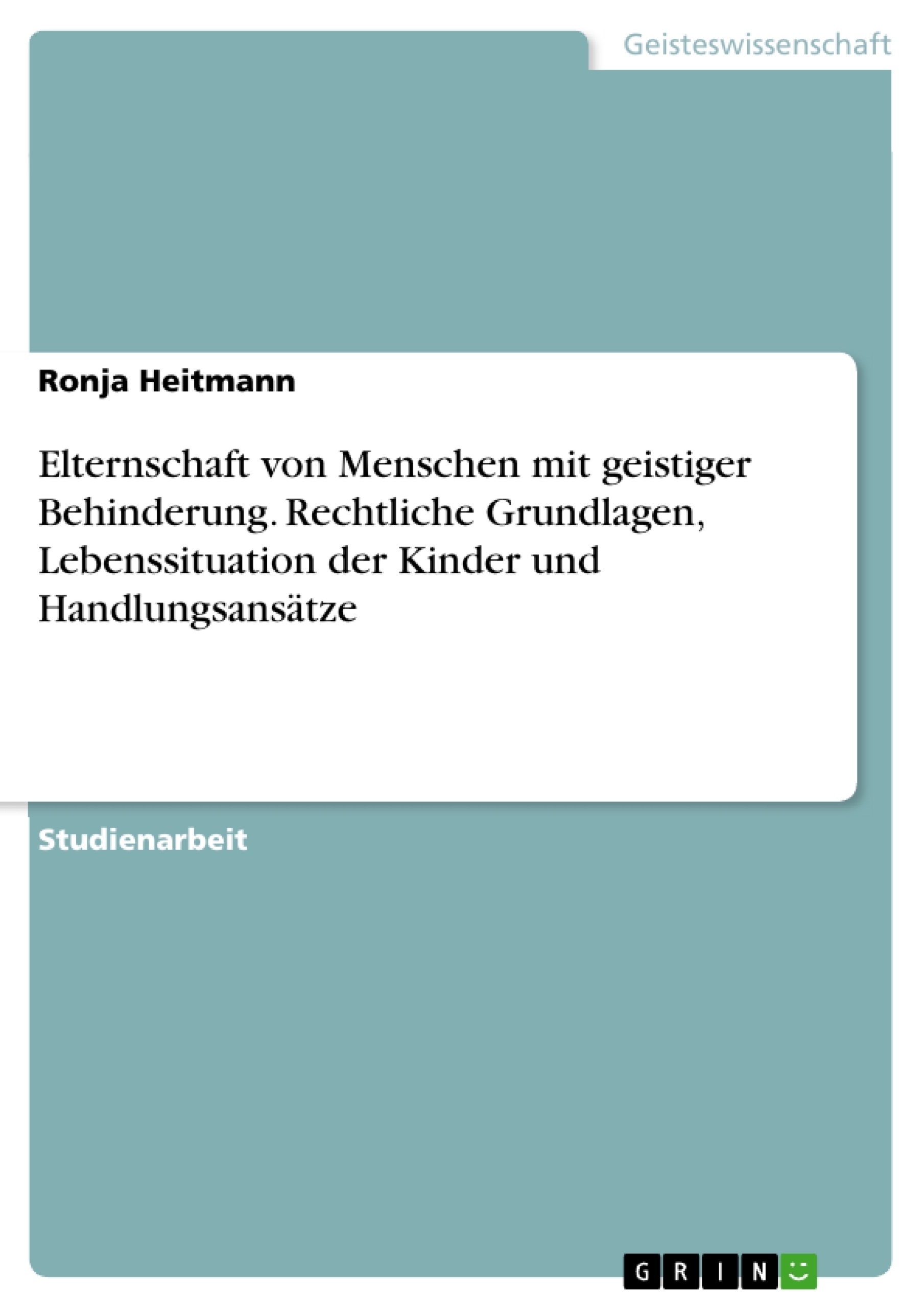Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob es ethisch vertretbar ist, Menschen mit Behinderung in ihrem Wunsch, eine Familie zu gründen, zu unterstützen. Die Hypothese lautet dabei: Menschen mit geistiger Behinderung benötigen umfassende Unterstützungsangebote, um eine gelungene Elternschaft zu ermöglichen, bei der das Kind bei der Mutter, dem Vater oder der Familie aufwachsen kann, ohne das Wohl des Kindes und der Eltern zu gefährden.
Die Hausarbeit beginnt mit der Definition des Begriffes ‚Geistige Behinderung‘ und geht weiter mit einer historischen Einordnung zur Thematik der Sterilisation von Menschen mit Behinderung. Anschließend werden die rechtlichen Grundlagen im Rahmen der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung dargestellt und der aktuelle Forschungsstand zu Kindern behinderter Eltern skizziert. Anschließend folgen mögliche Handlungsansätze für die Arbeit als Sozialarbeiter/-in.
Inhalt
1. Einleitung und Fragestellung
2. Definition der geistigen Behinderung
4. Rechtliche Grundlagen
4.1. UN-Behindertenkonvention
4.2. Grundgesetz
4.3. Kindeswohl
5. Die Lebenssituation von Kindern behinderter Eltern
5.1. Eigene Behinderung:
5.2. Trennung von den Eltern
5.3. Vernachlässigung:
5.4. (Sexuelle) Gewalterfahrung
5.5. Parentifizierung
5.6. Diskriminierung
5.7. Belastung durch das professionelle Hilfesystem
6. Handlungsansätze
6.1. Elternassistenz und begleitete Elternschaft
6.2. Alltagsorientiertes Konzept
6.3. Elterliche Sorge
6.3.1. Vollzeitpflege unter Beibehaltung des Sorgerechts
6.3.2. Entzug des Sorgerechts
6.4 Freigabe zur Adoption
7. Fazit
8. Literaturverzeichnis: