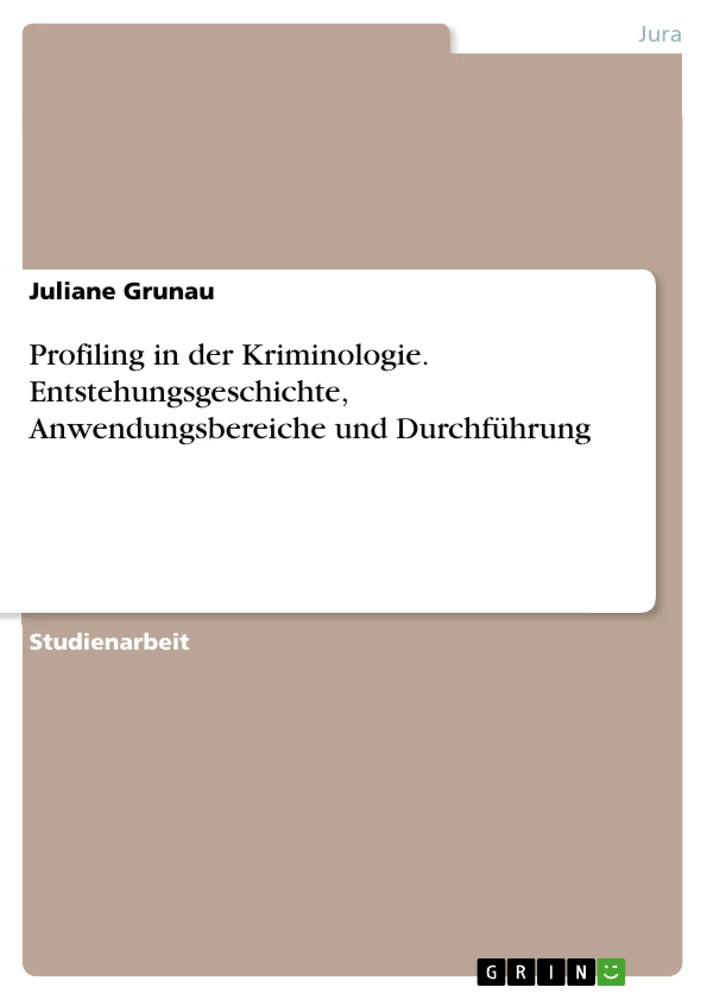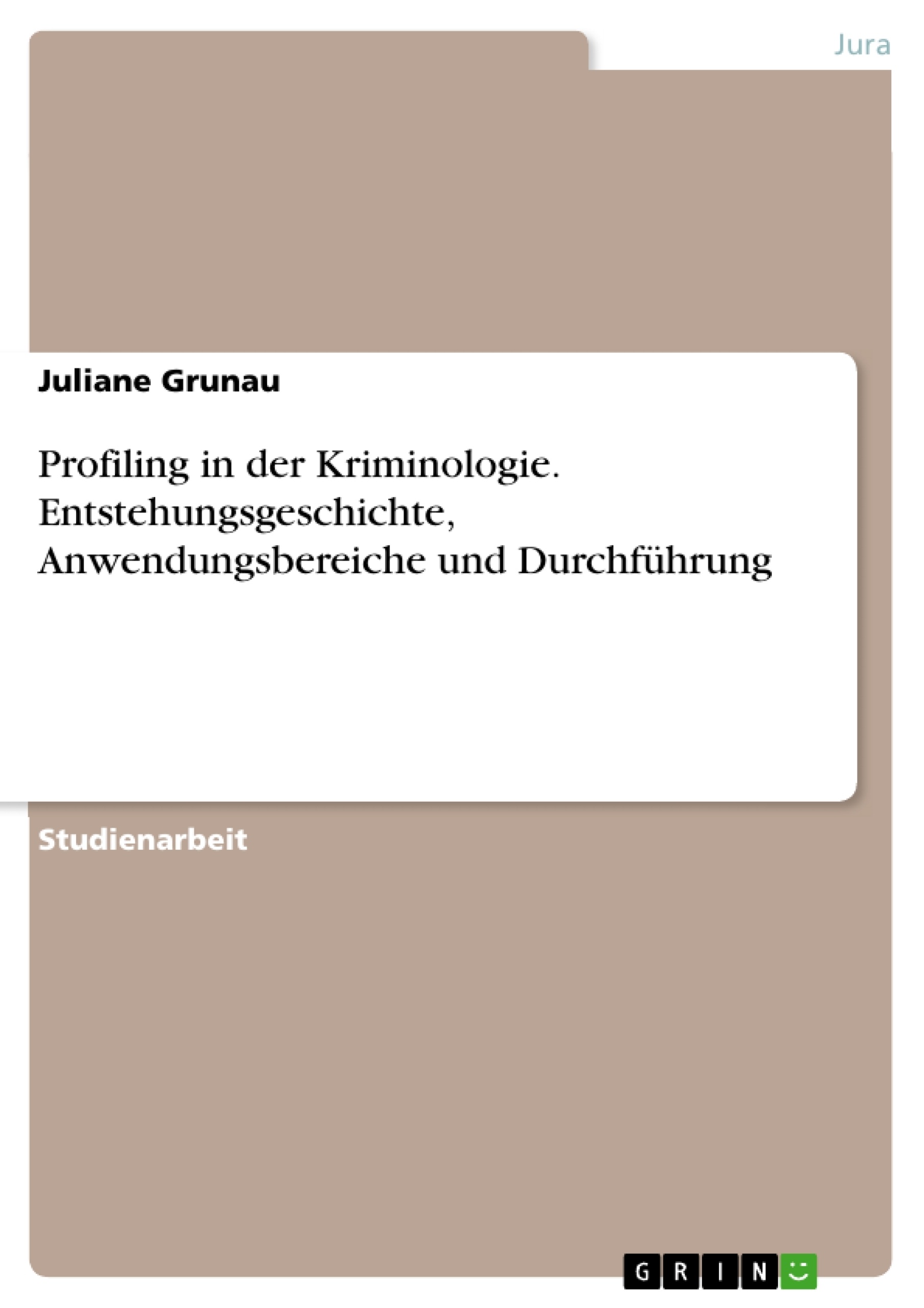In dieser Arbeit wird das Profiling als Methode der Kriminologie beleuchtet. Profiler rekonstruieren Tatabläufe der Fälle, bewerten das Verhalten des Täters und erstellen in den meisten Fällen ein Täterprofil. Wichtig dafür sind Persönlichkeitsmerkmale, Verhaltensauffälligkeiten und Lebensumstände eines unbekannten Täters. Sie fließen alle in die Analyse des Täterprofils ein.
Profiler werden in Ausnahmesituationen gerufen, wenn die Polizei vor schwierigen Entscheidungen steht und Unterstützung benötigt. Durch das kriminalistische Hintergrundwissen vergleichen Sie den Fall mit anderen ähnlichen Verbrechen, die bearbeitet wurden und erstellen Fallanalysen oder auch Täterprofile. Diese werden in Deutschland ausschließlich von speziell ausgebildeten Beamten der Einheiten für operative Fallanalyse erstellt.
Der Begriff „Profiling“ stammt aus den USA und wird dort als Täterprofilerstellung bezeichnet.
Der generelle Grundgedanke, liegt in der Annahme, dass durch aufgefundene Tatortspuren, die Vorgehensweise, die Wahl des Opfers, das sexuelle, psychische und verbale Verhalten die Persönlichkeitsmerkmale des Täters reflektieren.
Inhalt
1.Einleitung
2. Definition der Begriffe „Fallanalyse“ und „Täterprofil“
3. Entstehungsgeschichte
4. Wie funktioniert die Fallanalyse?
5.Täterprofil
6. Anwendungsbereiche im Profiling
7. ViCLAS
8. Zusammenfassung
9. Literaturverzeichnis