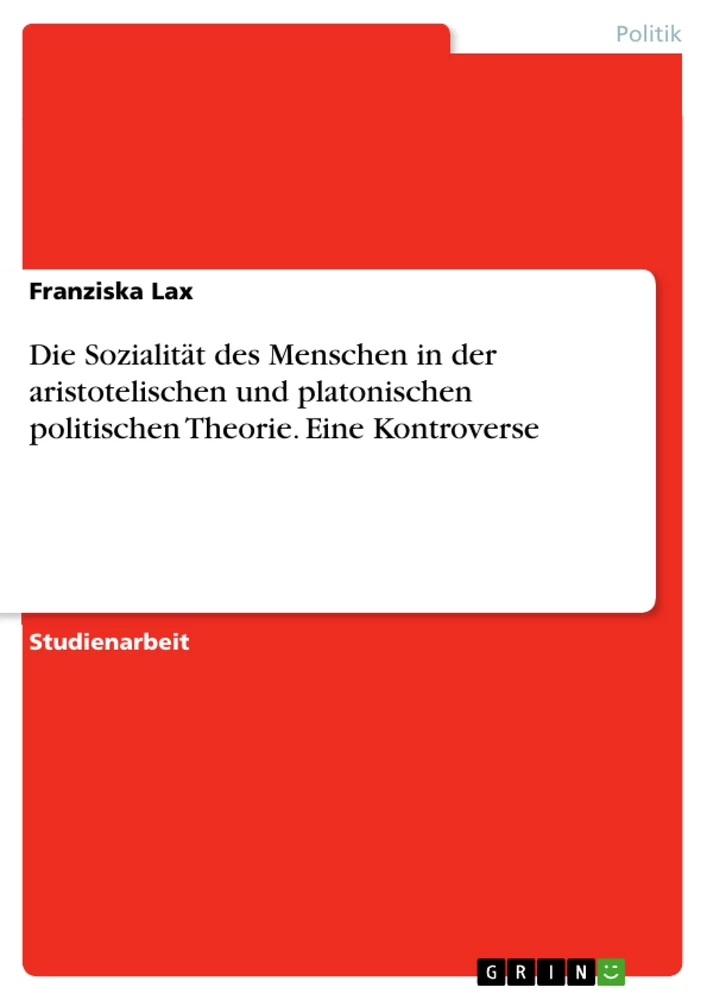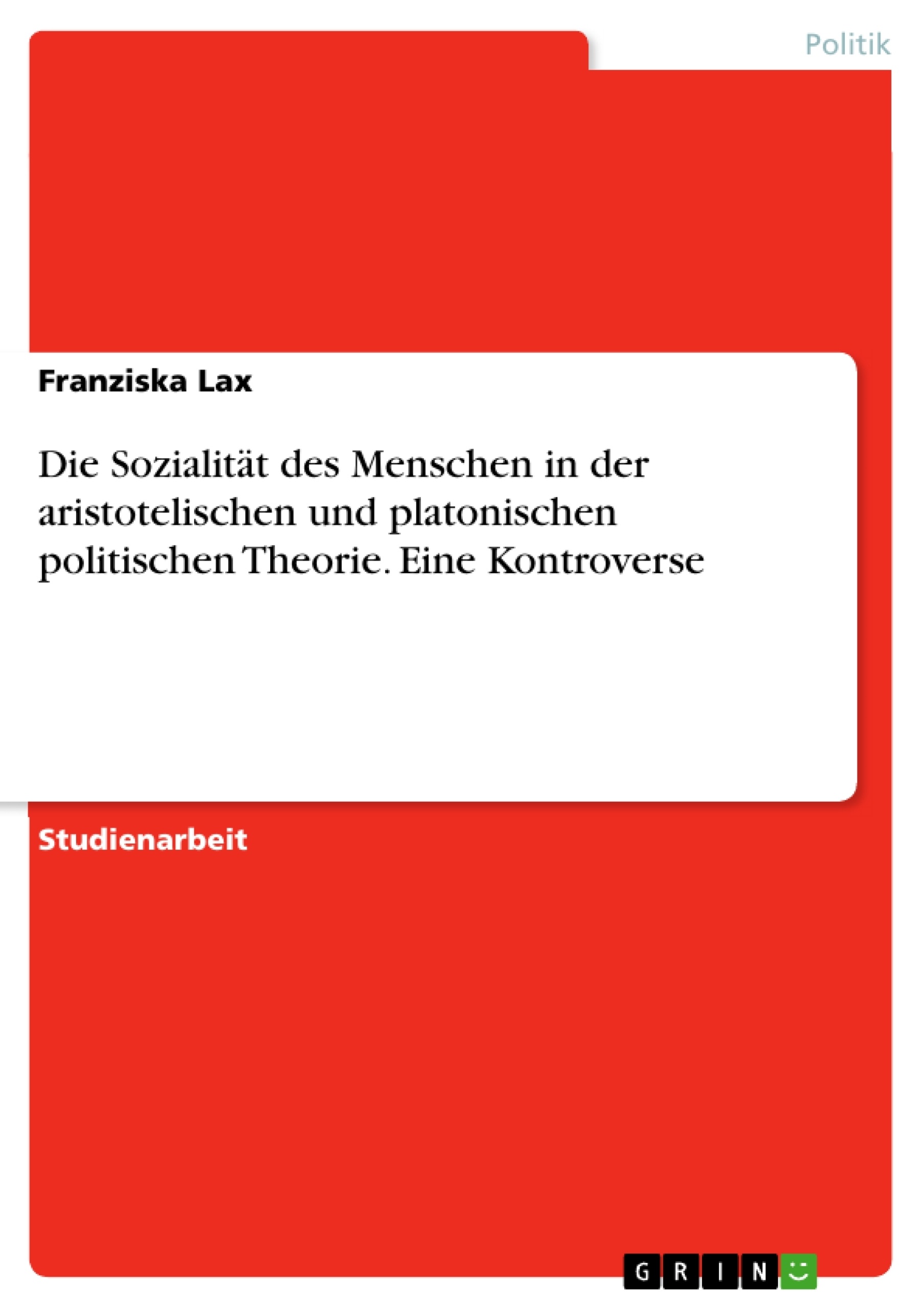In der vorliegenden Arbeit soll auf den Unterschied zwischen Platon und Aristoteles, mit dem Fokus auf der Auffassung der Sozialität des Menschen, Bezug genommen werden. Zu Beginn wird in groben Zügen das Leben und das Werk Platons chronologisch dargestellt. Daran anschließend soll die platonische Auffassung der Sozialität des Menschen betrachtet werden.
Raffaels berühmtes Wandgemälde "Causarum - Cognito" im Vatikan, was übersetzt "Die Erkenntnis der Ursachen" bedeutet, bekam den populären Namen "Die Schule von Athen" erst zu einem späteren Zeitpunkt zugewiesen. Platon und Aristoteles stehen dabei im Zentrum des Gemäldes. In Raffaels Gemälde ist zu erkennen, dass Platon, mit dem Finger nach oben zeigend, als Philosoph der Ideen und Aristoteles, mit der Hand in die Mitte weisend, als Philosoph der Verbindung zwischen Erd- und Ideenreich zu verstehen ist. Somit lässt sich bei der Deutung der Abbildung beider Philosophen bereits ein grundsätzlicher Unterschied in ihrer philosophischen Herangehensweise erkennen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Platon
2.1 Leben und Werk
2.2 Die platonische Auffassung der Sozialität des Menschen
3. Aristoteles
3.1 Leben und Werk
3.2 Die aristotelische Auffassung der Sozialität des Menschen
4. Fazit: Gegenüberstellung von Platon und Aristoteles bezüglich der Sozialität der Menschen
5. Literaturverzeichnis