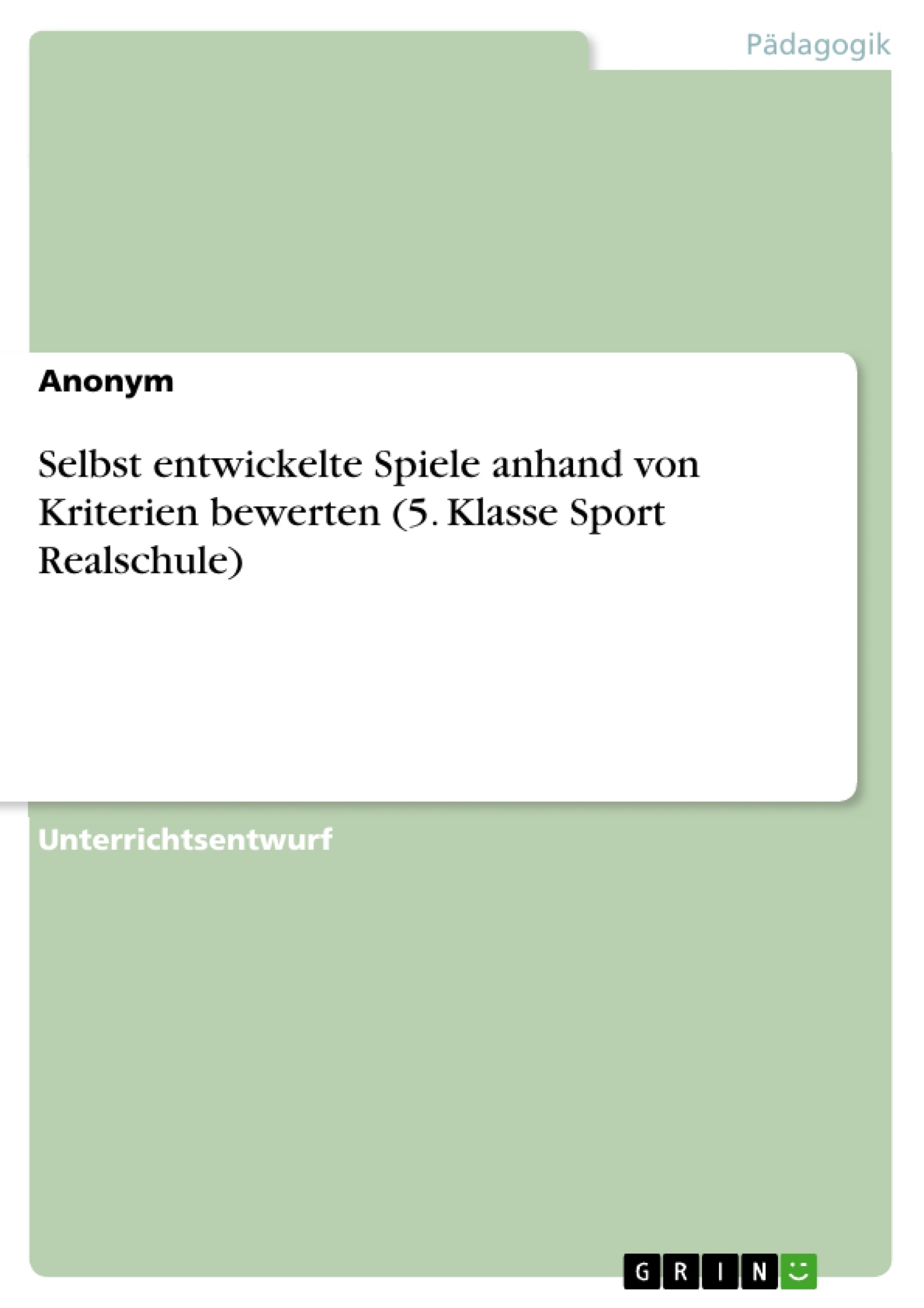Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um einen Unterrichtsentwurf für die 5. Klasse einer Realschule in Nordrhein-Westfalen.
Die Schüler und Schülerinnen können nach der Unterrichtsstunde ein selbst entwickeltes Spiel anhand von Kriterien bewerten und verbessern, indem sie es erproben und alternative Spielmöglichkeiten finden.
Inhaltsverzeichnis
Teil I. – Längerfristige Unterrichtszusammenhänge
1. Thema des Unterrichtsvorhabens
2. Ziele des Unterrichtsvorhabens/ fachspezifische Kompetenzen
3. Aufbau des Unterrichtsvorhabens
4. Zentrale unterrichtsrelevante Bedingungen und Entscheidungen
Teil II. – Planung des Unterrichts
5. Thema der Unterrichtsstunde
6. Schwerpunktziel der Unterrichtsstunde
7. Geplanter Unterrichtsverlauf
8. Zentrale unterrichtsrelevante Bedingungen und Entscheidungen bezogen auf die Lerngruppe
9. Quellenangaben
10. Anhang