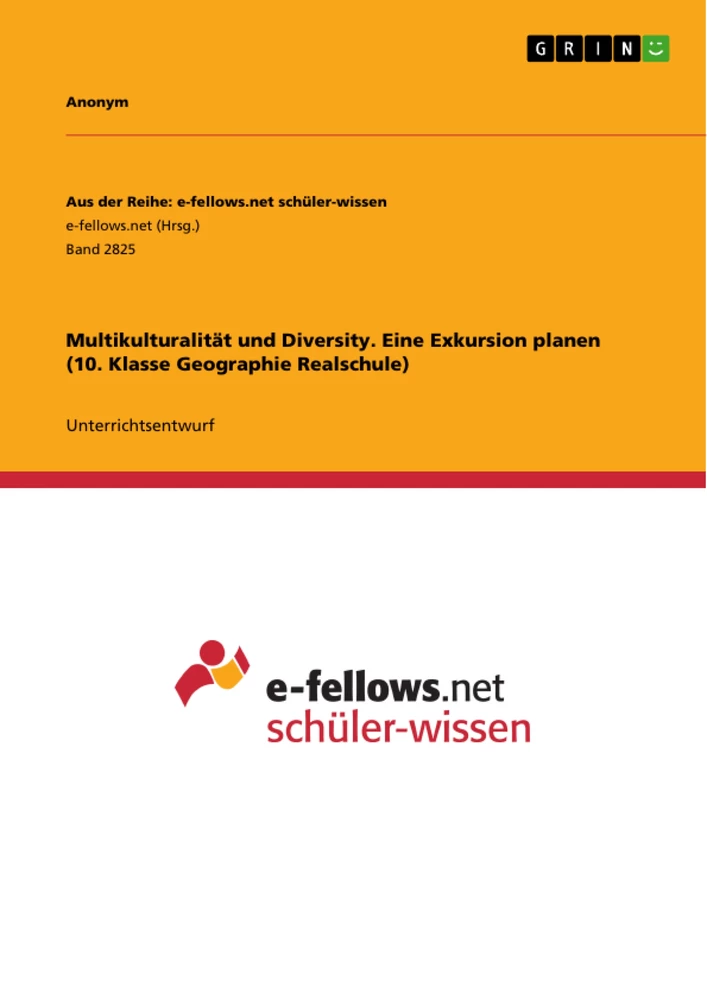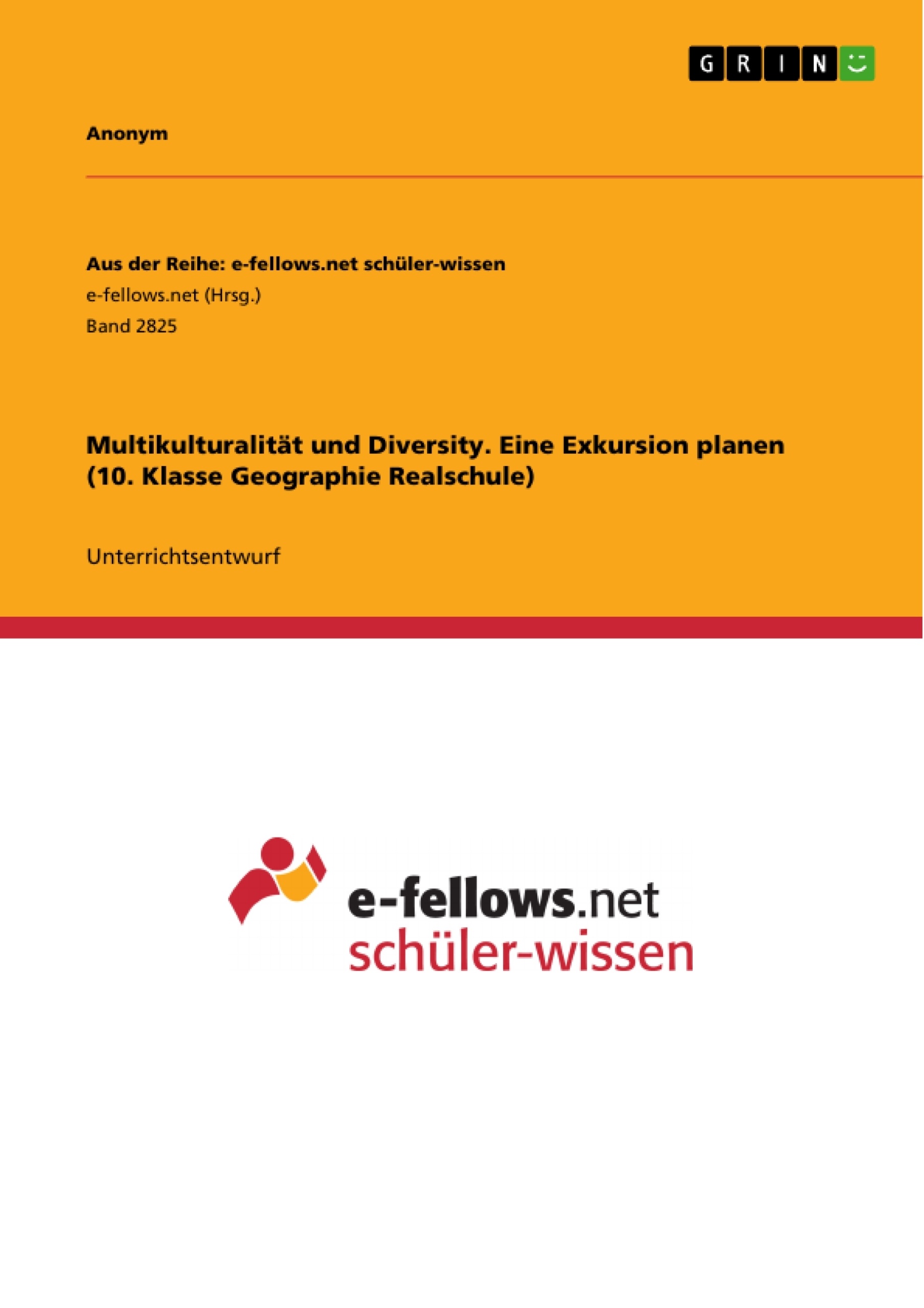In der Arbeit wird die Autorin zunächst das Haus auf der Mauer vorstellen und anschließend erläutern, warum ich diesen Ort in Jena gewählt habe und was der motivierende Lernanlass dabei für die SuS ist. Es schließt sich eine Sachanalyse und didaktische Analyse an, bei welcher die bildungstheoretische Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung und die Legitimation durch den Lehrplan genauer betrachtet werden. Des Weiteren wird der Ablauf der Exkursion mit Frage- und Aufgabenstellungen der Lehrkraft in den
einzelnen Phasen vorgestellt. Im letzten Kapitel der Arbeit wird der didaktische Verlaufsplan mit allen Entscheidungen begründet. Zum Abschluss werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst. Alle verwendeten Materialien der Exkursion mit
Aufgabenstellungen für die SuS und Musterlösungen der Lehrkraft befinden sich im Anhang, ebenso wie alle Abbildungen und Fotos.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Vorstellen des Phänomens
3 Darstellung des Fragwürdigen
4 Sachanalyse
5 Didaktische Analyse
5.1 Bildungstheoretische Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung und Vermittlungsinteresse
5.2 Didaktische Reduktion und Legitimation durch den Lehrplan
5.3 Problemorientierung und Lernziele
6 Didaktisierung
7 Reflexion zentraler didaktischer Entscheidungen
8 Zusammenfassung
Anhang
Literatur