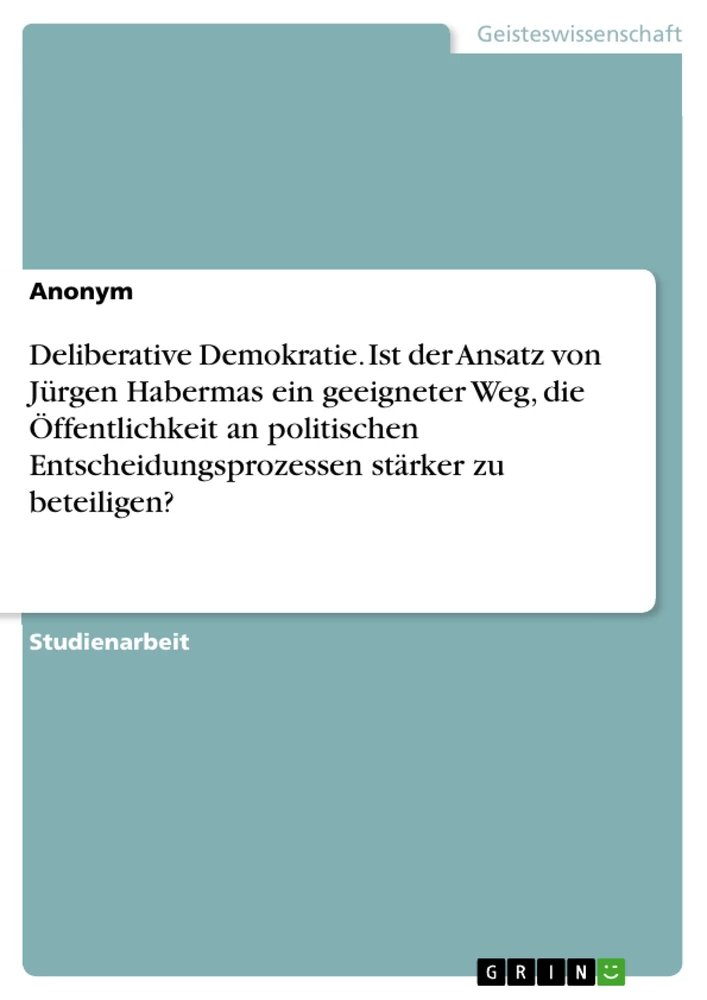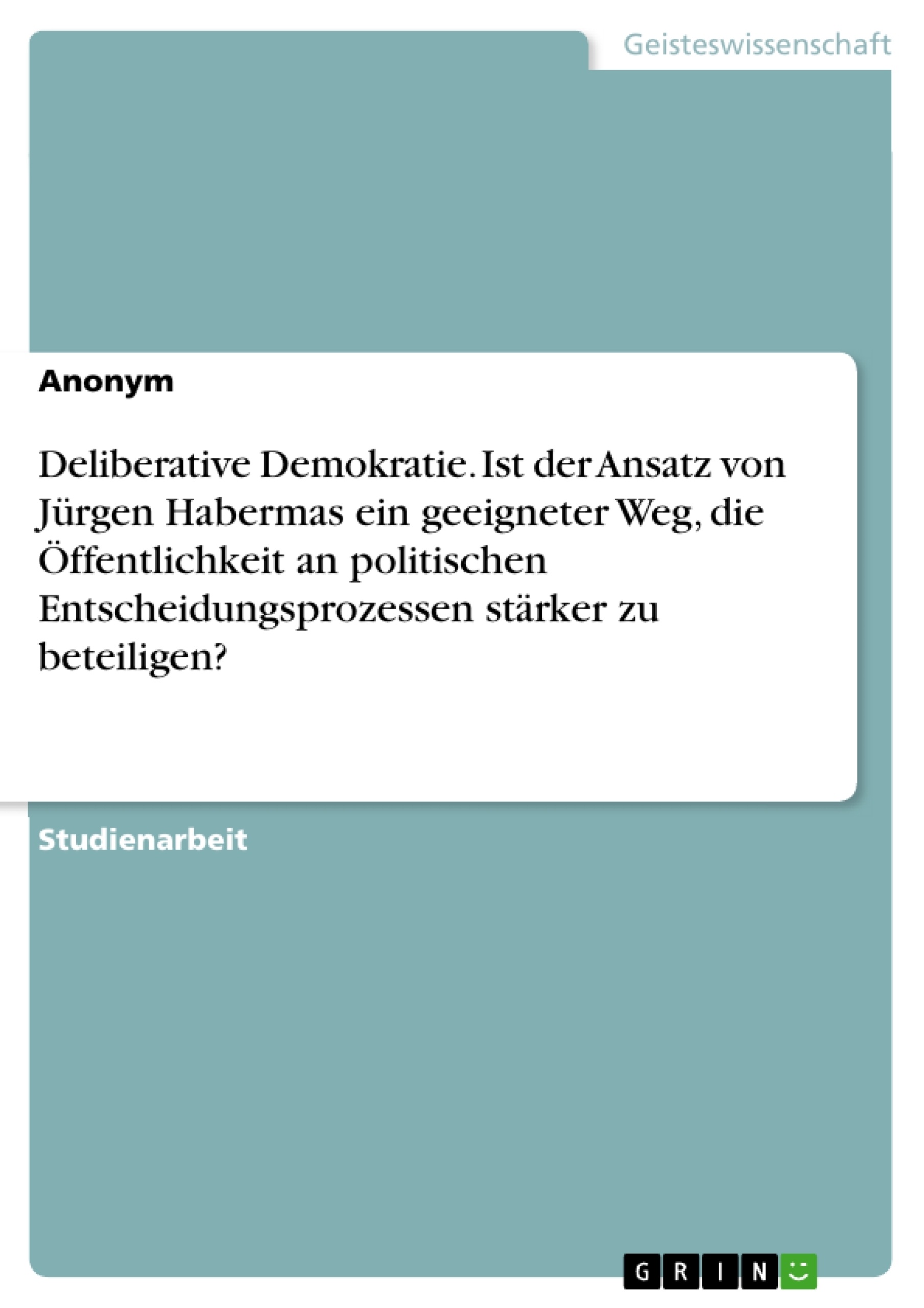Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung „stellt der deliberative Ansatz von Jürgen Habermas einen geeigneten Weg dar, die Öffentlichkeit an politischen Entscheidungsprozessen stärker zu partizipieren?“ Um diese fundiert zu beantworten, wird im ersten Kapitel der Arbeit die Basis, nämlich die deliberative Demokratietheorie untersucht. Inhaltlich wird ein kurzer Abriss folgen, der die normative und empirische Theorie gegenüberstellt und sich am Ende auf den deliberativen Ansatz nach Habermas anwendet.
Im nachfolgenden Teil wird der theoretische Ansatz nach Habermas unter den Gesichtspunkten der Diskurstheorie und der Öffentlichkeit unter der Anwendung des Zentrum-Peripherie-Modells analysiert und ein Vergleich zur gegenwärtigen Praxis hergestellt. Des weiteren wird unter dem Aspekt der Diskurstheorie auf die ideale Sprechsituation eingegangen. Anhand dieser orientieren sich die nach Habermas konzipierten Sprechakten und der daraus resultierende Sprechmodus, der unterschiedliche Geltungsansprüche einnimmt. Unter dem vierten Kapitel wird der zivilgesellschaftliche Raum der Öffentlichkeit dargestellt. Dabei untergliedert sich das Kapitel in die der allgemeinen Zugänglichkeit, welche eine zentrale Rolle bei Habermas beansprucht und an der Legitimation politischer Entscheidungen innerhalb der deliberativen Demokratie.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Deliberative Demokratietheorie
3. Theoretischer Ansatz nach Jürgen Habermas
3.1 Diskurstheorie
3.2 Öffentlichkeit und ihre Anwendung im Zentrum-Peripherie-Modell
4. Der zivilgesellschaftliche Raum der Öffentlichkeit
4.1 Die allgemeine Zugänglichkeit in der deliberativen Demokratie
4.2 Legitimation politischer Entscheidung in der deliberativen Demokratie
5. Bild von Habermas zu digitalen Umsetzungsmöglichkeiten deliberativer Elemente in der Politik
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis