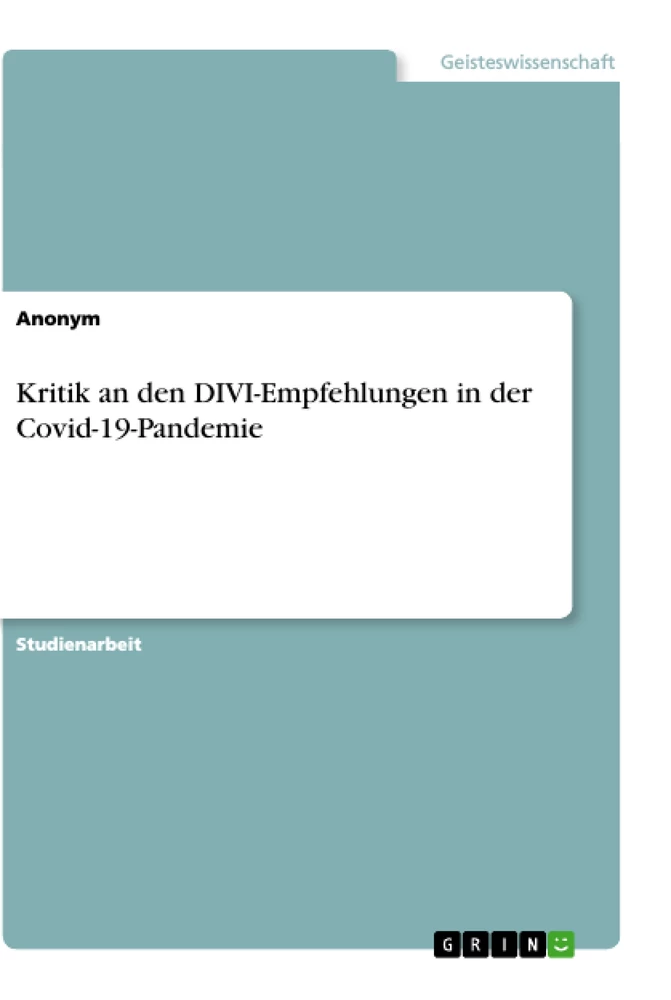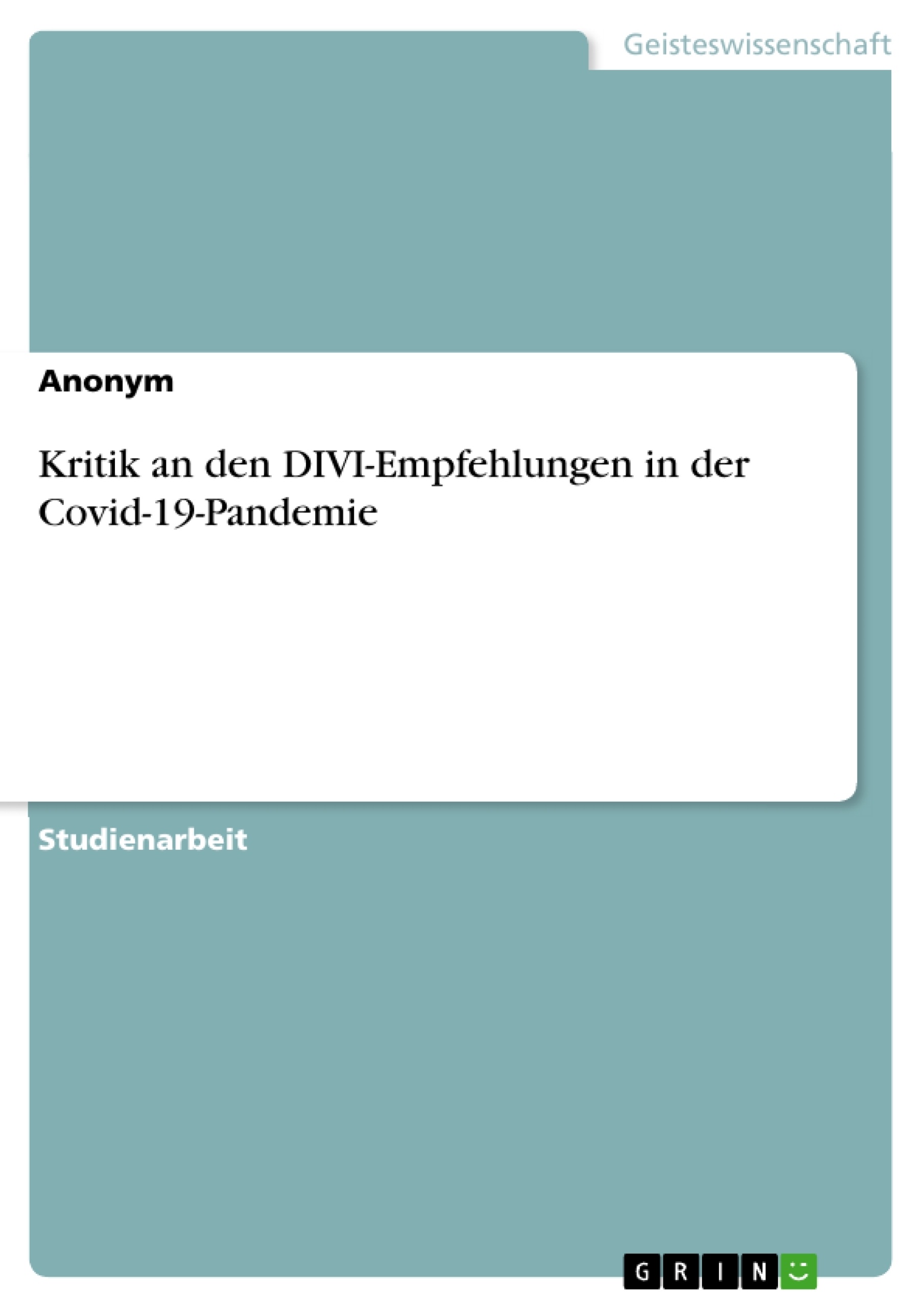Die Covid-19-Pandemie war das größte Thema im Jahr 2020 und wird die Bevölkerung mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch eine Weile beschäftigen. Nicht nur die von der Regierung erlassenen Beschränkungen gaben und geben immer wieder Anlass zur Diskussion, sondern auch ein weiteres Problem, das in Deutschland in diesem Ausmaß
nie präsent war: Die Triage – im schlimmsten Fall eine Entscheidung darüber, wer leben darf und wer sterben muss. Um die Ärzte, die in Triage-Situationen entscheiden müssen, zu entlasten, publizierte die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI, zu Beginn der Pandemie ein Dokument mit klinisch-ethischen Empfehlungen für die Entscheidung über die Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen.
In dieser Hausarbeit sollen die Empfehlungen der DIVI aus deontologischer und konsequentialistischer Sicht betrachtet und kritisiert werden. Dabei steht vor allem die Frage im Vordergrund, ob es nachvollziehbare Kritikpunkte an den DIVI-Empfehlungen gibt und wie diese aus deontologischer und konsequentialistischer Sichtweise begründet werden.
Zunächst wird das Dokument der DIVI in groben Zügen vorgestellt, um die Verfahren und Kriterien der Priorisierungsentscheidungen nachvollziehen zu können und um eine Grundlage zu schaffen. Im Anschluss werden dann kurz die Grundzüge der Deontologie und des Konsequentialismus dargestellt, um die Inhalte der beiden Richtungen
unterscheiden zu können. Darauffolgend sollen die verschiedenen Kritikpunkte behandelt werden, die an den DIVI-Empfehlungen geäußert werden könnten. Dazu gehört die Annahme, auf der das Dokument beruht, die Gleichheit, die durch die Empfehlungen untergraben wird, die additive Rechenweise des Leids und das Hauptkriterium in den DIVI-Empfehlungen, die klinische Erfolgsaussicht. Abschließend soll ein Fazit gezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Triage-Empfehlungen der DIVI
3. Konsequentialismus und Deontologie
4. Kritik an den DIVI-Empfehlungen
4.1 Die Voraussetzung der Zustimmung
4.2 Die Untergrabung der Gleichheit
4.3 Die Addition des Leids
4.4 Das Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die Covid-19-Pandemie war das größte Thema im Jahr 2020 und wird die Bevölkerung mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch eine Weile beschäftigen. Nicht nur die von der Regierung erlassenen Beschränkungen gaben und geben immer wieder Anlass zur Diskussion, sondern auch ein weiteres Problem, das in Deutschland in diesem Ausmaß nie präsent war: Die Triage - im schlimmsten Fall eine Entscheidung darüber, wer leben darf und wer sterben muss. Um die Ärzte, die in Triage-Situationen entscheiden müssen, zu entlasten, publizierte die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI, zu Beginn der Pandemie ein Dokument mit klinisch-ethischen Empfehlungen für die Entscheidung über die Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen. „Sie sollen den für die Entscheidungen verantwortlichen Akteuren durch medizinisch und ethisch begründete Kriterien und Verfahrensweisen eine Entscheidungsunterstützung bieten“1, so heißt auch in einem einleitenden Text des DIVI-Dokuments zu den Hintergründen der Erstellung.
In dieser Hausarbeit sollen die Empfehlungen der DIVI aus deontologischer und kon- sequentialistischer Sicht betrachtet und kritisiert werden. Dabei steht vor allem die Frage im Vordergrund, ob es nachvollziehbare Kritikpunkte an den DIVI-Empfehlun- gen gibt und wie diese aus deontologischer und konsequentialistischer Sichtweise begründet werden.
Zunächst wird das Dokument der DIVI in groben Zügen vorgestellt, um die Verfahren und Kriterien der Priorisierungsentscheidungen nachvollziehen zu können und um eine Grundlage zu schaffen. Im Anschluss werden dann kurz die Grundzüge der Deo- ntologie und des Konsequentialismus dargestellt, um die Inhalte der beiden Richtungen unterscheiden zu können. Darauffolgend sollen die verschiedenen Kritikpunkte behandelt werden, die an den DIVI-Empfehlungen geäußert werden könnten. Dazu gehört die Annahme, auf der das Dokument beruht, die Gleichheit, die durch die Empfehlungen untergraben wird, die additive Rechenweise des Leids und das Hauptkriterium in den DIVI-Empfehlungen, die klinische Erfolgsaussicht. Abschließend soll ein Fazit gezogen werden.
2. Die Triage-Empfehlungen der DIVI
Das Dokument der DIVI ist in mehrere Abschnitte unterteilt. Im ersten großen Teil geht es um die allgemeinen Grundsätze, die bei der Entscheidungsfindung eine Rolle spielen müssen. Hier stehen zwei Grundsätze im Vordergrund: Die individuelle patientenzentrierte Entscheidungsgrundlage und die zusätzlichen Entscheidungsgrundlagen bei Ressourcenknappheit.
Bei der individuellen patientenzentrierten Entscheidungsgrundlage geht es darum, dass eine Intensivtherapie nicht indiziert wird, wenn „der Sterbeprozess unaufhaltsam begonnen hat, die Therapie als medizinisch aussichtslos eingeschätzt wird [...] oder ein Überleben an den dauerhaften Aufenthalt auf der Intensivstation gebunden wäre.“2 Aber auch Patienten, die eine Intensivtherapie mündlich oder schriftlich ablehnen, werden nicht intensivmedizinisch behandelt.3 Diese Kriterien gelten immer, auch ohne Covid-19-Pandemie und ohne Ressourcenknappheit.
Die zusätzlichen Entscheidungsgrundlagen beziehen sich spezifisch auf die Situation der Ressourcenknappheit. Hat eine Klinik nicht mehr genügend Ressourcen, muss zunächst geprüft werden, ob irgendeine alternative Ressource vorhanden ist, wie z.B. die vorübergehende Beatmung in der Notaufnahme, bis der Patient verlegt werden kann, oder die direkte Aufnahme in einer anderen Klinik.4 Ist dies nicht der Fall, kommt es zur Triage-Situation, in der Patienten priorisiert werden müssen.
Die Priorisierungen erfolgen dabei ausdrücklich nicht in der Absicht, Menschen oder Menschenleben zu bewerten, sondern mit der Zielsetzung, mit den (begrenzten) Ressourcen möglichst vielen Patienten eine Teilhabe an der medizinischen Versorgung unter Krisenbedingungen zu ermöglichen.5
Dies wird in den DIVI-Empfehlungen stark betont. „Die Priorisierung von Patienten soll sich deshalb am Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht orientieren“6, heißt es weiter. Vorrangig sollen also vor allem diejenigen Patienten behandelt werden, bei denen die größte Überlebenswahrscheinlichkeit besteht, um die Todeszahlen so gering wie möglich zu halten. Wichtig für die Priorisierung der Patienten ist außerdem, dass alle Patienten in die Auswahl mit einbezogen werden, d.h. unabhängig davon auf welcher Station sie sich gerade befinden, ob sie Covid-19-Erkrankte sind oder nicht und unabhängig von Alter, sozialer Merkmale, Grunderkrankungen oder Behinderungen.7 Das oft diskutierte Kriterium des Alters wird somit also ausgeschlossen.
In den Empfehlungen der DIVI wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man das Leben der Menschen nicht gegeneinander abwägen möchte, sondern nur versucht, so viele Leben wie möglich zu retten.
Aus verfassungsrechtlichen Gründen dürfen Menschenleben nicht gegen Menschenleben abgewogen werden. Gleichzeitig müssen Behandlungsressourcen verantwortungsbewusst eingesetzt werden. Diese Empfehlungen beruhen auf den nach Einschätzung der Verfasser am ehesten begründbaren ethischen Grundsätzen in einer tragischen Entscheidungssituation: Sie sollen die Anzahl vermeidbarer Todesfälle durch die Ressourcenknappheit minimieren.8
Im anschließenden Abschnitt geht es näher um das Verfahren und die Kriterien für die Priorisierungsentscheidungen. Die Entscheidungen beinhalten sowohl solche, bei denen es um den Beginn einer intensivmedizinischen Maßnahme geht, als auch solche, bei denen es um die Beendigung dieser Maßnahmen geht.
Beim Verfahren der Entscheidungsfindung wird besonders das „Mehraugen-Prinzip“9 betont, was bedeutet, dass möglichst zwei Intensivmediziner, ein erfahrener Pfleger und weitere Fachvertreter gemeinsam entscheiden. Die Priorisierung muss anhand vieler Informationen getroffen werden. Dazu gehören unter zusätzlicher Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse zu Erfolgsaussichten bei Covid-19:
1. Informationen zum aktuellen klinischen Zustand des Patienten
2. Informationen zum Patientenwillen (aktuell/vorausverfügt/zuvor mündlich geäu- ßert/mutmaßlich)
3. anamnestische/klinische Erfassung von Komorbiditäten
4. anamnestische und klinische Erfassung des Allgemeinzustands (einschl. Gebrechlichkeit, z.B. mit der Clinical Frailty Scale)
5. Laborparameter zu 1. und 3., soweit verfügbar
6. Prognostisch relevante Scores (z.B. SOFA-Score)10
Das empfohlene Vorgehen lässt sich in vier Schritten zusammenfassen: Im ersten Schritt muss geklärt werden, ob der Patient eine intensivmedizinische Behandlung benötig. Ist dies der Fall wird eine Einschätzung der Erfolgsaussichten abgegeben, in der die Wahrscheinlichkeit geschätzt wird, dass der Patient die Erkrankung überlebt.11 Hierbei sind Vorerkrankungen kein Ausschlusskriterium, können aber relevant sein, wenn die Überlebenswahrscheinlichkeit dadurch negativ beeinflusst wird. Bestehen gute Chancen die Krankheit zu überleben, folgt Schritt 3, die Einwilligung des Patienten und nach dieser Einwilligung Schritt 4, die Priorisierung. Bei der Priorisierung sind dann die oben genannten Informationen von Punkt 1 – 6 relevant.12 Diese Kriterien gelten auch bei Entscheidungen im weiteren Krankheitsverlauf.13
[...]
1 DIVI - Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin: Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen in der Notfall- und Intensivmedizin im Kontext der Covid-19-Pandemie - Klinisch-ethische Empfehlungen. 2. Überarbeitete Fassung vom 17.04.2020. PowerPoint-Präsentation (divi.de) (31.01.2021). S. 3.
2 DIVI: Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen in der Notfall- und Intensivmedizin im Kontext der Covid-19-Pandemie. S. 3.
3 Vgl. ebd.
4 Vgl. ebd., S. 4.
5 Ebd.
6 Ebd.
7 Vgl. DIVI: Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen in der Notfall- und Intensivmedizin im Kontext der Covid-19-Pandemie. S. 4f.
8 Ebd., S. 5.
9 Ebd.
10 Ebd., S. 6.
11 Vgl. ebd.
12 Vgl. DIVI: Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen in der Notfall- und Intensivmedizin im Kontext der Covid-19-Pandemie. S. 7.
13 Vgl. ebd., S. 8f.