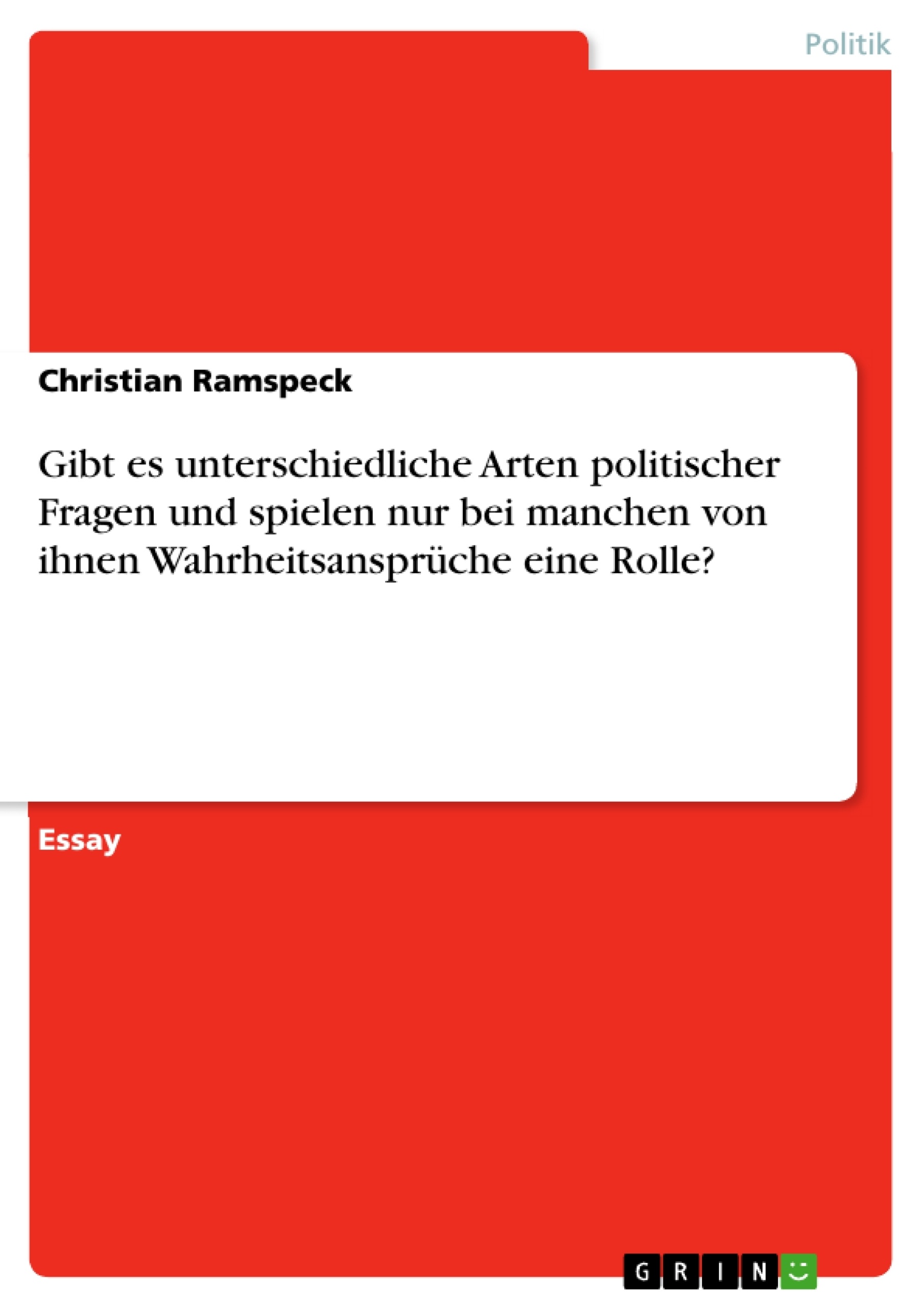In diesem Essay soll die Frage diskutiert werden, ob es unterschiedliche Arten von politischen Fragen gibt und ob nur bei manchen von ihnen Wahrheitsansprüche eine Rolle spielen sollten.
Dabei lautet meine These, dass Wahrheitsansprüche aus der Politik grundsätzlich herausgehalten werden müssen, da die Gefahr der Instrumentalisierung und moralisierenden Monopolisierung einer im Grunde nicht existierenden objektiven Wahrheit besteht. Stattdessen braucht eine vielfältige, pluralistische Gesellschaft und eine freiheitliche Ordnung einen normativen Grundkonsens über die Erkenntnis, dass es keine objektive Wahrheit geben kann. Darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit einer Existenz eines Wahrheitsanspruchs in politischen Fragen, die auf kommunaler Ebene zu diskutieren und zu entscheiden sind, wahrscheinlicher, auch da dort die Fähigkeit der Individuen zur Rationalität noch am ehesten ausgeprägt ist
Gibt es unterschiedliche Arten politischer Fragen und spielen nur bei manchen von ihnen Wahrheitsansprüche eine Rolle?
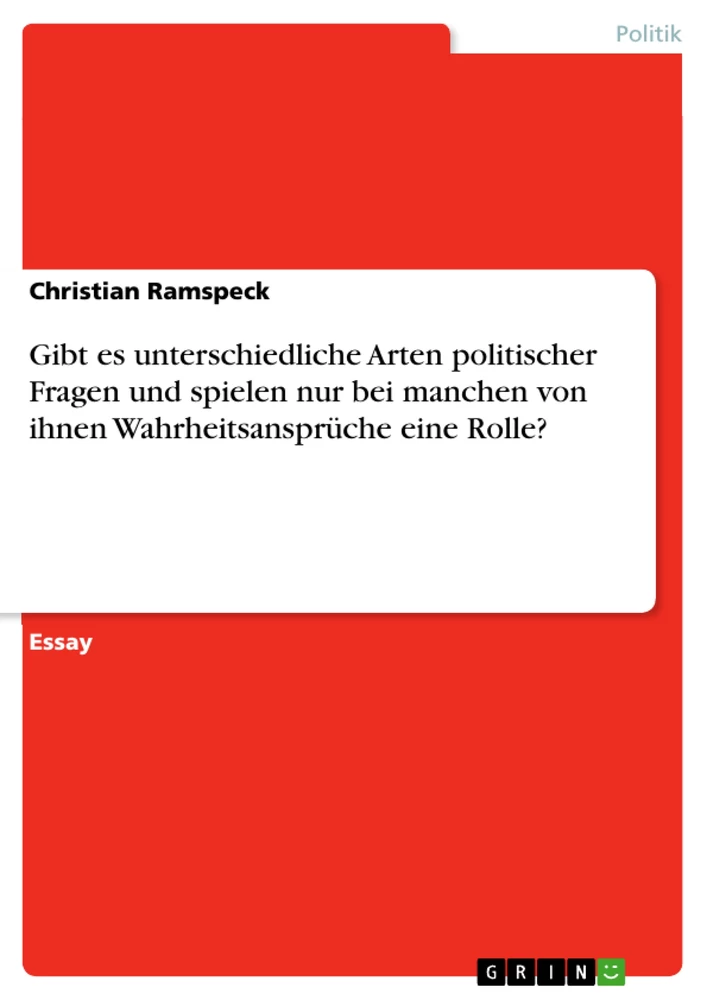
Essay , 2021 , 7 Seiten , Note: 2,0
Autor:in: Christian Ramspeck (Autor:in)
Politik - Grundlagen und Allgemeines
Leseprobe & Details Blick ins Buch