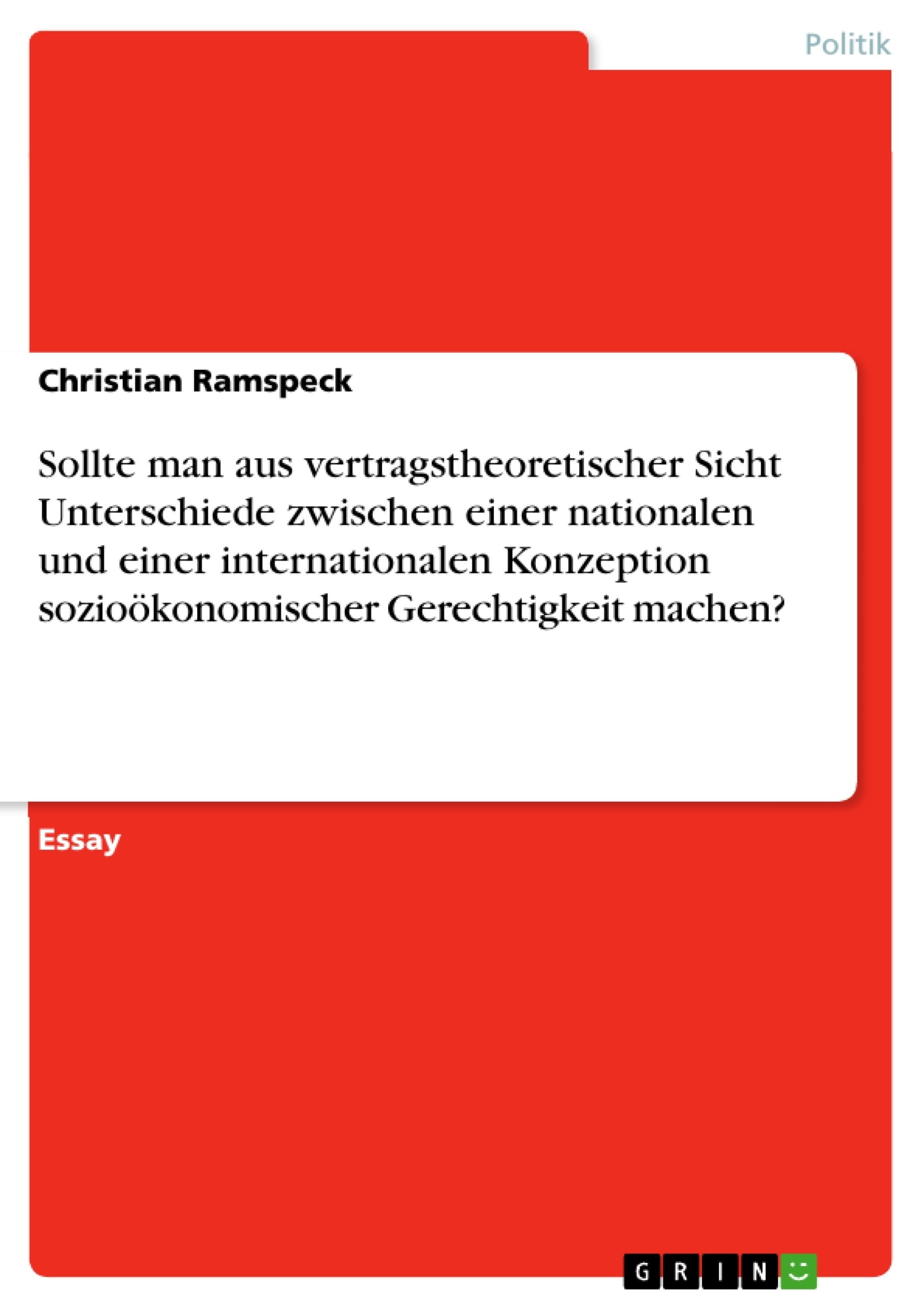In diesem Essay soll die Frage diskutiert werden, ob man aus vertragstheoretischer Sicht Unterschiede zwischen einer nationalen und einer internationalen Konzeption sozioökonomischer Gerechtigkeit machen sollte.
Hintergrund dieser Debatte sind zwei Kernfragen. Erstens: Leben wir in einer gerechten Welt, also gibt es überhaupt Handlungsbedarf? Zweitens: Wie soll das Problem der internationalen Ungerechtigkeit gelöst werden?
Bei der Beantwortung der ersten Frage herrscht unter Wissenschaftlern, Philosophen und Politikern ein weitgehender normativer Grundkonsens, wie von Nagel (2005: 113) zusammengefasst: „We do not live in a just world.“ Doch bei der zweiten Frage, welche Instrumente und Mittel es braucht, um Gerechtigkeit im sozioökonomischen Sinne herzustellen, gehen die Meinungen trotz gleichwertiger Zielauffassung auseinander.
Sollte man aus vertragstheoretischer Sicht Unterschiede zwischen einer nationalen und einer internationalen Konzeption sozioökonomischer Gerechtigkeit machen?
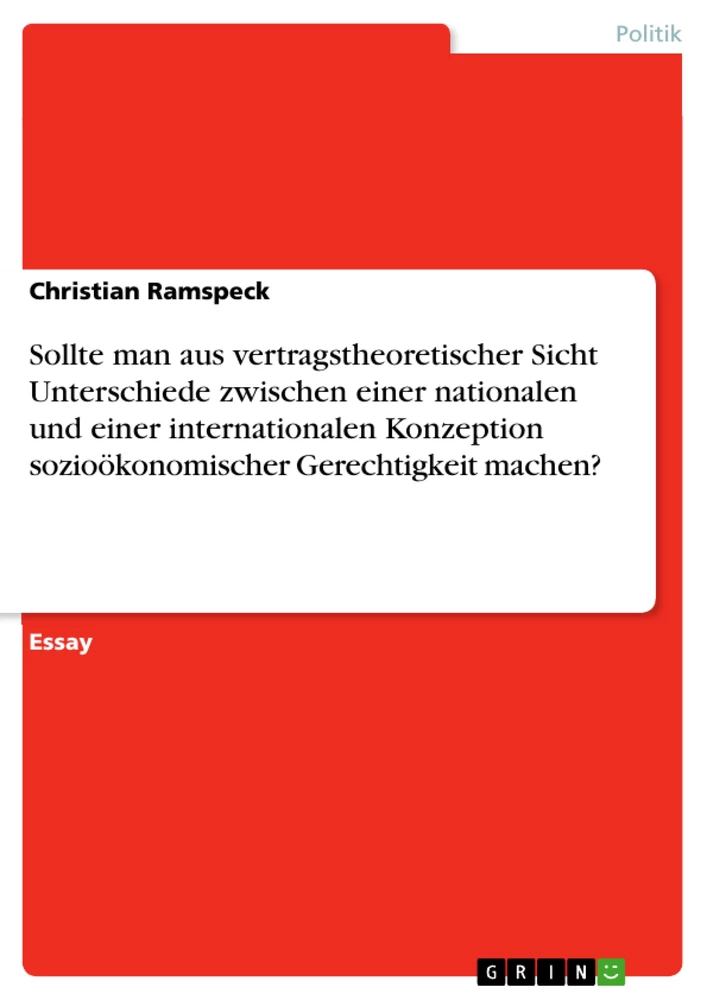
Essay , 2021 , 7 Seiten , Note: 1,3
Autor:in: Christian Ramspeck (Autor:in)
Politik - Allgemeines und Theorien zur Internationalen Politik
Leseprobe & Details Blick ins Buch