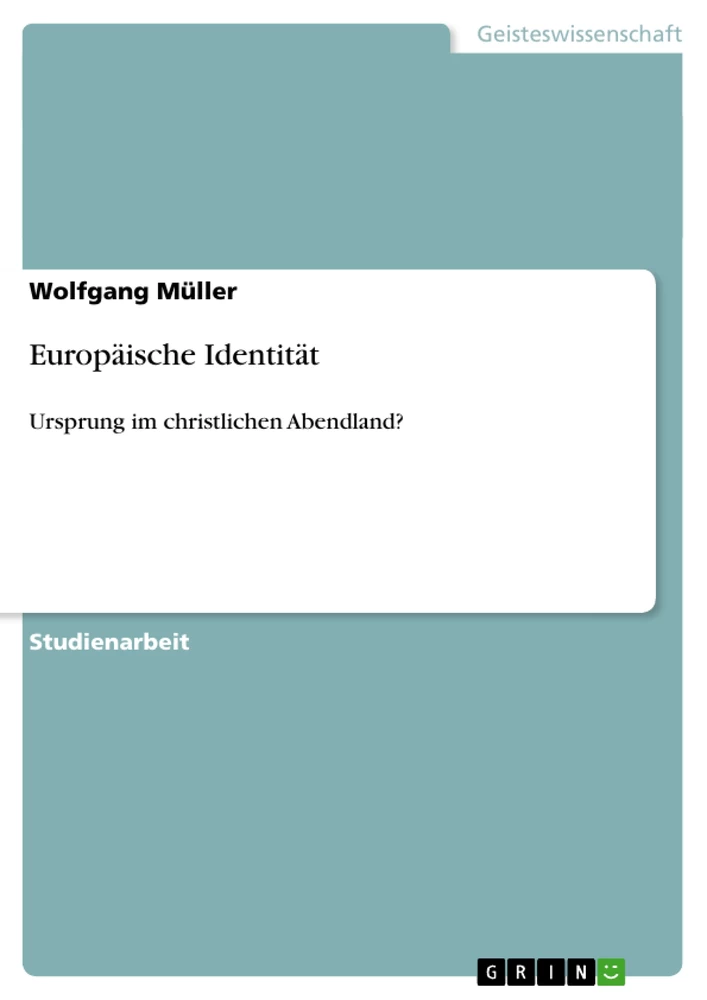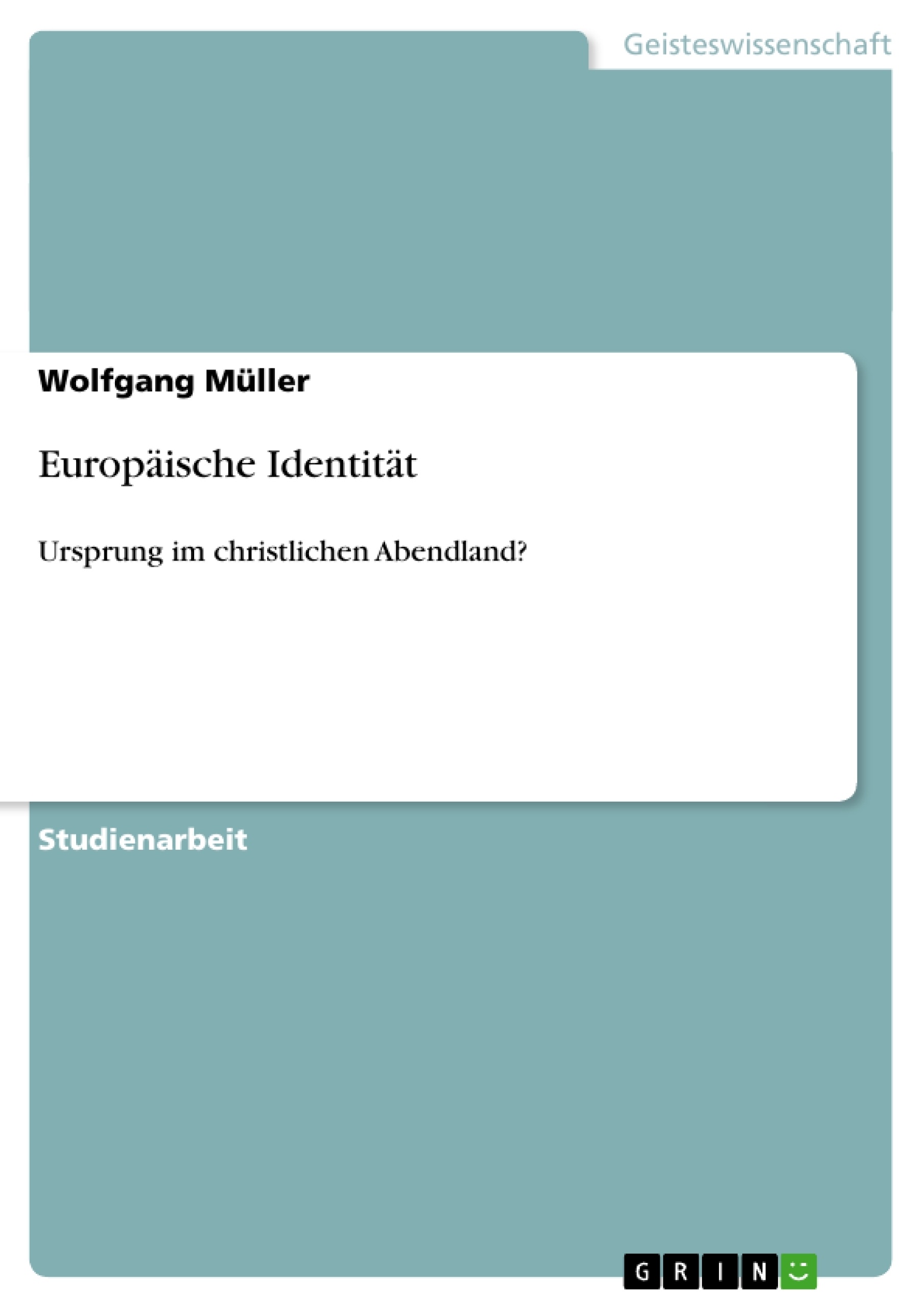Spätestens mit dem Beginn der Verhandlungen über die Aufnahme der Türkei in die Europäische Union ist die Diskussion über eine europäische Identität, verankert im christlichen Abendland, wieder in aller Munde. Wie weit eine derartige Verankerung tatsächlich für eine europäische Identitätsbildung entscheidend ist, ist die Fragestellung, welche in dieser Arbeit behandelt wird.
Dabei soll zuerst der theoretische Rahmen der kollektiven Identitätsbildung dargestellt werden, wobei der Fokus hauptsächlich auf Theorien gelegt wurde, welche sich zum einen generell mit kollektiver Identitätsbildung oder zum anderen mit einer von sich aus gewollten kollektiven Identitätsbildung beschäftigen, da die Mitglieder der Europäischen Union in ihrem Findungsprozess nicht eine Identität aufgezwungen bekommen, sondern dies aus freien Stücken beabsichtigen. Mittels dieser Erkenntnisse soll dann anschließend der dargestellte Inhalt eines Textes mit dem Titel “Die europäische Christenheit” von Heinrich Scharp aus seinem Buch “Europäische Epochen” kritisch in Bezug auf eine europäische Identitätsbildung diskutiert werden. Über Heinrich Scharp ist nicht viel in Erfahrung zu bringen, außer dass er in der Weimarer Republik Mitredakteur der Rhein-Mainische-Volkszeitung, einem katholischen, dem linken Flügel der Partei “Zentrum” nahem Blatt, war. Trotz der öffentlichen und wissenschaftlichen Unbekanntheit des Autors sowie dem Alter seines Textes, ist es möglich sich in einem angemessenen Umfang Erkenntnisse über den betrachteten Begriff “Abendland”, seine Grenzen, seine Herrschafts-, Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen sowie über die Kultur der damaligen Zeit, beginnend mit Karl dem Großen bis zum Ende des Spätmittelalters, zu verschaffen, wodurch sich die Wahl des Textes auch begründet.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Bildung kollektiver Identität und ihre Theorie
3. »Die europäische Christenheit«
4. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
»ES WAREN SCHÖNE, GLÄNZENDE ZEITEN, wo Europa ein christliches Land war, wo e i n e Christenheit diesen menschlich gestalteten Weltteil bewohnte; e i n großes gemeinschaftliches Interesse verband die entlegensten Provinzen dieses weiten geistlichen Reichs.
Ohne große weltliche Besitztümer lenkte und vereinigte e i n Oberhaupt die großen politischen Kräfte«.1
Mit diesen Worten beginnt der Dichter Novalis im Jahre 1799 seinen Aufsatz über die Christenheit und Europa, in welchem er Europa tief eingebettet in der Christenheit romantisch beschreibt. Spätestens mit dem Beginn der Verhandlungen über die Aufnahme der Türkei in die Europäische Union ist die Diskussion über eine europäische Identität, verankert im christlichen Abendland, wieder in aller Munde. Wie weit eine derartige Verankerung tatsächlich für eine europäische Identitätsbildung entscheidend ist, ist die Fragestellung, welche in dieser Arbeit behandelt wird.
Dabei soll zuerst der theoretische Rahmen der kollektiven Identitätsbildung dargestellt werden, wobei der Fokus hauptsächlich auf Theorien gelegt wurde, welche sich zum einen generell mit kollektiver Identitätsbildung oder zum anderen mit einer von sich aus gewollten kollektiven Identitätsbildung beschäftigen, da die Mitglieder der Europäischen Union in ihrem Findungsprozess nicht eine Identität aufgezwungen bekommen, sondern dies aus freien Stücken beabsichtigen. Mittels dieser Erkenntnisse soll dann anschließend der dargestellte Inhalt eines Textes mit dem Titel “Die europäische Christenheit” von Heinrich Scharp aus seinem Buch “Europäische Epochen” kritisch in Bezug auf eine europäische Identitätsbildung diskutiert werden. Über Heinrich Scharp ist nicht viel in Erfahrung zu bringen, außer dass er in der Weimarer Republik Mitredakteur der Rhein-Mainische-Volkszeitung, einem katholischen, dem linken Flügel der Partei “Zentrum” nahem Blatt, war.2 Trotz der öffentlichen und wissenschaftlichen Unbekanntheit des Autors sowie dem Alter seines Textes, ist es möglich sich in einem angemessenen Umfang Erkenntnisse über den be- trachteten Begriff “Abendland”, seine Grenzen, seine Herrschafts-, Wirtschaftsund Gesellschaftsstrukturen sowie über die Kultur der damaligen Zeit, beginnend mit Karl dem Großen bis zum Ende des Spätmittelalters, zu verschaffen, wodurch sich die Wahl des Textes auch begründet.
2. Bildung kollektiver Identität und ihre Theorie
Bei der Suche nach einer europäischen Identität, in welcher sich eine europäische Gesellschaft finden und darstellen kann, muss erst geklärt werden, was sich hinter dieser Vorstellung verbirgt. Hierbei ist nicht die Rede einer einzelnen, individuellen Identität, welche sich aus persönlicher und sozialer Identität bildet, sondern von der Summe vieler Identitäten, die sich in der Identität einer Gruppe oder eines Kollektivs spiegeln und sich in der Theorie der kollektiven Identität wiederfinden. Diese definiert sich nach dem Wörterbuch der Soziologie von Karl-Heinz Hillmann als eine
»soziale, kulturelle Identität, Wir-Identität, gefühlsgeladenes Empfinden oder Bewusstsein von Individuen, gemeinsam einer bestimmten kollektiven Einheit oder sozialen Lebensgemeinschaft […] anzugehören, die in unverwechselbarer Weise durch bestimmte Merkmale (spezifische Kultur, Sprache, Geschichte, ggf. auch Religion […]) gekennzeichnet ist und sich dadurch von anderen Kollektiven unterscheidet«.3 Des Weiteren wird dort angeführt, dass dabei für die Bildung einer kollektiven Identität, von den Individuen eines Kollektivs anerkannte und gemeinsame Werte, Normen, Symbole, Verhaltensweisen sowie unter anderem ein bestehendes Zusammengehörigkeitsgefühl von besonderer Bedeutung sind. Diese müssen zudem über Sozialisation und Enkulturation von den Individuen einer Generation an jene der nächsten übergeben werden, um den Fortbestand der kollektiven Identität zu sichern, wobei vorausgesetzt werden muss, dass die Folgegeneration auch die Bereitschaft für eine Übernahme in sich trägt. Ohne eine solche, welche zudem durch soziales Handeln reflektiert werden muss, würde die Weitergabe von Werten und Normen unterbrochen und die Reproduktion der kollektiven Identität verhindert werden.4 Dabei befinden sich soziales Handeln und die kollektive Identität in einem auf sich gegenseitig beziehenden Zusammenhang. Während, wie erwähnt, die kollektive Identität durch soziales Handeln bestätigt werden muss, um weiter bestehen zu können, bildet die kollektive Identität einen Orientierungsrahmen für die Interaktion und dem damit verbundenen sozialen Handeln der daran teilnehmenden Individuen.5
Zudem ist diese über die Sozialisation stattfindende Vermittlung von Werten, Normen und somit auch Sanktionen nicht als eine Entwicklung von kollektiven Identitäten, die eine starre oder fixe Übergabe der sie auszeichnenden Eigenschaften beschreibt, sondern ein dynamischer Prozess, der mit einer historischen Dimension ausgestattet ist. Dieser Prozess nimmt in Form von Traditionen Bezug auf vergangene, für das Kollektiv bedeutende Ereignisse und Eindrücke. Das heißt, dass sich kollektive Identitäten und die sie auszeichnenden Eigenschaften immer wieder von neuem beweisen müssen, um ihre Gültigkeit zu rechtfertigen. Gelingt ihnen das nicht, so verlieren sie an Bedeutung, und vielleicht sogar ihre Existenzberechtigung.6 In modernen Gesellschaften, wie sie in Europa zu finden sind, werden infolge höherer Bildung und erhöhter Individualisierung kollektiv geltende Werte und Normen weit
»kritischer reflektiert« als in traditionellen Gesellschaften. Dies hat zur Folge, dass kollektive Identitäten vielfältigere Gestalten annehmen, wodurch sich wiederum ihre Reproduzierbarkeit erschwert und das Zusammengehörigkeitsgefühl abschwächt.7
Aber nicht nur die Eigenwahrnehmung stellt für die Bildung einer kollektiven Identität eine entscheidende Rolle dar. So muss eine Identitätsbildung auch eine Fremdbetrachtung berücksichtigen. Eine Voraussetzung, die aus interaktionistischer Sicht ein Muss darstellt, da für Vertreter interaktionistischer Sozialisationstheorien Identitätsbildung nur über Interaktion stattfinden kann, und diese wiederum nur dann, wenn der Interaktionspartner die eingebrachte Identität auch akzeptiert und bestätigt. Somit ist die Identität ein Produkt der Identität, welche eigen ersinnt wird, und jener, die vom Interaktionspartner zugedacht wird.8 Dabei muss aber erwähnt werden, dass die zugedachte Identität erst dann an Gültigkeit gewinnt, wenn sie in der Identitätsbildung auch akzeptiert wird.9
Nachdem nun die kollektive Identitätsbildung und ihre aktive Reproduktion vorrangig in modernen Gesellschaften dargestellt wurde, soll nun im nächsten Kapitel das erworbene theoretische Wissen auf den in der Einführung angeführten und beschriebenen Text über die »Die europäische Christenheit« von Heinrich Scharp angewendet werden.
3. »Die europäische Christenheit«
Geografisch lässt sich die Lage Europas grob eingrenzen durch das Mittelmeer im Süden, den Atlantischen Ozean im Westen, das Europäische Nordmeer im Norden und den Ural, den Uralfluss sowie durch das Kaspische Meer im Osten.10 Trotz dieser scheinbar exakten Beschreibung ist damit noch nicht wirklich klar, wie dabei zum Beispiel mit all den Inseln im Atlantik oder im Europäischen Nordmeer verfahren wird. Welche Insel darf als europäisch betrachtet werden und welche nicht? Ist somit die geografische Eingrenzung bereits mit Schwierigkeiten verbunden, stellt sich die kulturelle und epochale Eingrenzung noch prekärer dar. Wo beginnt dieses christliche Abendland, welches das Kernstück der europäischen Kultur und Identität darstellen soll? Beginnt es bereits mit der Errichtung der ersten christlichen Gemeinden oder mit dem Aufstieg des Christentums zur Staatsreligion im Römischen Reich? Der Brockhaus beschreibt das Abendland als »den westund mitteleuropäischen Kulturkreis, der sich seit dem Mittelalter herausbildete«,11 wodurch dieser Begriff neben einer räumlichen Dimension auch eine zeitliche erhält. Heinrich Scharp lässt das christliche Abendland expliziter mit der Krönung des Frankenkönigs Karl des Großen und dem damit verbundenen Bündnis zwischen dem Frankenreich und der römischen Kirche beginnen.12
In den ersten Seiten seines Kapitels »Die europäische Christenheit« beschreibt Scharp die politische Situation Europas und der römischen Kirche zur Zeit Karl des Großen. Das Römische Reich war in eine weströmische – dem Okzident – und in eine oströmische Hälfte – dem Orient – zerfallen, wobei die in beiden Hälften stattgefundene Ausbreitung des Christentums später durch Eroberungen von Reichen des
Islams, wie zum Beispiel die ehemaligen Provinzen des Römischen Reiches in Nordafrika, Spanien und Sizilien, eingeschränkt oder zurückgedrängt wurde. Diese politische Trennung beider römischen Reichshälften führte auch zu einer Spaltung der Kirche. Während die Ostkirche ihr Zentrum im damaligen Konstantinopel und damit eine enge Verbindung zum Oströmischen beziehungsweise später zum Byzantinischen Reich hatte, welche sie vor Angriffen islamischer Nomaden und Reiche schützte, suchte die Kirche in Rom Schutz bei den im heutigen Frankreich aufstrebenden Franken. Dies hatte einen Bruch zwischen den beiden Kirchen zur Folge und eine Erneuerung des untergegangenen Weströmischen Reiches im Reich der Franken unter Karl dem Großen, der sich nicht nur als König der Franken oder als König des Weströmischen Reiches und somit als Nachfolger der römischen Cesaren betrachtete beziehungsweise von den Historienschreibern betrachtet wurde, sondern auch als Herrscher Europas. Die Geschichte des im Weströmischen Reich beschriebenen A- bendlandes wurde durch diese Folgerung als die Geschichte Europas verstanden.13
Europa, welches sich, wie zu Beginn dieses Kapitels beschrieben, vom Atlantik bis zum Ural, vom Nordkap bis zum Mittelmeer erstreckt, soll nun als ein Gebiet zwischen dem Atlantischen Ozean und der Elbe beziehungsweise zwischen den Pyrenä- en und der Straße von Dover erfasst werden?14 Die Werte, Normen, Symbole und Verhaltensweisen, welche zu jener Zeit in jenem Raum entstanden sind, sollen die Basis einer gegenwärtigen europäischen Identität darstellen?
Dabei stellt sich noch eine Frage zu der Vorgehensweise in der Analyse. Muss man bei der Betrachtung dieser historischen Prozesse Europa aus der uns gewonnenen Sichtweise betrachten oder aus jener Sichtweise, welche damals gegolten hat?
Für die Menschen des damaligen weströmischen Reiches waren die Regionen jenseits der Elbe und der Donau unbekanntes und unerschlossenes Gebiet.15 Ihre Vorstellungen und Kenntnisse über den Begriff “Europa” konnten somit nicht das tatsächliche Ausmaß erschließen und daher ist eine derartige Betrachtung des Weströ- mischen Reiches, dass es Europa darstellt, scheinbar gerechtfertigt.
[...]
1 Novalis: Die Christenheit oder Europa, S. 1, Hervorhebungen im Original enthalten.
2 Vgl. Ernst Pfeifer: Biographie. Friedrich Dessauer. http://www.fdg.ab.by.schule.de/index.php?main=2&sub_1=9&PHPSESSID=d8e98531fd6808979449 c813d6b3b35b, 06.04.2008.
3 Karl-Heinz Hillmann: Wörterbuch der Soziologie, S. 431.
4 Vgl. Ebd., S. 431ff.
5 Vgl. Carolin Em>Kollektive Identitäten, S. 205ff.
6 Vgl. Ebd., S. 220ff.
7 Vgl. Karl-Heinz Hillmann: Wörterbuch der Soziologie, S. 432f.
8 Vgl. Klaus-Jügen Tillmann: Sozialisationstheorien, S. 138ff.
9 Vgl. Carolin Em>Kollektive Identitäten, S. 227ff.
10 Vgl. Brockhaus-Lexikonredaktion (Hg.): Europa, S. 1912.
11 Brockhaus-Lexikonredaktion (Hg.): Abendland, S. 23.
12 Vgl. Heinrich Scharp: Europäische Epochen, S. 78f.
13 Vgl. Heinrich Scharp: Europäische Epochen, S. 81ff.
14 Vgl. Hermann Kinder, Werner Hilgemann: dtv-Atlas zur Weltgeschichte, S. 122.
15 Vgl. Reinhard Schneider: Europa im Mittelalter, S. 79.