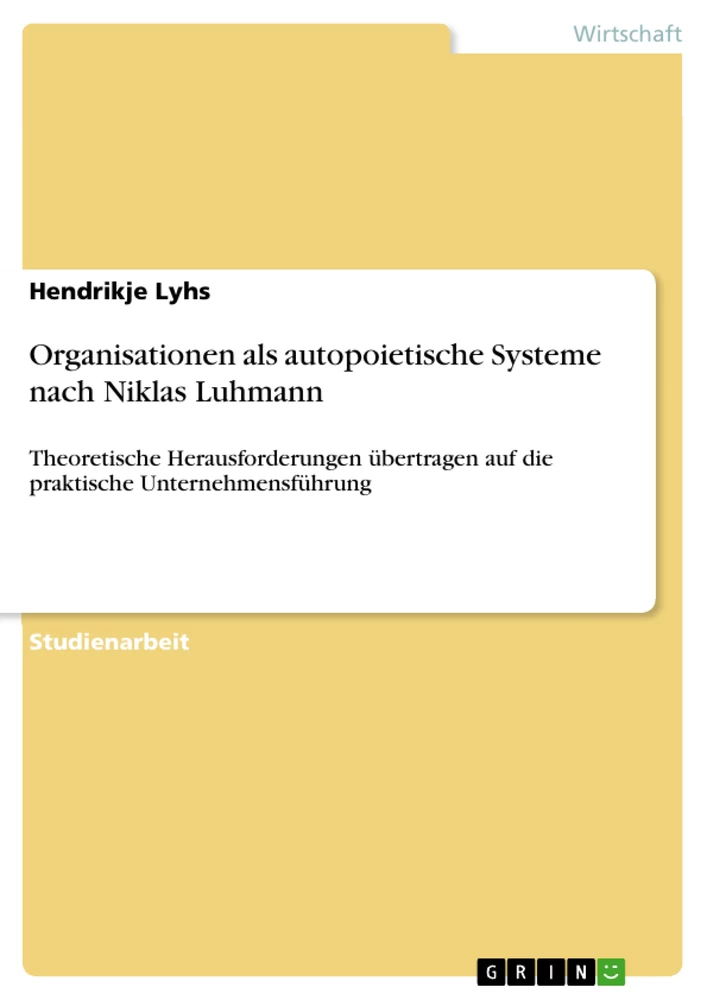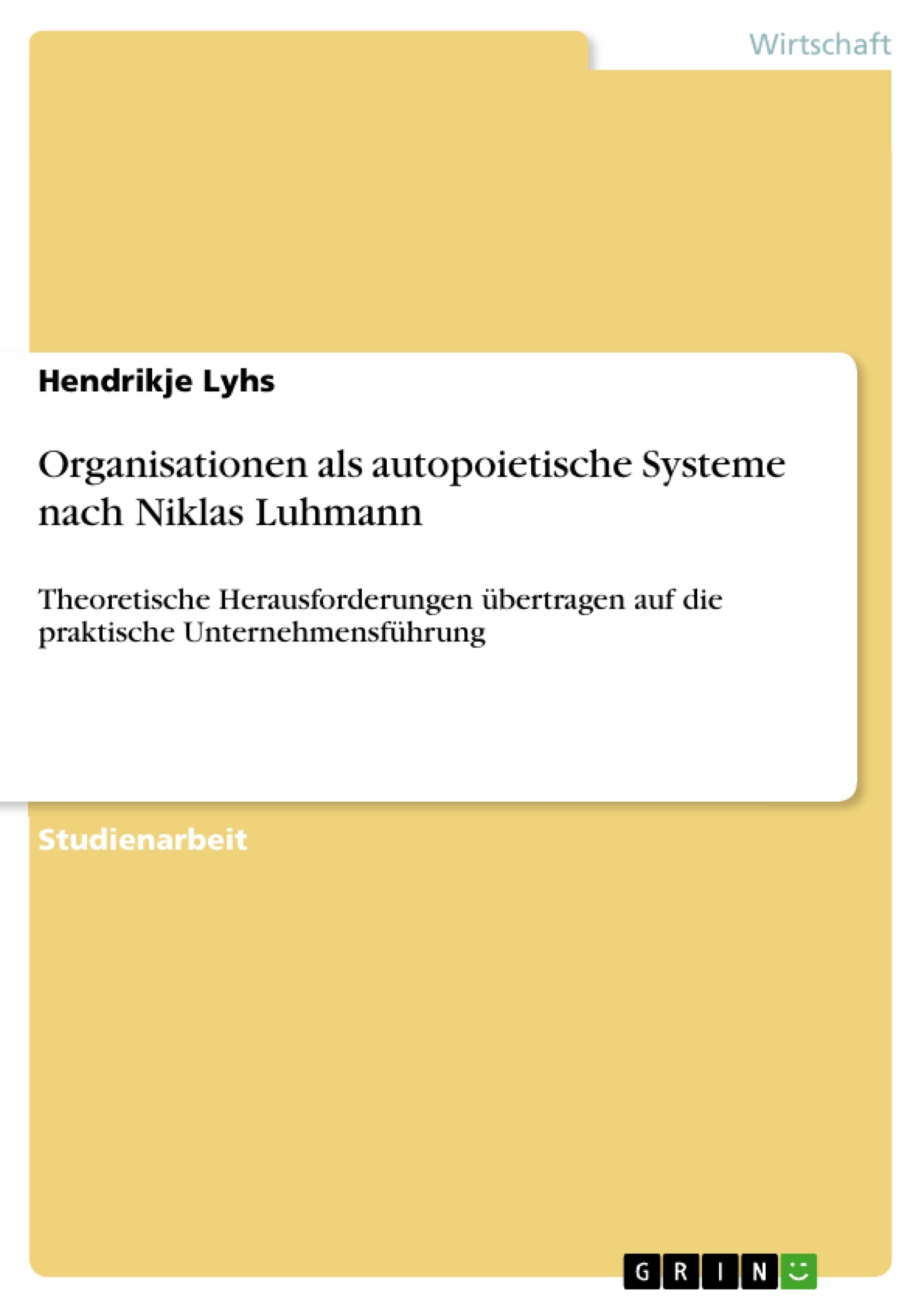Die Arbeit versucht, die Frage zu beantworten, welche Rolle der theoretische Autopoiesis-Ansatz nach Luhmann insbesondere für die praktische Unternehmensführung spielt.
Hierfür wird das zweite Kapitel dieser Arbeit eine Theoriegrundlage zu sozialen Systemen schaffen. Wichtige Begriffe wie System, Autopoiesis und Systemtheorie werden erläutert. Sie werden ebenfalls im Kontext von Luhmanns entwickeltem Verständnis von Organisationen als autopoietische Systeme untersucht. Weitere Studien werden ergänzend herangezogen. Diese konzeptionellen Grundlagen werden im dritten Kapitel angewendet. Hierfür wird untersucht werden, inwiefern das autopoietische Theoriekonzept auf die unternehmerische Praxis übertragen werden kann. Es sollen Antworten zu den gestellten Fragen gefunden und erläutert werden. Abschließend wird das vierte Kapitel die gewonnen Erkenntnisse zusammenfassen und einen Ausblick bieten.
Inhalt
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Aktuelle Problemstellung
1.2. Ziel und Aufbau der Arbeit
2. Konzeptionelle Grundlagen sozialer Systeme
2.1. Systeme
2.2. Systemtheorie
2.3. Systemtheorie nach Luhmann und soziale Systeme
2.4. Autopoiesis
2.5. Merkmale autopoietischer Systeme
3. Konsequenzen und Herausforderungen für die Praxis
3.1. Autopoiesis-Merkmale in Unternehmen
3.2. Konsequenzen und Herausforderungen für die Führung von Unternehmen
3.3. Handlungsempfehlungen für die Unternehmensführung
4. Zusammenfassung, Kritik und Fazit
Literaturverzeichnis