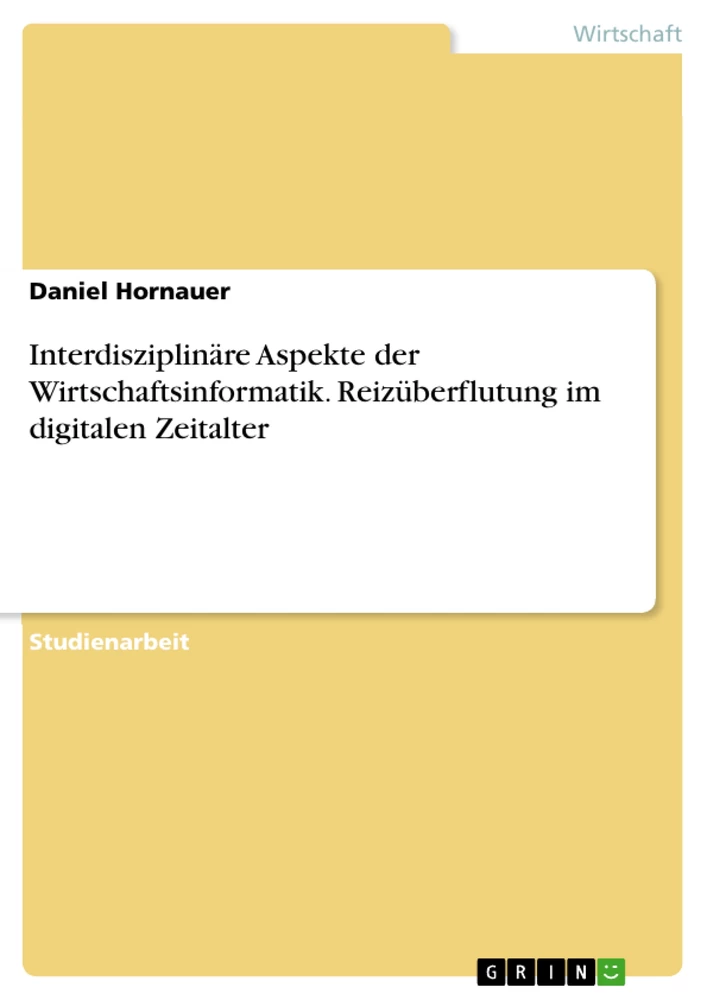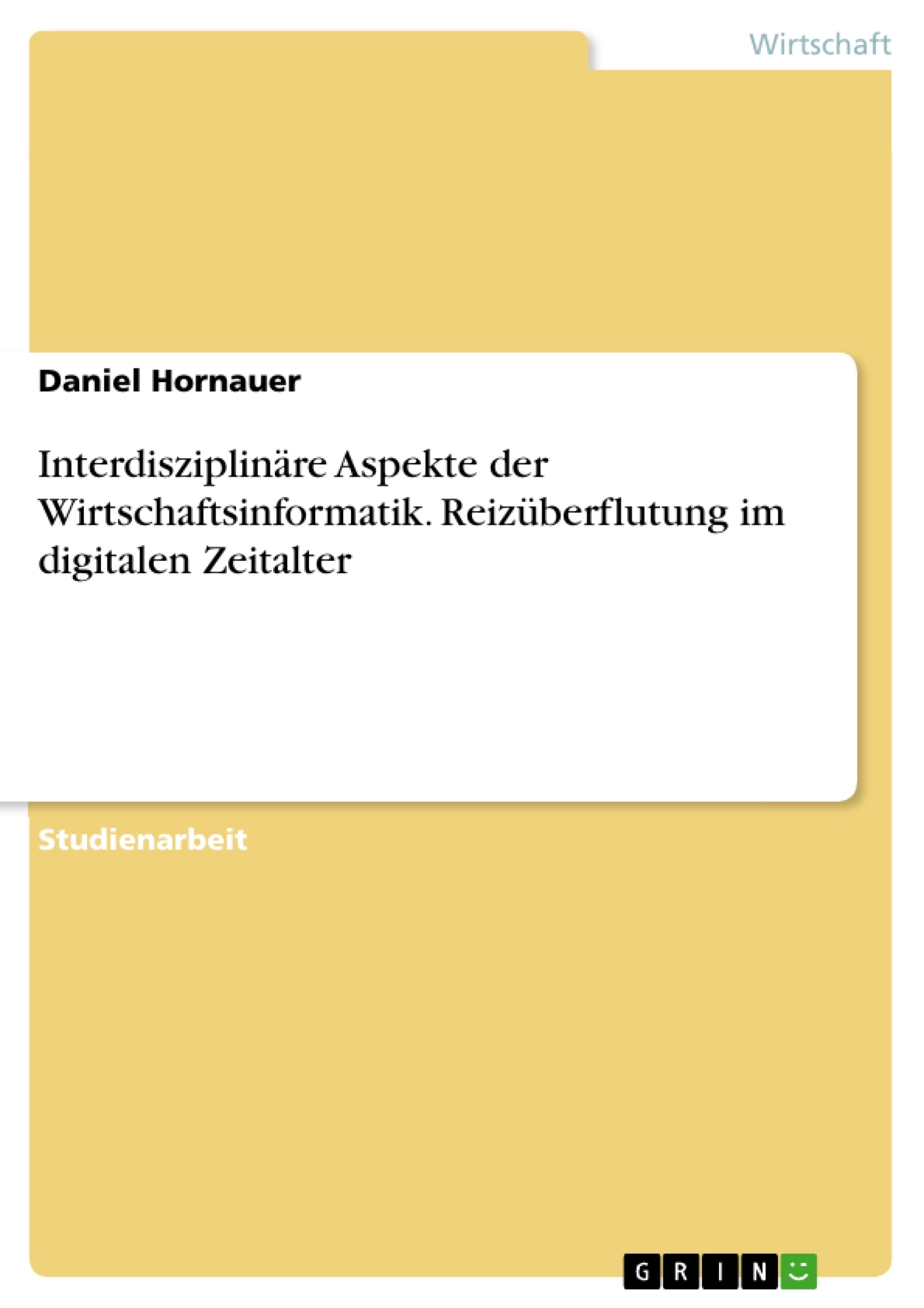Durch die Corona-Pandemie wurde die ohnehin bereits sehr schnelle technologische Entwicklung notgedrungen nochmals beschleunigt und somit auf ein neues, ungeahntes Level gehoben. In der Wissenschaft wurde der Frage, wie dies unsere Lebensweise verändert, bisher zu wenig Augenmerk geschenkt. Insbesondere wäre es wichtig, den Zusammenhang zwischen der zunehmenden Digitalisierung und dem damit einhergehenden Stress und daraus resultierenden Folgeerkrankungen zu untersuchen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich deshalb mit der Reizüberflutung durch Technologie und beantwortet im Zuge dessen folgende Frage: Wie können wir nachhaltig und sinnstiftend mit digitalen Technologien umgehen und unsere Gesundheit schützen?
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Ziel der Arbeit
1.3 Aufbau der Arbeit
1.4 Forschungsmethodik
2 Reizüberflutung im digitalen Zeitalter
2.1 Begriffsbestimmung
2.2 Gesundheitliche Folgen durch digitale Reizüberflutung
2.3 Treiber der digitalen Reizüberflutung
2.3.1 Vereinfachung von Prozessen
2.3.2 Suchtpotenzial digitaler Technologien
3 Prozess zu einem nachhaltigen Umgang mit digitalen Technologien durch „digitalen Minimalismus“
3.1 Digitale „Entrümpelung“
3.2 Die digitale Optimierungsphase
3.3 Die digitale Awareness-Phase
4 Schlussbetrachtung
4.1 Zusammenfassung
4.2 Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang