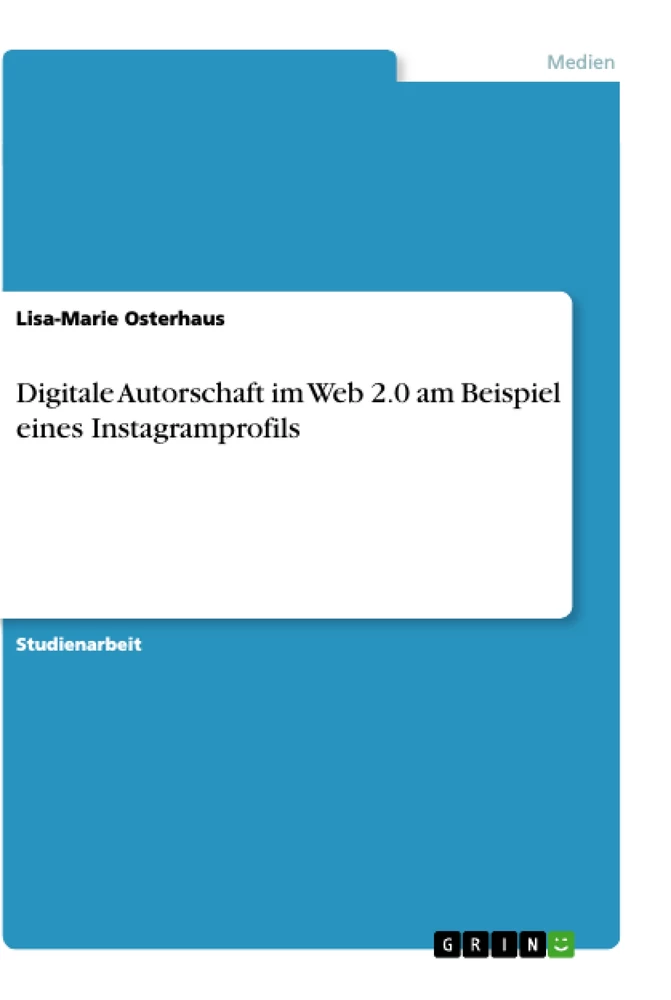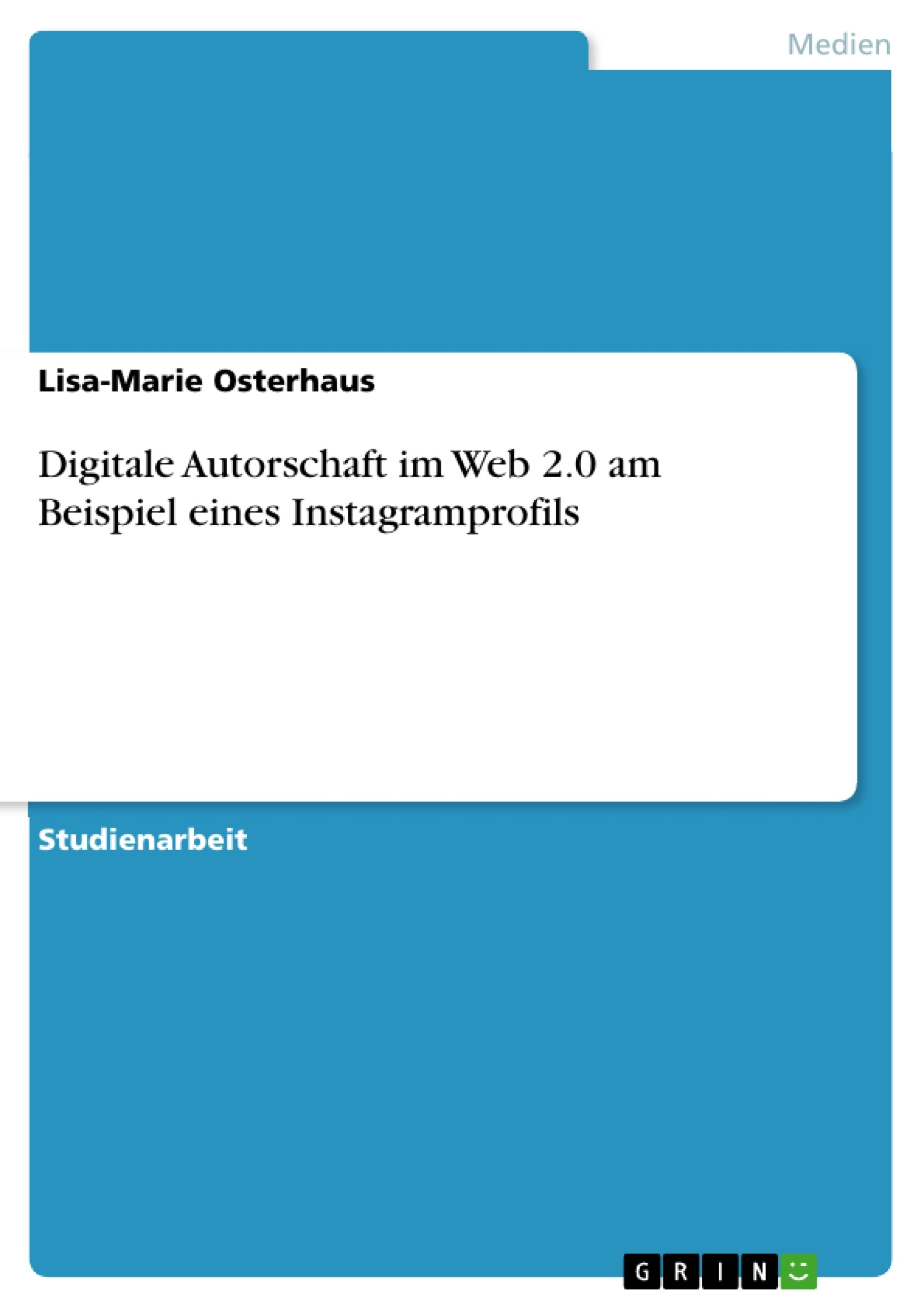Was genau definiert eine Person als Autor:in und was passiert mit diesem Konstrukt im Web 2.0, in den sozialen Medien, in denen auch die Möglichkeiten für Veröffentlichungen und Publikationen zahlreich erweitert werden? Die Arbeit sucht Antworten auf diese Fragen. Hierzu wird zunächst der Begriff der Autorschaft definiert. Es werden verschiedene Theorien aus der Literaturwissenschaft zur Autorschaft hinzugezogen. Im weiteren Verlauf wird das Social Web betrachtet, um anschließend die Rolle der digitalen Autorschaft zu untersuchen. Dies erfolgt am Beispiel des Instagram-Accounts @vonkopfbisfuss_. Die Influencerin Jana Huhn nutzt die Plattform Instagram unter anderem für Micro-Kolumnen. Die Bilder fungieren als Titel der Texte in den eigentlichen Bildunterschriften. Die Influencerin wurde also über eine einst reine Bilderplattform zu einer Autorin, oder?
In Zeiten der Digitalisierung verändern sich nicht nur das soziale Miteinander der Gesellschaft sowie die Informationsbeschaffung und Kommunikation, sondern auch der Zugang und Umgang mit der Kultur, einschließlich der Literatur. Durch die Möglichkeiten, die die Digitalisierung mit sich bringt, werden viele Texte und literarische Werke digital am Bildschirm rezipiert. Das Internet, das Web 2.0, beeinflusst jedoch nicht nur den Umgang und die Art des Rezipierens des Geschriebenen, darüber hinaus entwickelt sich auch das Schreiben selbst. Alle, ob klassische:r Autor:in oder nicht, haben durch das Web 2.0 die Möglichkeit in verschiedenen Formen, Texte zu schreiben, zu editieren und zu veröffentlichen, ganz ohne Verlag. Wenn also das sich stets weiterentwickelnde Internet Einfluss auf die Literatur nimmt, so werden auch die Autorschaft und der Werksbegriff nicht unberührt bleiben können.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Autorschaft
II.I. Der Tod der Autor:innen
II.II. Autorschaft nach Weimar
III. Das Web 2.0
III.I. Soziale Medien im Web 2.0
III.II. Digitale Literatur
III.III. Instagram als Plattform für Autor:innen
IV. Fazit
Literaturverzeichnis
I. Einleitung
Personen, die ein literarisches Werk schaffen, sind Autor:innen, literarische Werke werden von Autor:innen geschaffen. Die Konzepte von Autorschaft und Werk sind in dem Sprachgebrauch und in der Literaturwissenschaft fest veran-kert. Sie scheinen sich gegenseitig zu bedingen und zu erklären und gelten als zentrale Parameter der Diskussion um (moderne) Literatur.
In Zeiten der Digitalisierung verändern sich nicht nur das soziale Miteinander der Gesellschaft sowie die Informationsbeschaffung und Kommunikation, sondern auch der Zugang und Umgang mit der Kultur, einschließlich der Literatur. Durch die Möglichkeiten, die die Digitalisierung mit sich bringt, werden viele Texte und literarische Werke digital am Bildschirm rezipiert. Das Internet, das Web 2.0, beeinflusst jedoch nicht nur den Umgang und die Art des Rezipierens des Geschriebenen, darüber hinaus entwickelt sich auch das Schreiben selbst. Alle, ob klassische:r Autor:in oder nicht, haben durch das Web 2.0 die Möglichkeit in verschiedenen Formen, Texte zu schreiben, zu editieren und zu veröffentlichen, ganz ohne Verlag. Wenn also das sich stets weiterentwickelnde Internet Einfluss auf die Literatur nimmt, so werden auch die Autorschaft und der Werksbegriff nicht unberührt bleiben können. Was genau definiert also eine Person als Autor:in und was passiert mit diesem Konstrukt im Web 2.0, in den Sozialen Medien, in denen auch die Möglichkeiten für Veröffentlichungen und Publika-tionen zahlreich erweitert werden?
Die folgende Arbeit versucht auf diese Fragen Antworten zu finden. Hierzu wird zunächst der Begriff der Autorschaft definiert. Es werden verschiedene Theorien aus der Literaturwissenschaft zur Autorschaft hinzugezogen. Im weiteren Verlauf wird das Web 2.0 betrachtet, um anschließend die Rolle der digitalen Autor-schaft zu untersuchen. Dies erfolgt am Beispiel des Instagram -Accounts @vonkopfbisfuss_. Die Influencerin Jana Huhn nutzt die Plattform Instagram unter anderem für Micro-Kolumnen. Die Bilder fungieren als Titel der Texte in den eigentlichen Bildunterschriften. Die Infleuncerin wurde also über eine einst reine Bilderplattform zu einer Autorin, oder? Dieser Frage gilt es nachzugehen.
II. Autorschaft
Der Begriff Autor:in leitet sich von dem lateinischen Wort auctor ab und bezeichnet die geistigen Urheber:innen oder Verfasser:innen eines Textes oder eines (schriftlichen) Werkes.1 Diese werden durch den eigenen und produktiven Schreibprozess von Herausgeber:innen und Editor:innen abgegrenzt, die ein Werk bearbeiten oder publizieren. Der Autorenbegriff ist in „unterschiedlichen sozialen Handlungsfeldern [aufzufinden] – z.B. Rechtssystem, Wirtschafts-system, Erziehungssystem – […] und übernimmt selbst innerhalb der Literatur-wissenschaften unterschiedliche Funktionen, u.a. bei der Identifikation, Klassi-fikation, Interpretation und Bewertung von literarischen Texten“.2 Die Literatur-wissenschaft differenziert zunächst zwischen den historischen und den impliziten Autor:innen.3 Die sogenannten historischen Autor:innen bezeichnen die realen Urheber:innen und Verfasser:innen von Texten. Währenddessen werden die Vorstellungen der Rezipient:innen, die sie sich von den Autor:innen machen, als implizite Autor:innen bezeichnet. Die historischen Autor:innen als Urheber:innen und Verfasser:innen sind zentraler Bestandteil der Diskussion um (moderne) Literatur. Deren Relevanz und Stellung wird jedoch in unterschiedlichen Theorien verschieden bewertet.
Der Begriff der Autorschaft, wie er heute verwendet wird, besteht erst seit dem 18. Jahrhundert und steht im engen Zusammenhang mit der Entwicklung literarischer Produktionen und dem literarischen Markt.4 Autor:innen werden als Verfasser:innen von Schriften zu „Rechtssubjekt[en] […] im Sinne einer Urheber-auffassung, die Autorschaft mit den Werten Originalität und Eigentümlichkeit und die Frage nach dem A. mit dem Kunstcharakter seiner Werke verknüpft.“5 Vor dem Hintergrund der Aufklärung gewinnen Autor:innen an Individualität und Bedeutung. Die Autorschaft und der Werksbegriff werden zu wirtschaftlichen und rechtlichen Instanzen, um den literarischen Markt zu regulieren. Die Autor:innen erlangen das Recht auf geistiges Eigentum, nachdem sie zuvor lediglich als Eigentümer:innen der Manuskripte galten. Kopien und Nachdrucke konnten durch Verleger:innen ohne die Einwilligung der Autor:innen produziert und ver-breitet werden.6
In der Entwicklung der Autorschaft werden drei wesentliche Merkmale für diese herausgearbeitet:
„Ästhetisch-ideologisch: Autorschaft als Kennzeichen stilistischer Individualität, Originalität oder Genialität;
Psychologisch-hermeneutisch: Intentionalität als biographische Setzung einer Werkeinheit;
Juristisch-ökonomisch: Markierung des Eigentumsanspruchs am Werk, der Urheberschaft, die durch Institutionen als Verwertungsrecht gewahrt wird.“7
Während des 20. Jahrhunderts sind jedoch mehrere Herabstufungen und Brüche in der Relevanz der Autor:innen und des Autorenbegriffs erkennbar.
II.I. Der Tod der Autor:innen
Einer der bekanntesten Einschnitte besteht in dem Tod der Autor:innen, aus-gerufen durch Roland Barthes, unterstützt durch Foucaults Aufsatz Was ist ein Autor?.8 Diese gelten als einflussreichstes „Plädoyer für die Verabschiedung de[r] Autor[:innen] aus der Interpretation literarischer Texte“.9 Roland Barthes wendet sich gegen die Bedeutungshoheit der Autor:innen gegenüber den Wer-ken und lenkt die Fokussierung auf die Autonomie literarischer Texte. Damit erkennt er Autor:innen als neumodische Instanz, die im Zuge der Aufklärung ge-schaffen wurden. Außerdem stellt er die Rezipient:innen als bedeutungstra-gende Instrumente vor.
[...]
1 Vgl. Burdorf 2007, S. 60.
2 Ebd. S. 61.
3 Vgl. Gfrereis 2005, S. 16.
4 Vgl. Bäumer 1994, S. 33.
5 Ebd. S. 33.
6 Vgl. Tuschling 2006, S. 34.
7 Ebd. S. 35.
8 Vgl. Hoffmann/Langer 2007, S. 131 f.
9 Jannidis et al. 2007, S. 181.