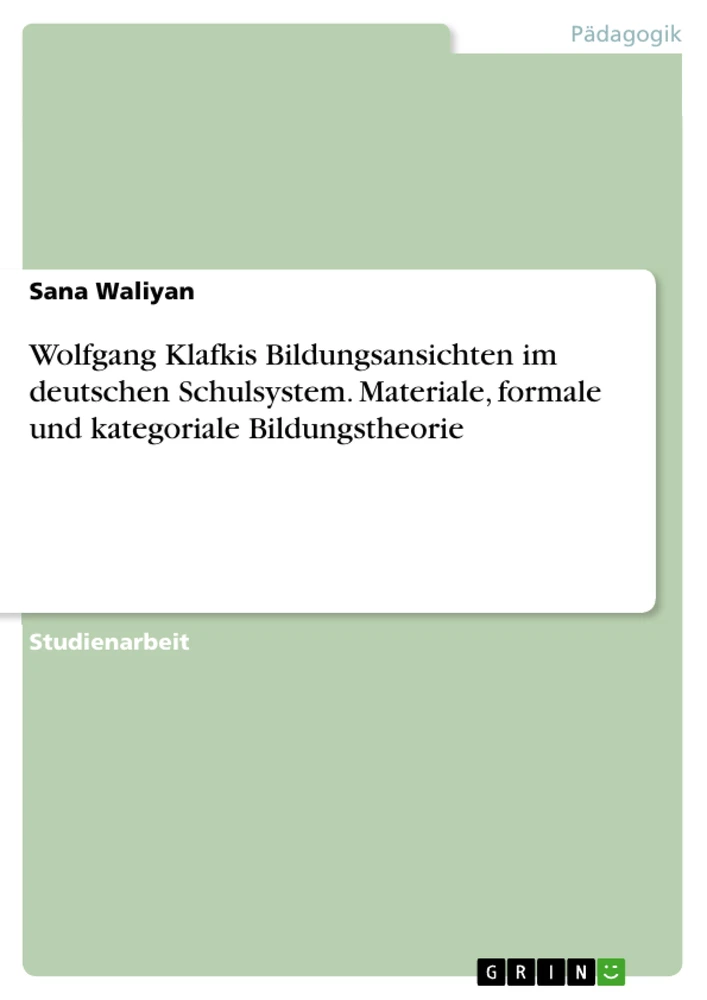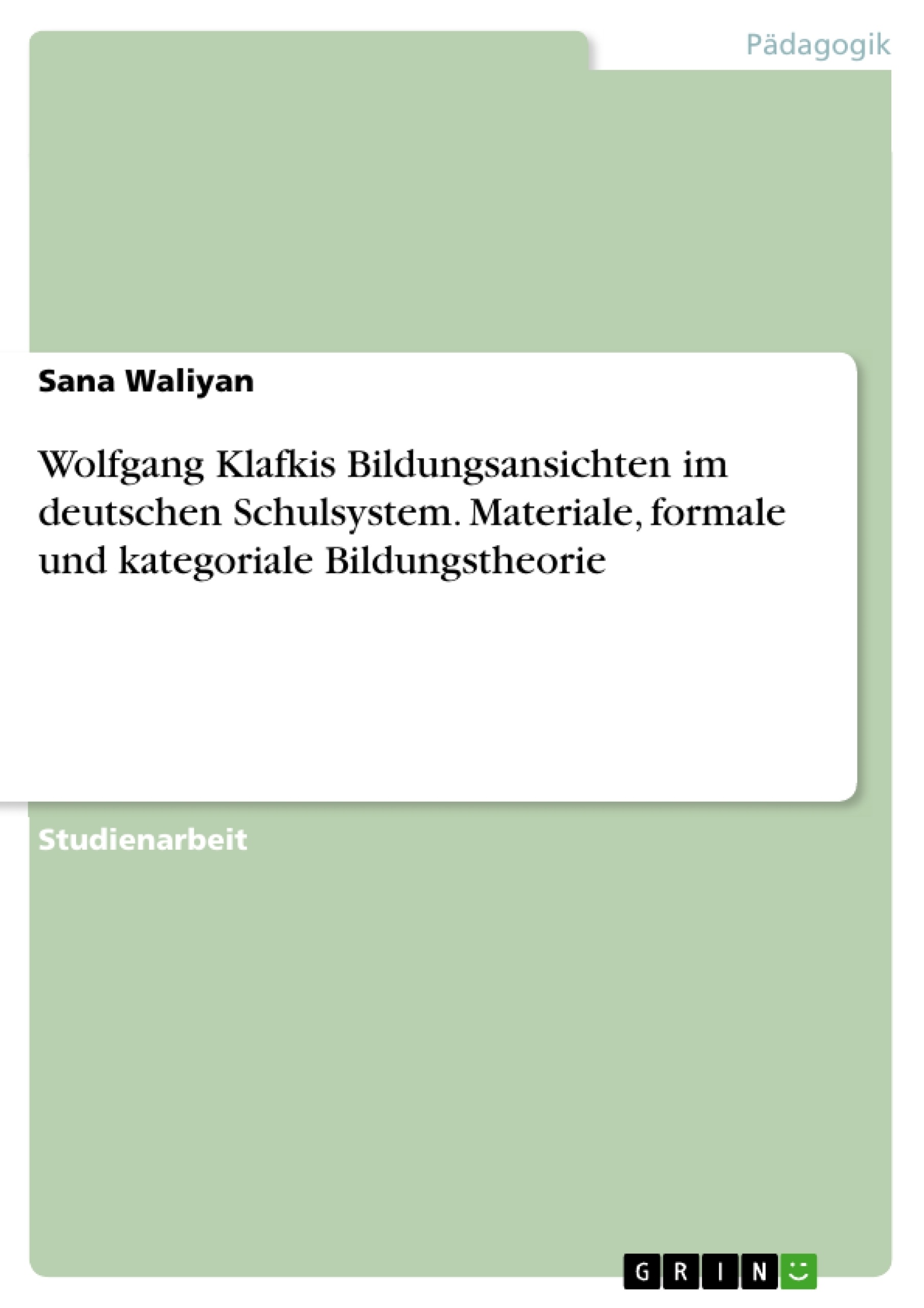Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Rolle Wolfgang Klafkis Bildungsansichten im hiesigen Schulsystem einnehmen. Zunächst wird der Bildungsbegriff nach Wolfgang Klafki und darauf basierend die Bildungstheorien dargestellt und kritisiert. Hierfür wird auf die materiale und formale Bildungstheorie eingegangen und im Anschluss die Theorie der kategorialen Bildung dargestellt. Zudem wird aufgezeigt, wie Unterricht nach der kategorialen Bildungstheorie stattfinden soll. Dafür wird auf die didaktische Analyse Klafkis lapidar eingegangen. Abschließend wird erläutert, inwiefern Klafkis Bildungsansichten im heutigen deutschen Schulsystem umgesetzt werden. Die Arbeit wird mit einem Fazit im Hinblick auf die Fragestellung beendet.
Das Thema Bildung war schon immer ein häufig diskutiertes Themengebiet. Bildung ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie ist entscheidend für die selbstbestimmte und eigenständige Teilhabe an der Gesellschaft. Sie gilt als ein fundamentales und universales Recht. Bildung trägt zur Kultiviertheit des Menschen in der Gesellschaft bei. Sie ermöglicht dem Individuum, sich mit gesellschaftlichen Themen kritisch auseinanderzusetzen und somit an die Entwicklung dieser mitzuwirken. So beschreibt Kant die Bildung als eine Möglichkeit „sich selbst besser machen, sich selbst kultivieren und […]Moralität bei sich hervorzubringen“. Erziehungswissenschaftler wie Humboldt und Kant befassten sich mit dem Bildungsverständnis und konzipierten Bildungstheorien, um ein adäquates Bildungsverständnis zu entwickeln, darunter auch Klafki.
Klafki ist einer der wichtigsten und angesehensten Vertreter der Erziehungswissenschaften. Bereits in jungen Jahren zeigte er großes Interesse an der Bildungspolitik. Er befasste sich mit grundlegenden Themen der Erziehungswissenschaften, darunter die Schul- und Bildungspolitik, die bildungstheoretische Didaktik sowie mit der Schultheorie. Durch seine Dissertation, die 1959 mit dem Titel „Das pädagogische Problem des Elementaren und die Theorie der kategorialen Bildung“ erschien, hegte er große Aufmerksamkeit. In dieser kritisierte er bereits bestehende Bildungstheorien und entwickelte die Theorie der kategorialen Bildung. Auch heute noch nimmt Klafkis Bildungstheorie und vor allem seine Theorie der kategorialen Bildung eine zentrale Rolle im hiesigen Schulwesen ein.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Bildungsbegriff nach Klafki
2.1. Die drei Grundfähigkeiten
2.2. Bildungstheorien
2.2.1. Materiale Bildungstheorie
2.2.2. Formale Bildungstheorie
2.2.3. Kategoriale Bildungstheorie
2.3. Allgemeinbildung nach Klafki
2.4. Schlüsselprobleme
3. Didaktische Analyse: Unterrichtsprinzipien
4. Kritik an Klafkis Bildungskonzept
5. Klafkis Bildungsansichten im deutschen Schulsystem
6. Fazit
1. Einleitung
Das Thema Bildung war schon immer ein häufig diskutiertes Themengebiet. Bildung ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie ist entscheidend für die selbstbestimmte und eigenständige Teilhabe an der Gesellschaft. Sie gilt als ein fundamentales und universales Recht. Bildung trägt zur Kultiviertheit des Menschen in der Gesellschaft bei. Sie ermöglicht dem Individuum, sich mit gesellschaftlichen Themen kritisch auseinanderzusetzen und somit an die Entwicklung dieser mitzuwirken. So beschreibt Kant die Bildung als eine Möglichkeit „sich selbst besser machen, sich selbst kultivieren und [... ]Moralität bei sich hervorzubringen“ (Klafki 1994: 20, zitiert nach Kant 1963: 128).
Erziehungswissenschaftler wie Humboldt und Kant befassten sich mit dem Bildungsverständnis und konzipierten Bildungstheorien, um ein adäquates Bildungsverständnis zu entwickeln, darunter auch Wolfgang Klafki. Klafki ist einer der wichtigsten und angesehensten Vertreter der Erziehungswissenschaften. Bereits in jungen Jahren zeigte er großes Interesse an der Bildungspolitik. Er befasste sich mit grundlegenden Themen der Erziehungswissenschaften, darunter die Schul- und Bildungspolitik, die bildungstheoretische Didaktik sowie mit der Schultheorie (vgl. Stübig & Stübig 2018: 1). Durch seine Dissertation, die 1959 mit dem Titel „Das pädagogische Problem des Elementaren und die Theorie der kategorialen Bildung“ erschien, hegte er große Aufmerksamkeit (Meyer & Meyer 2007: 15). In dieser kritisierte er bereits bestehende Bildungstheorien und entwickelte die Theorie der kategorialen Bildung. Auch heute noch nimmt Klafkis Bildungstheorie und vor allem seine Theorie der kategorialen Bildung eine zentrale Rolle im hiesigen Schulwesen ein.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Rolle Klafkis Bildungsansichten im hiesigen Schulsystem einnehmen. Zunächst wird der Bildungsbegriff nach Wolfgang Klafki und darauf basierend die Bildungstheorien dargestellt und kritisiert. Hierfür werde ich auf die materiale und formale Bildungstheorie eingehen und im Anschluss die Theorie der kategorialen Bildung darstellen. Zudem werde ich aufzeigen, wie Unterricht nach der kategorialen Bildungstheorie stattfinden soll. Dafür werde ich auf die didaktische Analyse Klafkis, lapidar eingehen. Abschließend wird erläutert, inwiefern Klafkis Bildungsansichten im heutigen deutschen Schulsystem umgesetzt werden. Meine Arbeit beende ich mit einem Fazit im Hinblick auf meiner Fragestellung.
2. Bildungsbegriff nach Wolfgang Klafki:
In den Erziehungswissenschaften wird dem Bildungsbegriff nach Klafki eine enorme Relevanz zugesprochen. Klafki versucht Anfang des 19. Jahrhunderts mit seiner Definition ein System zu schaffen, welches ermöglicht, Bildung optimal zu definieren. Bildung wird von Bildungstheoretikern wie Humboldt zunächst durch Begriffe wie Selbstbestimmung, Freiheit, Emanzipation, Autonomie, Mündigkeit, Vernunft und Selbsttätigkeit umschrieben (vgl. Klafki 1994:19). Klafki kritisiert den klassischen Bildungsbegriff, der unter anderem von Humboldt vertreten wurde. Er behauptet, dass der „Zusammenhang von Bildung und Gesellschaftsstrukturen und damit die politische Dimension ihrer eigenen Entwürfe von Menschenbildung nur unzulänglich reflektiert worden [sei]“. (Koller 2017: 105, zitiert nach Klafki 1985: 48). Aus diesem Grund definiert er den Bildungsbegriff neu. Folglich soll Bildung, so Klafki „als selbsttätig erarbeiteter und personal verantworteter Zusammenhang dreier Grundfähigkeiten verstanden werden“ (Klafki 1990:93).
2.1. Drei Grundfähigkeiten:
Die erste Eigenschaft ist die Selbstbestimmung (vgl. Meyer & Meyer 2017: 117). Der Mensch soll imstande sein, eigenständig in allen Lebensbereichen, sei es auf beruflicher, ethnischer oder zwischenmenschlicher Ebene, Entscheidungen für sich selbst treffen zu können (vgl. ebd.). Bildung vermittelt nach Klafki die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, der Mündigkeit und der Emanzipation (vgl. ebd.). Das Individuum solle demnach die Freiheit zum eigenen Denken und das Treffen moralischer Entscheidungen besitzen ohne jegliche Fremdbestimmung (vgl. ebd.). Die Kompetenz zur Selbstbestimmung geht aus dem Zitat von Kant „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“ (Klafki 1994:19, nach Kant 1968: 35) hervor. Klafki orientiert sich an Kants Begriff der Mündigkeit und stellt sein Bildungsbegriff „in die Tradition der Aufklärung“ (vgl. ebd.).
Weiterhin soll der Mensch die Kompetenz der Mitbestimmungsfähigkeit besitzen (vgl. ebd.). Ein gebildeter Mensch müsse dazu fähig sein, soziale-und politische Prozesse innerhalb einer Gesellschaft mitgestalten zu können (vgl. ebd.).
Die letzte Eigenschaft bildet die Solidaritätsfähigkeit. Bildung beinhaltet laut Klafki Solidaritätsfähigkeit, dies bedeutet, dass der Mensch nicht egoistisch handelt und ausschließlich auf sein eigenes Wohlergehen achtet (vgl. ebd.). Ein gebildeter Mensch beachtet die Bedürfnisse und Wünsche seiner Mitmenschen. Er ist vor allem für diejenigen mitverantwortlich, die unterprivilegiert sind, da sie kein Selbst- und Mitbestimmungsrecht verfügen und somit politisch in vielerlei Hinsichten unterdrückt werden (vgl. ebd.).
2.2 Bildungstheorien:
Bildungstheoretiker wie Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich Fröbel, Friedrich Herbart und Wolfgang Klafki befassten sich nicht ausschließlich mit dem Bildungsbegriff. Sie untersuchten auch systematisch Inhalte, die in jedem Bildungsprozess erscheinen müssen (vgl. Meyer & Meyer 2017: 24). Sie analysierten „die Welt der Inhalte, das Materiale, das zu Lernende, [...] ihr Kompetenzerwerb und das Formale“(ebd.). Basierend auf die Ergebnisse ihrer Untersuchungen wird Bildung heute in zwei grundsätzliche Kategorien neuzeitlicher Bildungstheorien differenziert (vgl. Ebert 1986: 13). Die materiale und die formale Bildungstheorie.
2.2.1. Materiale Bildungstheorie:
Die materiale Bildungstheorie lässt sich nochmals in zwei Zweige unterteilen. Der bildungstheoretische Objektivismus und die Bildungstheorie des Klassischen (vgl. ebd. :25).
Die Vertreter der materialen Bildungstheorie verstehen Bildung „aus der objektiven Perspektive der zu vermittelnden Bildungsinhalte“ (ebd.). Sie ist demnach objektbezogen, wodurch nicht der Mensch als Subjekt im Vordergrund steht, sondern die Welt und ihre Inhalte als Objekt. Angesichts dessen, fassen materiale Bildungstheoretikern, Bildung zentral als den Erwerb von Wissen auf. Schüler*innen sollen das Wissen jederzeit, ähnlich wie eine Enzyklopädie abrufen können (vgl. Meyer & Meyer 2017: 32).
Die Bildungstheorie des Klassischen befasst sich mit der Frage, welche Inhalte, Sachverhalte, Probleme und Aufgaben für das Individuum so relevant sind, sodass diese erprobt und erlernt und maßgeblich verinnerlicht werden sollen bzw. müssen. Die Vertreter beschreiben „Kanons von Fächern und Bildungsinhalte“, wodurch eine Liste aus Bildungsgütern entsteht (ebd.).
Nach der materialen Bildungstheorie gilt ein Mensch als gebildet, der sich möglichst viel Wissen aus der Liste der Bildungsgüter angeeignet hat und diese abrufen kann.
[...]