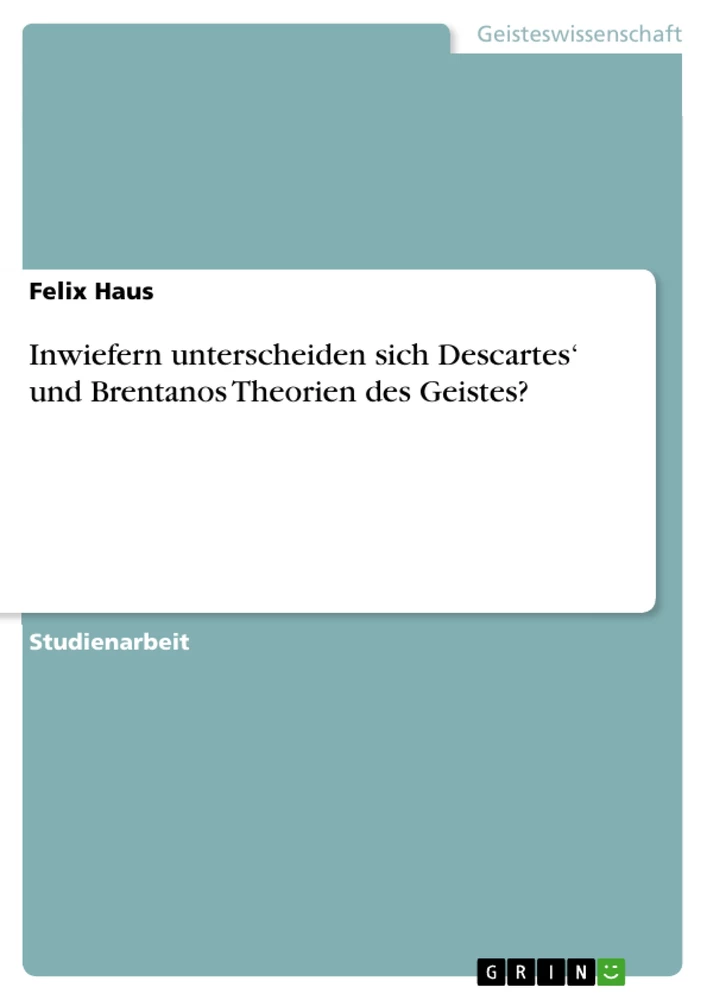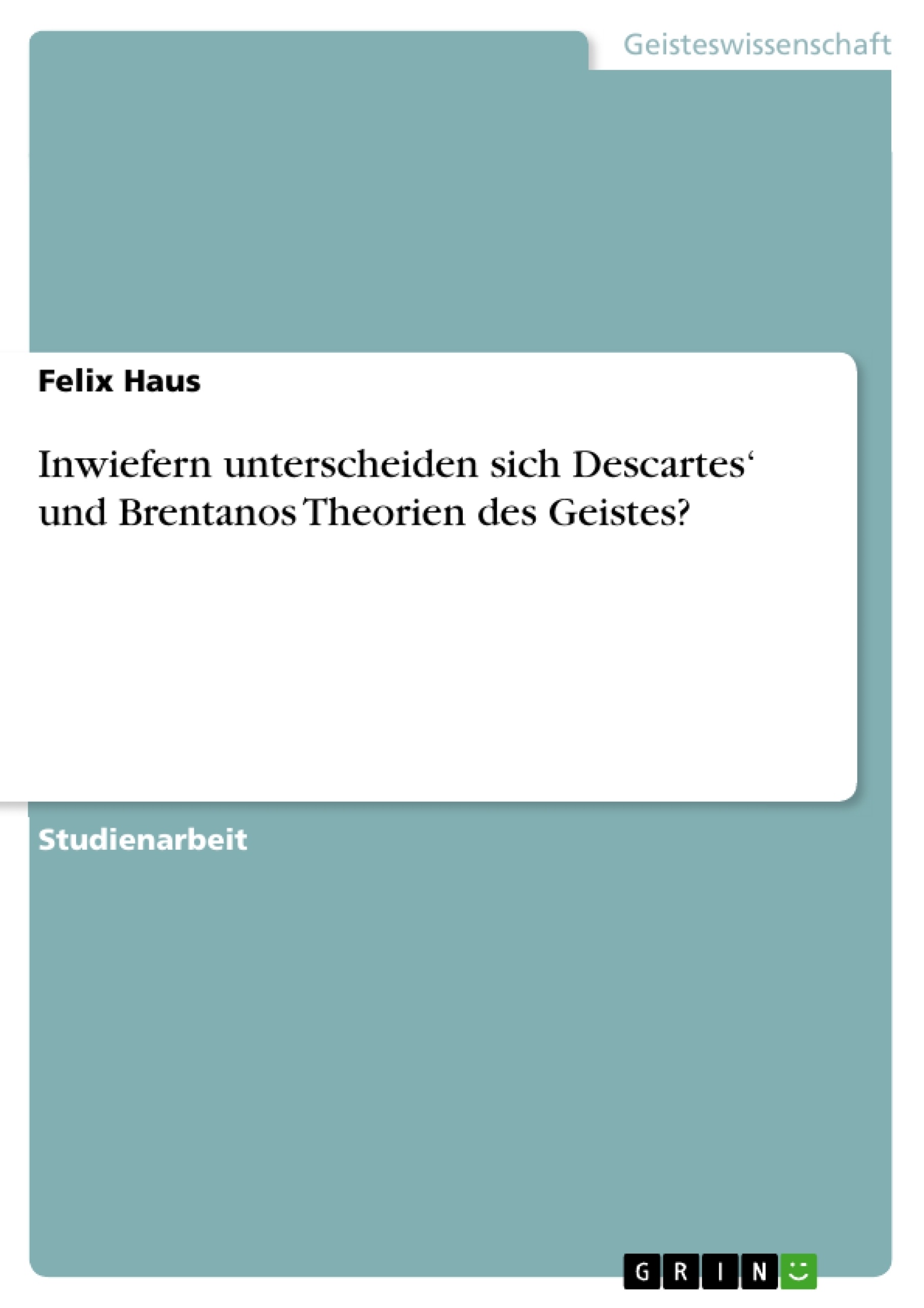Franz Brentano und René Descartes spielen beide auf sehr unterschiedliche Weise eine sehr wichtige Rolle in der Geschichte der Philosophie des Geistes. Doch obwohl ihre Ansätze so unterschiedlich waren und etwa zweihundert Jahre zwischen ihnen liegen, sind bei der Lektüre ihrer Theorien erstaunliche Ähnlichkeiten zu beobachten. Doch sind diese Ähnlichkeiten nur scheinbar und oberflächlich, oder handelt es sich eigentlich um ein und dieselbe Theorie?
Im Folgenden soll dieser Frage auf den Grund gegangen und die Ideentheorie von Descartes mit Brentanos Theorie zur Intentionalität vergleichen werden. Dies soll unter der Frage geschehen, ob und was Brentanos Theorie an Neuerungen bieten kann und inwiefern sie als identisch oder als Update zu Descartes Theorie gesehen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Descartes‘ Ideentheorie
2.1 Einführung
2.2 Mentale Gegenstände bei Descartes
2.3 Mentale Zustände bei Descartes
2.4 Die Vielfalt der Phänomene bei Descartes
2.4.1 Die Vielfalt mentaler Gegenstände
2.4.2 Die Vielfalt mentaler Zustände
2.5 Gegenstände der Außenwelt bei Descartes
3. Brentanos Theorie im Vergleich
3.1 Einführung
3.2 Mentale Gegenstände bei Brentano
3.3 Mentale Zustände bei Brentano
3.4 Gegenstände der Außenwelt bei Brentano
3.5 Die Vielfalt der Phänomene bei Brentano
3.5.1 Die Vielfalt mentaler Gegenstände
3.5.2 Die Vielfalt mentaler Zustände
4. Fazit