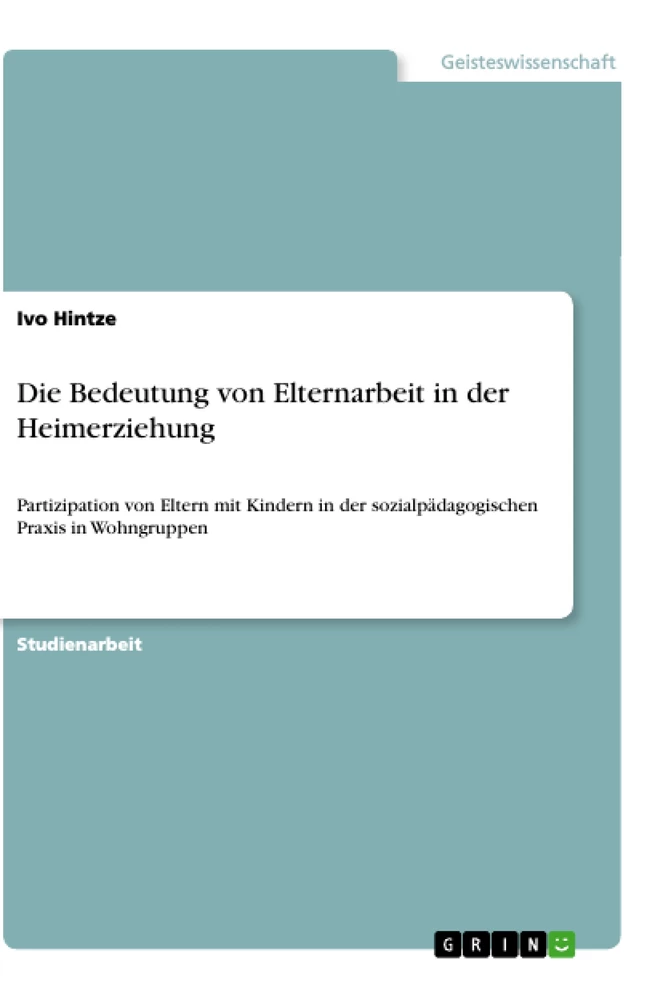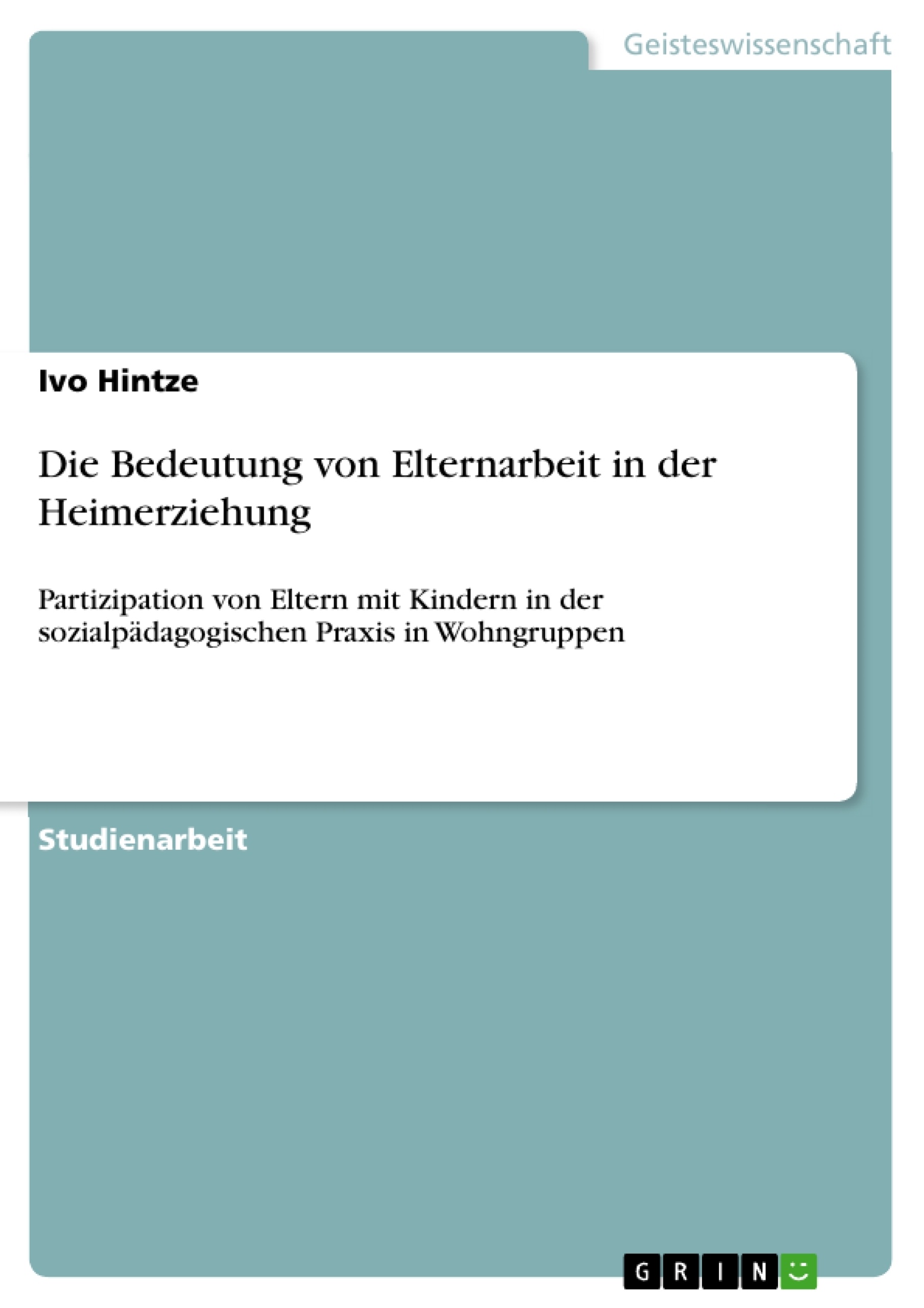Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit behandelt das Handlungsfeld der Heimerziehung, welches einen Teilbereich der Kinder- und Jugendhilfe darstellt. Hierbei wird insbesondere die Bedeutung von Elternarbeit fokussiert. Das Ziel dieser Hausarbeit ist die Ausarbeitung und Beantwortung der zentralen Fragestellungen, wie die Elternarbeit mit sorgeberechtigten Eltern von Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren in der Heimerziehung die Rückführung in die Herkunftsfamilie beeinflusst. Dieser Fragestellung wird in Rahmen einer qualitativen Sozialforschung nachgegangen. Dafür wurden wissenschaftliche Theorien, Erkenntnisse und Studien zum Thema im Theorieteil gesammelt und niedergeschrieben. Außerdem wurde ein leitfadengestütztes Experteninterview mit einem Sozialarbeiter durchgeführt, der seit viereinhalb Jahren in einer Wohngruppe tätig ist und Fortbildungen im Bereich Elterntraining absolviert hat. Die Ergebnisse der Erhebung werden mit der referierten Literatur abgeglichen, dargestellt und ausgewertet.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Begriffserläuterungen
1.1 Elternschaft, Elterliche Sorge und Elternverantwortung
1.2 Heimerziehung und stationäre Einrichtungen nach § 34 SGB VIII
1.3 Partizipation / Elternarbeit
2. Theoretischer Hintergrund
2.1 Professionsbezogene Einordnung Sozialer Arbeit in der Heimerziehung
2.2 Notwendigkeit der Elternarbeit
2.3 Aktuelle Studien zur Elternarbeit in der Heimerziehung
3. Methodisches Vorgehen
3.1 Feldzugang und Sample
3.2 Erhebungsmethode
3.3 Transkription und Auswertungsmethode
4. Auswertung und Darstellung der Ergebnisse
4.1 Voraussetzungen für Elternarbeit
4.2 Gestaltung von Elternarbeit
4.3 Wirkung von Elternarbeit
Fazit
Anhang
I. Leitfaden des Experteninterviews
II. Transkriptionsregeln
III. Interviewtransskript
IV. Ankerbeispiel
V. Kategoriensystem
Einleitung
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit behandelt das Handlungsfeld der Heimerziehung, welches einen Teilbereich der Kinder- und Jugendhilfe darstellt. Hierbei wird insbesondere die Bedeutung von Elternarbeit fokussiert. Das Ziel dieser Hausarbeit ist die Ausarbeitung und Beantwortung der zentralen Fragestellungen, wie die Elternarbeit mit sorgeberechtigten Eltern von Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren in der Heimerziehung die Rückführung in die Herkunftsfamilie beeinflusst. Dieser Fragestellung wird in Rahmen einer qualitativen Sozialforschung nachgegangen. Dafür wurden wissenschaftliche Theorien, Erkenntnisse und Studien zum Thema im Theorieteil gesammelt und niedergeschrieben. Außerdem wurde ein leitfadengestütztes Experteninterview mit einem Sozialarbeiter durchgeführt, der seit viereinhalb Jahren in einer Wohngruppe tätig ist und Fortbildungen im Bereich Elterntraining absolviert hat. Die Ergebnisse der Erhebung werden mit der referierten Literatur abgeglichen, dargestellt und ausgewertet.
Die Heimerziehung ist ein stetig wachsendes Handlungsfeld in der Sozialen Arbeit. Im Jahre 2016 leitete das Jugendamt für 53.300 Kinder eine Unterbringung in einem Heim oder einer anderen betreuten Wohnform ein (vgl. Statistisches Bundesamt: 2017). Das Statistische Bundesamt (2017) gibt an, dass somit ein Anstieg der Heimerziehung um 20% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet wurde. In den Medien und der Gesellschaft wird die Heimerziehung häufig noch negativ stigmatisiert. Das Etablieren von Wohngruppe in Wohngebieten stößt nicht selten auf Ablehnung von den dort lebenden Menschen (vgl. Heidemann/ Greving 2017: 34). Das Ansiedeln in Wohngebieten bezieht sich auf eine Leitnorm der Lebensweltorientierung, die im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG/ SGB VIII) verankert ist und zeichnet sich in der Entwicklung der Heimerziehung durch eine Dezentralisierung der Einrichtungen aus (vgl. Günder 2014: 131). Dadurch soll den Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden, in der Nähe ihres gewohnten Umfeldes wie der Schule, Familie und Sportverein leben zu können (vgl. ebd.). Mitinbegriffen ist das frühere soziale Umfeld mit besonderer Berücksichtigung der Eltern (vgl. ebd.). Im Rahmen der Heimerziehung wird der Elternarbeit eine wachsende Bedeutung zugeschrieben. Zum einen ist die Partizipation der Eltern am Hilfeprozess der Kinder gesetzlich vorgeschrieben und zum anderen zeigen Studien, dass die Hilfe erfolgreicher verläuft, wenn Elternarbeit geleistet wird (vgl. Günder 2014: 133; Arnold/ Macsenaere 2015: 368). Auch im Zusammenhang mit der Pluralisierung von Familienformen sowie dem damit verbundenen „variantenreichen Spektrum an Eltern-Kind-Beziehungen“ und immer komplexer werdenden Lebensgeschichten, steht die Soziale Arbeit mit ihren Fachkräften vor neuen Herausforderungen (Oel- ker 2015: 351). Um die Lebensweltorientierung und den Einbezug der sozialen Kontakte zu gewährleisten, die einen Einfluss auf das Verhalten und auf emotionale Schwierigkeiten des Kindes haben, gewinnt die systemische Arbeit immer mehr an Bedeutung (vgl. Günder/ Nowacki 2020: 218f.).
Das erste Kapitel beinhaltet verschiedene Begriffserklärungen, die für das Verständnis der theoretischen Betrachtung des Themas dieser Hausarbeit relevant und rahmengebend sind. Die Begrifflichkeiten sind in drei Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt thematisiert die Elternschaft, Elterliche Sorge und Elternverantwortung. Im zweiten Abschnitt werden das Heim und die stationären Einrichtungen nach § 34 SGB VIII dargestellt. Abschließend werden im dritten Abschnitt die Begriffe Partizipation und Elternarbeit definiert. Der theoretische Hintergrund wird im zweiten Kapitel genauer betrachtet. Dafür werden zuerst die historische Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen der Heimerziehung fokussiert. Hierbei findet eine professionsbezogene Einordnung der Sozialen Arbeit in der Heimerziehung statt. Darüber hinaus werden sowohl der systemische also auch der Bindungstheoretische Ansatz sowie Methoden der Elternarbeit dargestellt, die für die Begründung der Notwendigkeit von Elternarbeit ausschlaggeben sind. Das Kapitel wird mit aktuellen Studien zur Wirksamkeit von Elternarbeit abgeschlossen.
Das Methodische Vorgehen der empirischen Erhebung wird im dritten Kapitel ausführlich vorgestellt. Als erstes wird auf den Zugang zum Feld und die Auswahl des Interviewpartners eingegangen. Anschließend wird die Erhebungsmethode in Form eines leitfadengestützten Experteninterviews beschrieben. Die im dritten Abschnitt erwähnte Transkription und die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2017) stellen den Abschluss des Kapitels dar. Außerdem findet nach jedem Abschnitt eine kurze Reflexion zur Methode statt. Kernpunkt dieser Hausarbeit ist die Ergebnisdarstellung im vierten Kapitel. In diesem werden die aus der Inhaltsanalyse gewonnenen Erkenntnisse mit der Literatur aus dem Theorieteil verglichen und im Rahmen einer Diskussion ausgewertet. Die Ergebnisse werden in den drei Abschnitten Voraussetzungen für Elternarbeit, Gestaltung von Elternarbeit und Wirkungen von Elternarbeit dokumentiert. Das Fazit ergibt sich aus einer zusammenfassenden Betrachtung der wichtigsten Ergebnisse, mit denen eine Beantwortung der erwähnten Forschungsfragen angestrebt wird.
1. Begriffserläuterungen
Das Kapitel veranschaulicht zunächst die Begrifflichkeiten Elternschaft, Elterliche Sorge und Elternverantwortung. Anschließend werden die Begriffe Heim und stationäre Einrichtungen nach § 34 SGB VIII sowie Partizipation bzw. Elternarbeit definiert.
1.1 Elternschaft, Elterliche Sorge und Elternverantwortung
Unter Elternschaft wird in der Regel „die Rolle von Vätern und Müttern, die im genetischen, biologischen, juristischen und/ oder sozialen Sinn die Eltern eines Kin- des/ mehrerer Kinder sind“ verstanden (Oelkers 2015: 350). Während die biologische Elternschaft aus einer Zeugung und Geburt von Kindern hervorgeht, ist bei der genetischen Elternschaft eine Zeugung und Geburt bzw. Austragung von Kindern „mit Hilfe der Reproduktionsmedizin“ gemeint, bei welcher eine biologische Elternschaft nicht immer eindeutig zu bestimmen ist (Oelkers 2015: 350). Die juristische Elternschaft umfasst sowohl die Elternrechte als auch die Elternpflichten, die in sämtlichen Gesetzesbüchern, darunter auch im SGB VIII, rechtlich definiert sind (vgl. Oelkers 2015: 350). Die soziale Elternschaft beinhaltet die Umsetzung der Pflichten und Rechten, welche „die langfristige Übernahme von Verantwortung, Zuwendung, Betreuung, Versorgung und Erziehung“ umschließen (Oelkers 2015: 350). Die soziale Elternschaft kann von Adoptiveltern, Pflegeeltern und Stiefeltern übernommen werden (Oelkers, 2015: 350). Durch die verschiedenen Möglichkeiten einer Elternschaft und Elternkonstellationen entsteht zunehmend eine Plurali- sierung von Familienformen. Diese können sich im Lebenslauf verändern, sodass Kinder und Jugendliche in wechselnden Familienformen aufwachsen und die Eltern-Kind-Beziehungen variieren (vgl. Oelkers 2015: 350f.).
Relevant für diese Hausarbeit sind insbesondere die juristische und die soziale Elternschaf. Das Elternrecht ist im Grundgesetz verankert und betrifft „die öffentlich-rechtliche Beziehung zwischen den Eltern und dem Staat hinsichtlich des Kinderrechts“ (Oelkers 2015: 352). Es besteht also ein Dreiecksverhältnis zwischen Eltern, Kinder/Jugendliche und Staat (Rätz, Schröer & Wolf 2014: 48). In der Regel sind die Familien vor staatlichen Eingriffen geschützt, jedoch verfügt der Staat über das sogenannte staatliche Wächteramt, welches Sorge trägt, wenn ein Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII vorliegt (vgl. Rätz, Schröer & Wolf 2014: 48; Oelkers 2015: 352).
Ein weiterer zentraler Begriff in der juristischen Elternschaft ist die Elterliche Sorge, die von dem Elternrecht abzugrenzen ist, da diese sich auf den Bereich der privatrechtlichen Beziehung zwischen Eltern und minderjährigen Kindern bezieht (vgl. Oelkers 2015: 352). Die elterliche Sorge ist im Familienrecht des Bürgergesetzbuchs verankert und beinhaltet die Personen- und Vermögensfürsorge sowie die gesetzliche Vertretung (vgl. Oelkers 2015: 353). Unter die Personenfürsorge fallen alle persönlichen Angelegenheiten des Kindes wie Erziehung, Aufenthaltsbestimmung und Beaufsichtigung (vgl. Oelkers 2015: 353). Hierbei erhält die staatliche Sorge eine Nachrangigkeit und Eltern bzw. Personenberechtigte können unter anderem über Erziehungsstile, Religion, Weltanschauung, Schulform frei entscheiden (vgl. Rätz, Schröer & Wolff 2014: 48; Oelkers 2015: 353). Die Elterliche Sorge endet mit der Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes (vgl. Oelkers 2015: 353).
Die soziale Elternschaft wird durch die Elternverantwortung abgedeckt. Das bedeutet, dass die Eltern gesetzlich und moralisch durch die Gesellschaft verpflichtet sind, das Kind zu pflegen, zu erziehen und zu fördern (vgl. Oelkers 2015: 354). Neben den Grundbedürfnissen, wie der Unterkunft und Verpflegung, sind vor allem psychosoziale Aspekte wie der Schutz vor Gefahren, die Kontinuität des Betreuungsverhältnisses und die Bindungen des Kindes von Bedeutung (vgl. Oelkers 2015: 354).
1.2 Heimerziehung und stationäre Einrichtungen nach § 34 SGB VIII
Der in der Gesellschaft etablierte Begriff „Heim“ ist ein Sammelbegriff für die verschiedene Wohn- und Unterbringungsformen über Tag und Nacht für Kinder und Jugendliche außerhalb der Herkunftsfamilie (vgl. Rätz, Schröer & Wolff 2014: 168; Heidemann/ Greving 2017: 4ff.) Die Unterbringung außerhalb der Herkunftsfamilie wird auch „Fremdunterbringung“ genannt (vgl. Rätz, Schröer & Wolff 2014: 168). In Deutschland haben sich die Unterbringungsformen in den letzten Jahren immer weiter differenziert. Dazu gehören unter anderem Kinder- und Jugendheime, Säuglingsheime, Mutter-/Vater-Kind-Heim oder Heilpädagogisches Heime sowie die Betreuungsformen innerhalb der Heimerziehung nach § 34 SGB VlIl (vgl. Hei- demann/ Greving 2017: 4ff.). Die Heimerziehung nach § 34 SBV III ist eine stationäre Maßnahme der Hilfen zur Erziehung und bietet eine 24 Stunden Betreuung der Kinder und Jugendlichen außerhalb der Familie (vgl. Rätz, Schröer & Wolff 2014: 168). Die stationären Maßnahmen der Heimerziehung werden in verschiedenen Formen differenziert.
Eine mögliche Unterbringungsform in der Heimerziehung sind die Wohngruppen eines Heims. Diese befinden sich oftmals in Einfamilienhäusern oder in Etagenwohnungen, die häufig in einer größeren Heimeinrichtungen integriert sind (vgl. Rätz, Schröer & Wolff 2014: 171). In der Regel leben dort bis zu zehn Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Alter und Geschlecht. Betreut werden sie von einem multiprofessionellen Team im Schichtdienst. Die Lebensform innerhalb der Wohngruppe wird „familienähnlich“ gestaltet, es wird von einer „familienanaloger Erziehung“ gesprochen (Heidemann/ Greving 2017: 50). Daran anknüpfend versorgen sich die meisten Wohngruppen selbst und übernehmen die alltäglichen Aufgaben wie einkaufen, putzen und kochen eigenständig (vgl. Rätz, Schröer & Wolff 2014: 171; Heidemann/ Greving 2017: 50). Die Unterbringung der Kinder und Jugendlichen erfolgt in Ein- oder Zweibettzimmern, die sie nach Bedarf gestalten können. Neben den Zimmern der Kinder und Jugendlichen sind die Wohngruppen mit einem „Wohnzimmer, Aufenthaltsraum, Esszimmer, Küche, Bad und Toilettenräumen“ ausgestattet. Die Räumlichkeiten ähneln ebenfalls einer geregelten Wohnsituation und bieten den Kindern und Jugendlichen genügend Freiräume (vgl. Heidemann/ Greving 2017: 50).
Eine weitere Form ist die Heilpädagogisch-therapeutische Intensivstation, die sich durch einen besonders strukturierten Alltag sowie durch therapeutische Zusatzangebote (therapeutisches Milieu) für Kinder und Jugendliche kennzeichnet (Rätz, Schröer & Wolff 2014: 171).
Unter familienähnliche Wohnformen sind Kinderdörfer oder Kleinsteinrichtungen zu verstehen, die oft nur aus einer Gruppe bestehen (Rätz, Schröer & Wolff 2014: 171). Auch die Unterbringung in heilpädagogischen Erziehungsstellen in privaten Haushalten wird dieser Form zugeordnet. Hierbei leben Kinder und Jugendliche „mit einem besonders intensiven Betreuungsbedarf unter professioneller Betreuung in Lebensgemeinschaft mit einer betreuenden Person und ggf. mit deren Familie“ (Rätz, Schröer & Wolff 2014: 171).
Das Heim soll ein geschützter und positiver Lebensort für die Kinder und Jugendlichen darstellen, die dort für eine bestimmte Dauer leben. Die Heimerziehung soll dabei helfen Ressourcen zu aktivieren, gemachte Erfahrungen zu verarbeiten, den Kindern und Jugendlichen Wertschätzung entgegenzubringen und neue Lebensperspektiven fördern. Dafür ist eine lebensweltorientierte Heimerziehung notwendig (vgl. Günder/ Nowacki 2020:15).
1.3 Partizipation / Elternarbeit
Der Begriff Partizipation wird von dem lateinischen Wort „participare“ abgeleitet und bedeutet Teilnahme, Teilhabe und wird als Synonym für Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung benutzt (vgl. Pluto 2007: 16). Seinen ursprünglichen gebrauch findet er in der Politik und wird als Teilhabe von Bürger*innen an „politischen Beratungen und Entscheidungen“ definiert (Schnurr 2015: 1171). In der Sozialen Arbeit wird die Partizipation erstmals im Zusammenhang mit der Sozialplanung (Bürger*innenbeteiligung) erwähnt. Eine besondere Beachtung erfährt die Partizipation in dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Im SGB Vlll § 8 ist festgelegt, dass Kinder und Jugendliche abhängig von ihrem Entwicklungsstand an alle für sie relevanten Entscheidungen mit einzubeziehen sind. Partizipation ist in der Kinder- und Jugendhilfe aber nicht nur an die Kinder und Jugendlichen gerichtet, sondern schließt auch auf die erziehungsberechtigten Eltern mit ein. Allgemein findet die Partizipation in der Sozialen Arbeit vor allem im Rahmen einer Beteiligung von potenziellen Klient*innen an Entscheidungen über Angebote und Leistungen, sowie bei der Wahlfreiheit auf unterschiedliche Formen der Leistungserbringung statt (vgl. Schnurr 2015: 1171). Partizipation hat verschiedene normative Gradmesser, sie reicht von „Fremdbestimmung“ bis hin zur „Selbstbestimmung“ und ist abhängig von den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie die den Konzepten der jeweiligen Einrichtungen (vgl. Schurr2015 1177 f.; Wolff 2014: 437).
In der Fachliteratur existieren unterschiedliche Annahmen von Elternarbeit, sodass keine einheitliche Definition festgelegt ist. Elternarbeit wird oft mit Angehörigenoder Familienarbeit gleichgesetzt und ist ein Sammelbegriff unter anderem für Beratung, Beziehungspflege und therapeutische Verfahren (vgl. Norman 2018: 17). Dabei wird sie als systemischer und zielgerichteter geplanter Kontakt mit den Personenberechtigten und Familien definiert und soll den Erfolg der pädagogischen Maßnahmen erhöhen. Der Kontakt mit den Eltern orientiert sich immer am Einzelfall und jede konzeptuelle Umsetzung wird individuell gestaltet. In einzelnen Definitionen wird bereits jeder formlose Kontakt oder jedes Gespräch als Elternarbeit betitelt (vgl. ebd.: 18).
Elternarbeit wird unterschiedlich ausgeübt und lässt sich in drei Arbeitsformen unterscheiden. Dazu zählen erstens die „Kooperationsansätze“ die auf eine Gestaltung der Zusammenarbeit abzielen, zweitens die Elternberatungen oder Elterntrainings, die eine eindringlichere Form darstellen und drittens die intensivste Arbeits- form. Hierbei handelt es sich um „therapeutischen Familieninterventionen“,beide- nen es verschiedene Methoden gibt. Diese werden in implizite, das bedeutet ungeplante und absichtslose sowie explizite, geplante Methoden differenziert (vgl. Schulze-Krüdener/ Homfeldt 2013: 255).
2. Theoretischer Hintergrund
In diesem Kapitel findet eine professionsbezogene Einordnung der Sozialen Arbeit in der Heimerziehung statt. Dafür werden die historische Entwicklung, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Ziele der Heimerziehung dargestellt. Anschließend wird die Elternarbeit näher betrachtet, indem eine Begründung der Elternarbeit sowie die Formen, Ziele und Konzepte dargestellt werden. Zuletzt werden aktuelle Forschungsbefunde und die Relevanz für die Soziale Arbeit thematisiert.
2.1 Professionsbezogene Einordnung Sozialer Arbeit in der Heimerziehung
Die stationäre Jugendhilfe hat sich aus den ursprünglich seit dem 16. Jahrhundert in Deutschland bestehenden Waisenhausanstalten entwickelt (vgl. Winkelmann 2014: 73). Diese orientierten sich meistens an einer christlichen Anstaltserziehung, die sich durch unmenschliche Lebensbedingungen sowie eine mangelnde Vorbereitung der Kinder und Jugendlichen auf ein selbstständiges Leben kennzeichnen lässt (vgl. Winkelmann 2014: 73). Zu dem mussten die Kinder und Jugendlichen bis zu den Heimreform in den 1970er und 1980er Jahren ihren Lebensunterhalt, beispielsweise durch Torf stechen, selbst verdienen (vgl. Winkelmann 2014: 73). Die Reform wurde durch eine Studierendenbewegung initiiert, die mit Hilfe von Medien gegen die Anstaltserziehung postulierten (vgl. Winkelmann 2014: 73). Winkelmann (2014: 73) nennt folgende Forderungen zur Reform der Heimerziehung:
- Abschaffung repressiver, autoritärer Erziehungsmethoden,
- die Verringerung der Gruppengröße,
- tarifgerechte Entlohnung sowie Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten für Heimerzieher*innen und
- die Abschaffung von Stigmatisierungsmerkmalen, wie zum Beispiel Anstaltskleidung, Heime in abgelegenen Lagern etc.
Des Weiteren etablierte sich in den 1970er Jahren die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien, woraus eine Reduzierung der Heimplätze resultierte (vgl. Winkelmann 2014: 74). Winkelmann (2014: 74) beschreibt, dass lediglich die Kinder, die bereits in Pflegeverhältnissen gescheitert waren und als stark problembelastet galten, in Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht werden sollten. Zugleich fand in den 1970er und 1980er Jahren die Auflösung von Erziehungsanstalten statt, wodurch Heimgruppen in andere Häuser und Städte verlegt, Außenwohngruppen sowie selbstständige Wohngemeinschaften geschaffen und erste Formen des Betreuten Wohnens eingeführt wurden (vgl. Günder 2014: 132; Günder & Nowacki 2020: 75). Die Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) fand deutschlandweit am 01.01.1991 statt (vgl. Günder 2014: 133; Winkelmann 2014: 74; Struck 2016: 666).
Das aktuelle KJHG bezieht sich auf das SGB VIII und umfasst das Recht auf Erziehung, Elternverantwortung und Jugendhilfe. Im § 1 SGB VIII wird in den ersten beiden Absätzen das Recht des jungen Menschen „auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ sowie das Recht und die Pflicht der Eltern „zur Pflege und Erziehung der Kinder“ geregelt. Der dritte Absatz beschreibt die Aufgaben der Jugendhilfe zur Verwirklichung der beiden vorangehenden Absätze (vgl. Rätz, Schröer & Wolff 2015: 59). Die Hilfeformen innerhalb der Heimerziehung sind in den §§ 27 bis § 35 SGB VIII festgelegt. Im Kontext dieser Hausarbeit ist insbesondere die Hilfemaßnahme nach dem SGB VIII § 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen relevant. Hierbei stehen vor allem die Stabilisierung und Unterstützung des Kindes bzw. des Jugendlichen im Fokus, welche durch pädagogische und therapeutische Angebote im Alltag umgesetzt werden sollen (Schumacher 2016: 17).
Das primäre Ziel der Sozialen Arbeit in stationären Einrichtungen ist die Rückführung des Kindes bzw. des Jugendlichen in die Herkunftsfamilie (vgl. Günder 2014: 133). Für das Handlungsfeld der Heimerziehung in der Sozialen Arbeit bedeutet dies, die Versorgung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen für eine gewisse Dauer in einer familienähnlichen Form zu übernehmen. Sowohl die zu betreuenden Kinder und Jugendlichen als auch ihre Eltern sind in ihrem Leben schon oft auf Ablehnung und Abwertung gestoßen, sodass sie ein Gespür für negative Haltungen haben (Winkelmann 2014: 145). Für die Soziale Arbeit ist es hierbei bedeutsam, den Familien eine alternative Erfahrung zu ermöglichen und ihnen mit einer wertschätzenden Haltung in jeglichen Situationen zu begegnen (Winkelmann 2014: 145). Es ist notwendig diese wertschätzende Haltung kontinuierlich beizubehalten, da Eltern und Kinder erst einmal Zeit benötigen, um diese für sich annehmen zu können (Winkelmann 2014: 145). Für die Soziale Arbeit folgt daraus ein hoher Stellenwert für die Beziehungs- und Bindungsarbeit innerhalb der Heimerziehung (Winkelmann 2014: 145). Auch die Berücksichtigung der jeweiligen Lebensgeschichten bzw. -umständen ist von großer Bedeutung. So sollte den individuellen Lebensgeschichten mit Respekt entgegengetreten werden, da diese ein besseres Verstehen der bisherigen Handlungsweisen von Kindern und Eltern ermöglichen (Winkelmann 2014: 146). Das Primäre Ziel der Rückführung kann nicht immer realisiert werden, sodass es teilweise zu kleineren Zielsetzungen kommt, denen gleichwohl eine enorme Wichtigkeit zugesprochen wird. Weitere Ziele der Elternarbeit im Bereich der Heimerziehung sind die Unterstützung in der Entwicklungsförderung des Kindes und die Stärkung der Herkunftsfamilie durch die systematische Betrachtungsweise. Außerdem sollen die elterlichen Erziehungskompetenzen erweitert sowie die Beziehung zwischen Eltern und Kind gefördert werden (vgl. ebd. 146f.).
2.2 Notwendigkeit der Elternarbeit
Eine Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen erfolgt, wenn Eltern ihre Erziehungsrechte- und Pflichten aus verschiedenen Gründen kurz- oder langfristig nicht angemessen ausüben können (Rätz, Schröer & Wolff 2014: 171). In der Regel erfolgt eine Unterbringung in der Heimerziehung mit Einverständnis der Eltern und wird nur in Ausnahmefällen durch ein Vormundschaftsgericht beschlossen (Rätz, Schröer & Wolff 2014: 172). Nach dem statistischen Bundesamt wurde ein Drittel der Unterbringung in der Heimerziehung im Jahr 2018 von der Familie selbst initiiert (Günder & Nowacki 2020: 41). Nach § 5 SGB VIII verfügen Eltern und Erziehungsberechtigte über ein Wunsch- und Wahlrecht im Hinblick auf den Träger, die Unterbringung und die Hilfegestaltung (vgl. Albus 2012: 478; Günder 2014: 134).
Die Eltern- und Familienarbeit ist im SGB VIII verbindlich geregelt und zielt in erster Linie auf die Rückführung des Kindes bzw. des Jugendlichen in die Herkunftsfamilie ab (vgl. Günder 2014: 133; Günder & Nowacki: 218). Auch wenn das Ziel der Rückführung nicht erreicht werden kann, ist die Arbeit mit den Eltern von Bedeutung und betrifft insbesondere grundlegende Entscheidungen sowie die Lebensperspektive und Entwicklung des Kindes (vgl. Günder 2014: 133; Günder & Nowa- cki 2020: 218). Voraussetzung ist, dass durch die Beziehung zwischen Kindern und Eltern nicht das Kindeswohl gefährdet ist (Günder & Nowacki 2020: 218). Dem entsprechend sind auch Eltern an der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII vor und während der Gewährung zur Hilfe beteiligt und können über den Hilfeverlauf mitentscheiden (vgl. Matzner & Munsch 2014: 211; Günder & Nowacki 2020: 218). Obwohl im SGB VIII eine kontinuierliche und qualitätsorientierte Elternarbeit betont wird, ist die Umsetzung in der Realität nicht immer möglich und begrenzt sich oftmals lediglich auf die alleinige „Kontaktpflege“ (vgl. Günder 2014: 133). Die Elternarbeit mit ihren „Anforderungen einer zielgerichteten und methodisch abgesicherten Vorgehensweise“ setzt „ein hohes Maß an Professionalität und Arbeitsaufwand“ der Fachkräfte voraus (Günder 2014: 133).
Obwohl die Versorgung der Kinder durch die Eltern unzureichend ist, sind die Eltern die wichtigsten Bezugspersonen für die Kinder. (vgl. Schleiffer 2015: 11). Die Fremdunterbringung ist für die Kinder als auch für die Eltern ein kritisches Lebensereignis, das einen Bindungsabbruch und emotionalen Stress mit sich bringt (vgl. ebd.) Für die Beteiligten ist unklar, wie die Bindungsbedürfnisse in absehbarer Zeit befriedigt werden. Deswegen wird der Bindungstheorie von John Bolwby einen hohen Stellenwert bei der Begründung zur Notwendigkeit von Elternarbeit zugesprochen (vgl. ebd.) In der Theorie wird davon ausgegangen, dass Bindung aktiviert wird, wenn das Kind einer kritischen Situation oder einer Gefahr, wie z.B. Angst, Höhe oder einem plötzlichen Reizwechsel ausgesetzt ist (vgl. ebd.: 30). Ab dem vierten Lebensmonat wird die Bindungsbeziehung zwischen dem Kind und der Bezugsperson aufgebaut und die Bindungsbedürfnisse bleiben ein Leben lang bestehen (vgl. ebd. 30 ff.). Unterschieden wird dabei in die vier verschiedenen Bindungssysteme: Sicher gebunden, Unsicher-vermeidend gebunden, Unsicher-ambivalent gebunden und Unsicher-desorganisiert gebunden (vgl. ebd.: 34ff.). Bei der von Hans Thiersch durchgeführten „Evaluationsstudie zu stationären und teilstationären Erziehungshilfen“ JULE stellte sich heraus, dass bei 67% der Kinder in diesen Einrichtungen eine gestörte „Eltern-Kind-Beziehung“ vorlag (Schleiffer 2015: 108).
Eine weitere entscheidende Theorie zur Notwendigkeit von Elternarbeit ist das Konzept der Lebensweltorientierung, die als Leitnorm im SGB VIII verankert ist (vgl. Günder 2014: 131). Als Lebensweltorientierung werden die Unterstützung der alten Kontakte und eine Unterbringung in der Nähe des ehemaligen Wohnorts definiert (vgl. ebd.) Elternarbeit soll dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche von ihrer Familie nicht entfremdet werden, weshalb das pädagogische und beratende Angebot nach den Lebenswelten von Kindern und Eltern ausgerichtet wird (vgl. Günder 2014: 134; Günder & Nowacki 2020: 218f.). Das bedeutet, dass die Eltern dort abgeholt werden, wo sie sich befinden.
[...]