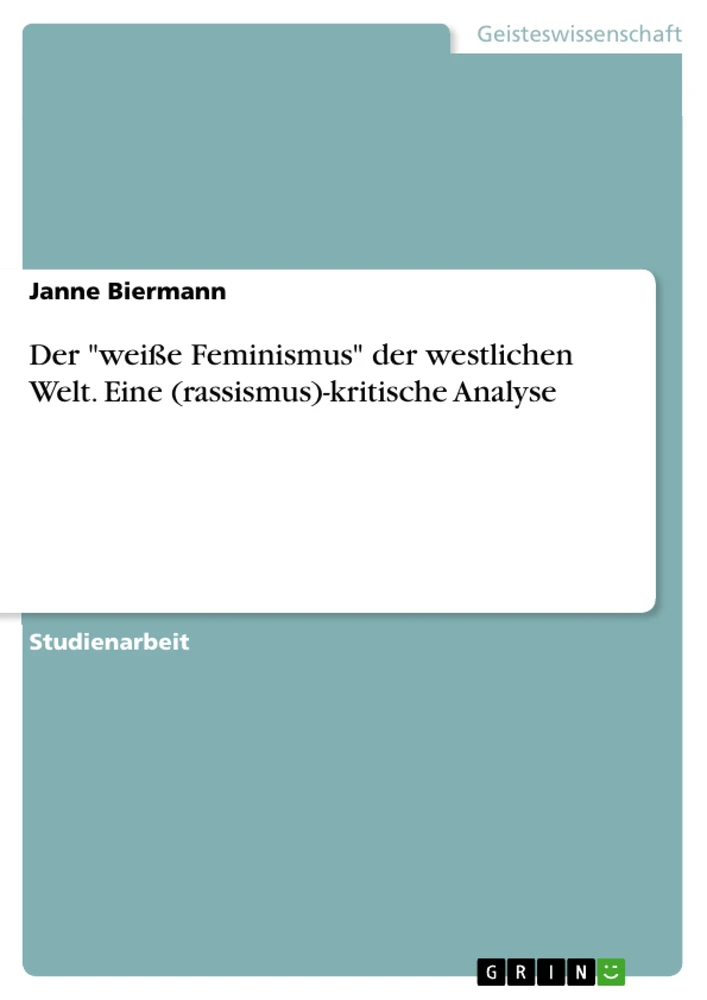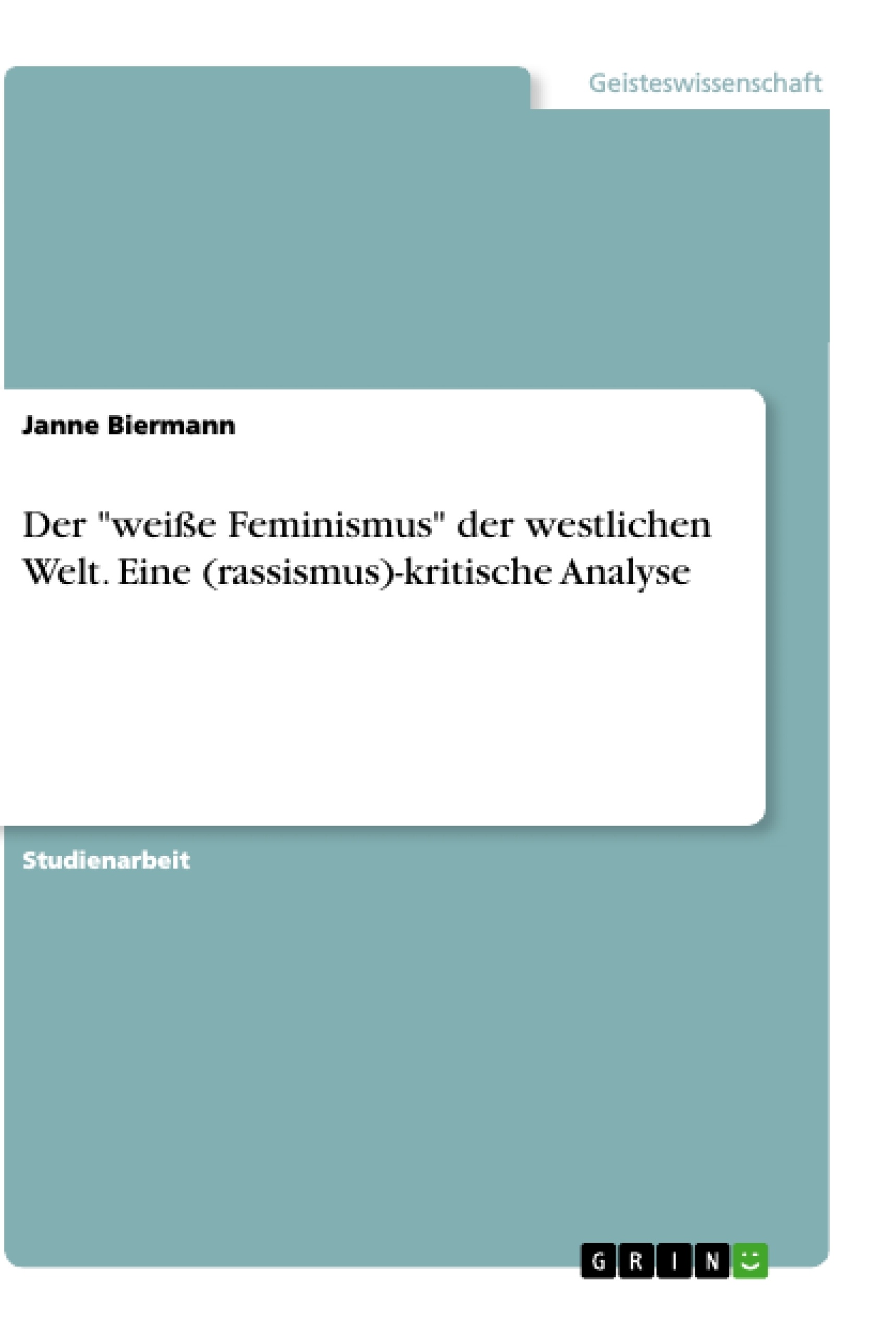In dieser Ausarbeitung soll eine (rassismus)-kritische Analyse des weißen Feminismus der westlichen Welt stattfinden. Zunächst werden die Begriffe Rassismus und Feminismus definiert, um dahingehend einen kurzen Überblick zur Geschichte des Feminismus/ der Feminismen zu erhalten. Anschließend soll der „weiße Feminismus“ und die Strömungen dessen erläutert werden. Darauf folgt die Kritik am „weißen Feminismus“ und die Darstellung der Problematik des Weiß-Seins als rassistisches Konstrukt.
Im Zusammenhang mit der Kritik wird abschließend die Entstehung des intersektionalen Feminismus aufgezeigt und ein Fazit gezogen. Schaut man sich Texte oder Bilder zur Geschichte des Feminismus in der westlichen Welt an, entdeckt man meist weiße Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen, insbesondere aber aufgrund des Kampfes gegen das Patriarchat und für eine Gleichstellung aller Geschlechter, motiviert waren, sich einzusetzen. In den 1970er Jahren wurden allerdings Stimmen von Schwarzen Frauen und Women of Color laut, die sich von diesen, bis dato mehrheitlich weißen Strömungen, nicht repräsentiert fühlten.
Diese kritisierten insbesondere, dass weiße Frauen sich nicht in die Rassismus-Erfahrungen der Schwarzen Frauen und Women of Color hineinversetzen könnten und dennoch innerhalb der Feminismen für alle Frauen sprechen würden. Das führte vor allem in den letzten Jahren immer wieder zu Diskussionen um Mehrfachdiskriminierung (Intersektionalität) und Rassismusvorwürfen innerhalb der weißen Feminismen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Was ist (moderner) Rassismus?
2.1 Ebene 1: Struktureller Rassismus
2.2 Ebene 2: Institutioneller Rassismus
2.3 Ebene 3: Individueller Rassismus
2.4 Alltagsrassismus
3. Was ist Feminismus?
3.1 Abriss der Geschichte
3.2 Was ist „weißer Feminismus“?
3.3 Strömungen des „weißen Feminismus“
4. Kritik am „weißen Feminismus“
4.1 Weiß-Sein als rassistisches Konstrukt
4.2 Intersektionaler Feminismus
5. Fazit
Literaturverzeichnis
Anhänge
1. Einleitung
Schaut man sich Texte oder Bilder zur Geschichte des Feminismus in der westlichen Welt an, entdeckt man meist weiße Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen, insbesondere aber aufgrund des Kampfes gegen das Patriarchat1 und für eine Gleichstellung aller Geschlechter, motiviert waren, sich einzusetzen. In den 1970er Jahren wurden allerdings Stimmen von Schwarzen Frauen und Women of Color laut (Definition in Punkt 3.2.), die sich von diesen, bis dato mehrheitlich weißen Strömungen, nicht repräsentiert fühlten. Diese kritisierten insbesondere, dass weiße Frauen sich nicht in die Rassismus-Erfahrungen der Schwarzen Frauen und Women of Color hineinversetzen könnten und dennoch innerhalb der Feminismen für alle Frauen sprechen würden. Das führte vor allem in den letzten Jahren immer wieder zu Diskussionen um Mehrfachdiskriminierung (Intersektionalität) und Rassismusvorwürfen innerhalb der weißen Feminismen.
In dieser Ausarbeitung soll eine (Rassismus)-kritische Analyse des weißen Feminismus der westlichen Welt stattfinden. Zunächst werden die Begriffe Rassismus und Feminismus definiert, um dahingehend einen kurzen Überblick zur Geschichte des Feminismus/ der Feminismen zu erhalten. Anschließend soll der „weiße Feminismus“ und die Strömungen dessen erläutert werden. Darauf folgt die Kritik am „weißen Feminismus“ und die Darstellung der Problematik des Weiß-Seins als rassistisches Konstrukt. Im Zusammenhang mit der Kritik wird abschließend die Entstehung des intersektionalen Feminismus aufgezeigt und ein Fazit gezogen.
2. Was ist (moderner) Rassismus?
Rassismus wird als ein Machtgefälle zwischen zwei Gruppen beschrieben, in der sich eine Gruppe von der anderen aufgrund von unsystematischen Kriterien (Herkunft, Kultur, Hautfarbe) von der Anderen abwendet. Das passiert insbesondere dann, wenn soziale, politische oder ökonomische Entscheidungen und Aktionen einer Gruppe legitimiert werden müssen, mit dem angestrebten Ziel Privilegien im Hinblick auf Ressourcen zu erhalten. Konkret: Eine Gruppe rechtfertigt durch Rassismus eine Vormachtstellung gegenüber einer anderen Gruppe. Begründet wird das durch die Zuschreibung von Menschen zu einer „Rasse“ und die Klassifizierung dieser (vgl. Barskanmaz 2019: S.19f./ Rommelspacher 2009: S.25). „Rasse“ als veralteter und heute diskriminierender Begriff meint eine „Bevölkerungsgruppe mit bestimmten gemeinsamen biologischen Merkmalen“ (Duden 2021) und gilt als soziales Konstrukt, welches das Weiß-Sein und Schwarz-Sein als Extrempole beinhaltet, welche wiederum durch Rassismus entstanden sind. Die Vormachtstellung kann sich als soziales Phänomen innerhalb einer Gesellschaft fest verankern und erhebliche Nachteile für die Betroffenen mit sich bringen (vgl. Barskanmaz 2019: S.19f.). Die Geschichte des modernen Rassismus reicht bis in das 18. Jahrhundert zurück. Die Erarbeitung und Verbreitung pseudo- wissenschaftlicher Theorien und Ideologien zu „Rasse“ und Rassismus resultierte nicht selten in einer hohen Anzahl von Todesopfern. Diese historische Entwicklung beinhalt gleichsam nicht, dass Rassismus als vergangene Problematik anzusehen ist. Vielmehr ist Rassismus allgegenwärtig, ob auffällig oder unbemerkt- es existieren Bewegungen und Ideologien, die sich gegen Diversität aussprechen und Personen und Gemeinschaften als „Rassen“ abstufen (vgl. Zick 2020: S.125). Das Vorkommen des Rassismus wird häufig in drei Ebenen gegliedert, die nachfolgend verkürzt dargestellt werden sollen. Dahingehend wird auch der Begriff des „Alltagsrassismus“ erläutert.
2.1 Ebene 1: Struktureller Rassismus
Struktureller Rassismus ist häufig nicht von außen erkennbar. Es handelt sich dabei um rassistische Strukturen und Abläufe von Entscheidungen, die durch die historische Entwicklung der Gesellschaft („gesellschaftliches System“) und damit verbundene Routinen oder Traditionen zustande kommen. Diese Gebräuche resultieren in Vorteilen oder Nachteilen für bestimmte Gruppen innerhalb einer Gesellschaft (z.B. Benachteiligung in der Schule aufgrund unterschiedlicher Sprachniveaus). Der strukturelle Rassismus schließt den nachfolgend erläuterten institutionellen Rassismus ein (vgl. Rommelsbacher 2009: S. 30f.).
2.2 Ebene 2: Institutioneller Rassismus
Der institutionelle Rassismus ist, wie der Name schon sagt, von Institutionen/ Organisationen aus und greift mit dem strukturellen Rassismus ineinander. Die Organisationen können staatlicher sowie nicht staatlicher Art sein und unterstützen durch ihr Handeln oder eben Nicht- Handeln Benachteiligungen und Diskriminierungen (z.B. Vorurteile, Ignoranz, rassistische Stereotypen) von Gruppen aufgrund ihrer Hautfarbe, Kultur, Religion und/ oder ethnischen Herkunft. Nicht- Handeln äußert sich dann in dem Nicht- Erbringen angemessener Angebote, die eine Benachteiligung verhindern würden (z.B. Racial- Profiling, also dem polizeilichen Kontrollieren einer Person aufgrund des äußerlichen Erscheinungsbildes) (vgl. Barskanmaz 2019: S.61ff.).
2.3 Ebene 3: Individueller Rassismus
Der individuelle Rassismus basiert auf der Interaktion zwischen den Individuen einer Gesellschaft und findet auf der persönlichen Ebene statt. Diese Form von Rassismus beruht auf den individuellen Sichtweisen und Handlungen einer Person, die durch Vorurteile und Stereotype über Minderheiten geprägt sein können (z.B. öffentliche rassistische Äußerungen einer prominenten Person) (vgl. Rommelsbacher 2009: S.30f.).
2.4 Alltagsrassismus
Der Begriff des Alltagsrassismus wurde von der Professorin für kritische „Rassen“-, Geschlechts- und Führungslehre Philomena Essed (1984) entwickelt und hat sich mittlerweile in Rassismusdiskursen etabliert. Ihre Definition dessen ist folgendermaßen:
„Given these arguments, everyday racism can be defined as a process in which (a) socialized racist notions are integrated into meanings that make practices immediately definable and manageable, (b) practices with racist implications become in themselves familiar and repetitive, and (c) underlying racial and ethnic relations are actualized and reinforced through these routine or familiar practices in everyday situations“ (Essed 1991: S.52).
Nach Essed ist Alltagsrassismus also ein Prozess, der zunächst die aus der Sozialisation entstandenen rassistischen Begriffe in den Alltag integriert und durch die Personen dann „praktisch“ umgesetzt wird. Diese praktische Umsetzung verläuft wederholend und immer gewohnter, was zur Folge hat, dass die diesem Verhalten zugrunde liegenden rassistischen und ethischen Vorstellungen durch die Routine in alltäglichen Situationen aktualisiert und verstärkt werden und sich dann in einer Gesellschaft festigen. Alltagsrassismus kann sowohl strukturell, institutionell als auch individuell auftreten.
3. Was ist Feminismus?
Der Begriff Feminismus meint im Allgemeinen verschiedenartige Konzepte. Eine Unterscheidung kann grundsätzlich aufgrund der unterschiedlichen Adressaten und Adressatinnen, Gründer*innen, die Entwicklung und Historie der Ideen und Vorhaben und/ oder der thematischen Zusammenhänge unternommen werden (vgl. Thiessen 2008: S. 38). Deutlich spezifischer begründet Ilse Lenz (2019) die gegenwärtige Diversität in Bezug auf Feminismen. Sie gliedert diese in drei wesentliche Zusammenhänge: Historisch (in Abhängigkeit von den gesellschaftlichen und politischen Umständen), räumlich (die Ortsabhängigkeit und die dortigen Gegebenheiten) und thematisch (unterschiedliche Geschlechterkonzepte, Theorien und gesellschaftliche Grundfragen) (vgl. Lenz 2019: S. 232). Aufgrund dessen bestehen gegenwärtig eine Vielzahl an Feminismen, die verschiedene Interessen und Ansprüche verfolgen und durchsetzen wollen. Diese beeinflussen sich gegenseitig, lokal, national und weltweit. Als wesentliche Gemeinsamkeit gilt dennoch das Ursprungsinteresse feministischen Handelns, das den Anspruch hat, eine Unterordnung der Gruppe der Frauen gegenüber Männern zu unterbinden und eine Gleichstellung zu ermöglichen. Dieses Interesse soll durch eine Umstrukturierung von politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Prozessen ermöglicht werden und so zu einer Veränderung bzw. Verbesserung der Lebensumstände von Frauen führen (vgl. Thiessen 2008: S.38).
3.1 Abriss der Geschichte
Die Geschichte des Feminismus wird häufig in drei Wellen beschrieben, die vom 18. Jahrhundert bis in die heutige moderne reichen. Wie im vorherigen Punkt beschrieben, verlief die Entwicklung im Hinblick auf die räumlichen/ örtlichen Gegebenheiten und die daraus resultierenden, verschiedenen und vielfältigen Umstände, unterschiedlich. An dieser Stelle wird der Versuch unternommen, einen kurzen Überblick über die westliche Entstehung und Geschichte des Feminismus, bzw. der Feminismen zu geben.
Im 15. und 16. Jahrhundert wurde in der Zeit des Umbruchs vom Mittelalter zur Neuzeit insbesondere lyrisch die Thematik „Frau“, ihre Funktion und untergeordnete Position gegenüber Männern erörtert und diskutiert. Ein positiver Effekt für die Frauen blieb aufgrund der eher oberflächlichen Abhandlung aus (Duprés 2013: S.88). Die erste Welle der Frauenbewegung begann im 18. Jahrhundert und wurde durch die Vorstellung der Gleichheit der Menschen und den Gedanken der Aufklärung der Französischen Revolution (1789) beeinflusst. Die französische Frauenrechtlerin Olympe de Gouges gilt mit dem Verfassen der „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ (1791) als Pionierin der Frauenbewegung (vgl. von Bargen 2018: S.9). In England folgte Mary Wollstonecraft im selben Jahr mit der Schrift „Verteidigung der Frauenrechte“, die nach Duprè (2013) der Überzeugung war, dass Frauen unter denselben Bedingungen wie Männer, den gleichen Bildungsstand sowie die gleichen Fähigkeiten ausbilden könnten. In dieser Zeit entstanden zwei erste unterschiedliche Bewegungen der Frauen: Eine bürgerliche Bewegung und eine Bewegung der Arbeiter*innenklasse (von Bargen 2018: S.9). In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde der Wille der Frauen nach Umgestaltung und Fortschritt immer stärker. Mitte des 19. Jahrhunderts erhielt die Bewegung den ersten liberalen, männlichen Verfechter zur Thematik der Gleichstellung von Mann und Frau. John Stuart Mill, britischer Philosoph und Politiker, verfasste 1869 „Die Unterwerfung der Frauen“. Darin widerspricht er nach Dupré (2013) allen Meinungen zur Überlegenheit der Männer und befürwortet eine Gleichberechtigung beider Geschlechter. Ein wesentlicher Aufschwung der Frauenbewegung begründete sich darin, dass in Europa und den USA die weiblichen Widersprecherinnen der Sklaverei die Erkenntnis hatten, dass die (politischen) Rechte, die sie für die schwarzen Mitbürger*innen forderten, die eigenen Rechte weitaus übertrafen. Das resultierte in weiteren Protesten und Einforderungen im Hinblick auf die Rechte für Frauen (vgl. Dupré 2013: S.89). So wurde durch den Vorschlag von Clara Zetkin2 1910, ein Jahr später der erste internationale Frauentag, der insbesondere durch die Forderung nach Gleichberechtigung, dem Wahlrecht für Frauen und dem Wunsch nach Selbstbestimmung, entstand. Auch Rosa Luxemburg3 setzte sich aktiv für die Umsetzung dieses Tages ein, der auch heute noch jährlich am achten März zelebriert wird (vgl. von Bargen 2018: S.9). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das wesentliche Ziel die Durchsetzung des Frauenwahlrechts (für weiße Frauen), was zu gewaltsamen Konflikten zwischen den Frauenrechtlerinnen und den zuständigen Institutionen führte. Besonders bekannt waren die Suffragetten, eine Bewegung von weißen Frauen aus der gebildeten Mittelschicht. Diese Konfliktbereitschaft der Frauen resultierte letztendlich in der Etablierung des Wahlrechts beispielsweise in Großbritannien und Deutschland (1918) und in den Vereinigten Staaten (1920). Trotz der Erweiterung der Bürgerrechte durch das Wahlrecht, bestand weiterhin ein enormer Unterschied an Rechten zwischen den Geschlechtern der westlichen Welt. Zudem beeinflussten und schwächten insbesondere die Weltwirtschaftskrise (1929-1933) und der Zweite Weltkrieg (1939- 1945) die Frauenbewegungen, die in dieser Phase zwischen dem Erfolg des Wahlrechts und den 1960er Jahren deutlich weniger aktiv waren. Die zweite Welle gilt als Spaltungsepisode des Feminismus, in der die unterschiedlichen Interessen und Ansprüche der Frauen zum Vorschein kamen. Begründet war das durch die historischen Gegebenheiten der 1960er Jahre, die als Zeit der „Bürgerrechtsbewegung, des Vietnamkrieges, der Hippiekultur und der Studentenproteste [galten]“ (Dupré 2013: S. 90). Neben klassischen und liberalen Feministinnen, deren wesentliches Ziel es war, die Gleichstellung beider Geschlechter in allen Gebieten des Lebens zu erreichen, wurden auch radikalere Stimmen laut. Diese sahen als Ziel nicht die Gleichstellung von Mann und Frau, sondern hinterfragten, ob es ein Erfolg sein und ausreichen könne, in einer männerdominierten und durch Männer strukturierten Welt die historisch etablierte Unterordnung der Frau zu überwinden (vgl. Dupré 2013: 91). Gleichzeitig entwickelte sich in den 1980er Jahren eine feministische Frauenbewegung von Schwarzen Frauen, die sich durch den vorherrschenden Rassismus und mehrheitlich „weißen Feminismus“ diskriminiert und nicht gehört fühlten. Als eine der bedeutendsten Frauen galt die afroamerikanische Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde aus den USA, die eine kontinuierliche Kommunikation zwischen weißen und Schwarzen Feministinnen durchzusetzen versuchte. Weiteres Aufsehen erreichte ein Jahrzehnt später die US- Amerikanerin Judith Butler, die 1990 „Das Unbehagen der Geschlechter“ veröffentlichte und damit eine weltweite Diskussion um die Queer-Theorie, die Zuschreibung und Identität von Geschlechtern anstieß (vgl. von Bargen 2018: S. 10). Auch Butlers Theorie repräsentiert das Selbstbewusstsein der Feministinnen, welches sich Ende des 20. Jahrhunderts und mit Beginn der dritten Welle etablierte. Es entwickelten sich neue Inhalte einer neuen Generation, die von Ironie, Frechheit und Energie geprägt war (vgl. Dupré 2013: S.91). Beispielsweise gründete sich das MISSY Magazine, das Popkultur und Feminismus verband. Hinzu kamen Debatten zum Thema Alltagssexismus (#aufschrei-Debatte) und sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen (#Metoo) im Netz (vgl. von Bargen 2018: S.13). Trotz der neuen Offenheit, dem Pluralismus im Feminismus und dem vorrangigen Ziel gemeinschaftlich als Frauen einzutreten, treten innerhalb der diversen Feminismen Differenzen auf. Eine wesentliche Thematik, die dabei häufig in Erscheinung tritt, ist die der Ansprüche und Wünsche der Schwarzen Frau, die sich durch den mehrheitlich „weißen Feminismus“ nicht ausreichend repräsentiert fühlt, auch allgegenwärtig. Einen Überblick über die Entwicklung der verschiedenen Thematiken innerhalb der Feminismen von 1977-1999 ist in Anhang A dargestellt.
[...]
1 In der derzeitigen westlichen Geschlechterordnung ist die wichtigste Achse der Macht die allgegenwärtige Unterordnung von Frauen und die Dominanz von Männern – eine Struktur, welche die Frauenbewegung als „Patriarchat“ bezeichnet hat (vgl. Connell 2015: S.127).
2 Clara Zetkin war eine sozialistisch- kommunistisch deutsche Politikerin, Friedensaktivistin und Frauenrechtlerin.
3 Rosa Luxemburg war eine einflussreiche polnisch-russische Vertreterin der europäischen Arbeiterbewegung, des Marxismus, Antimilitarismus und proletarischen Internationalismus.