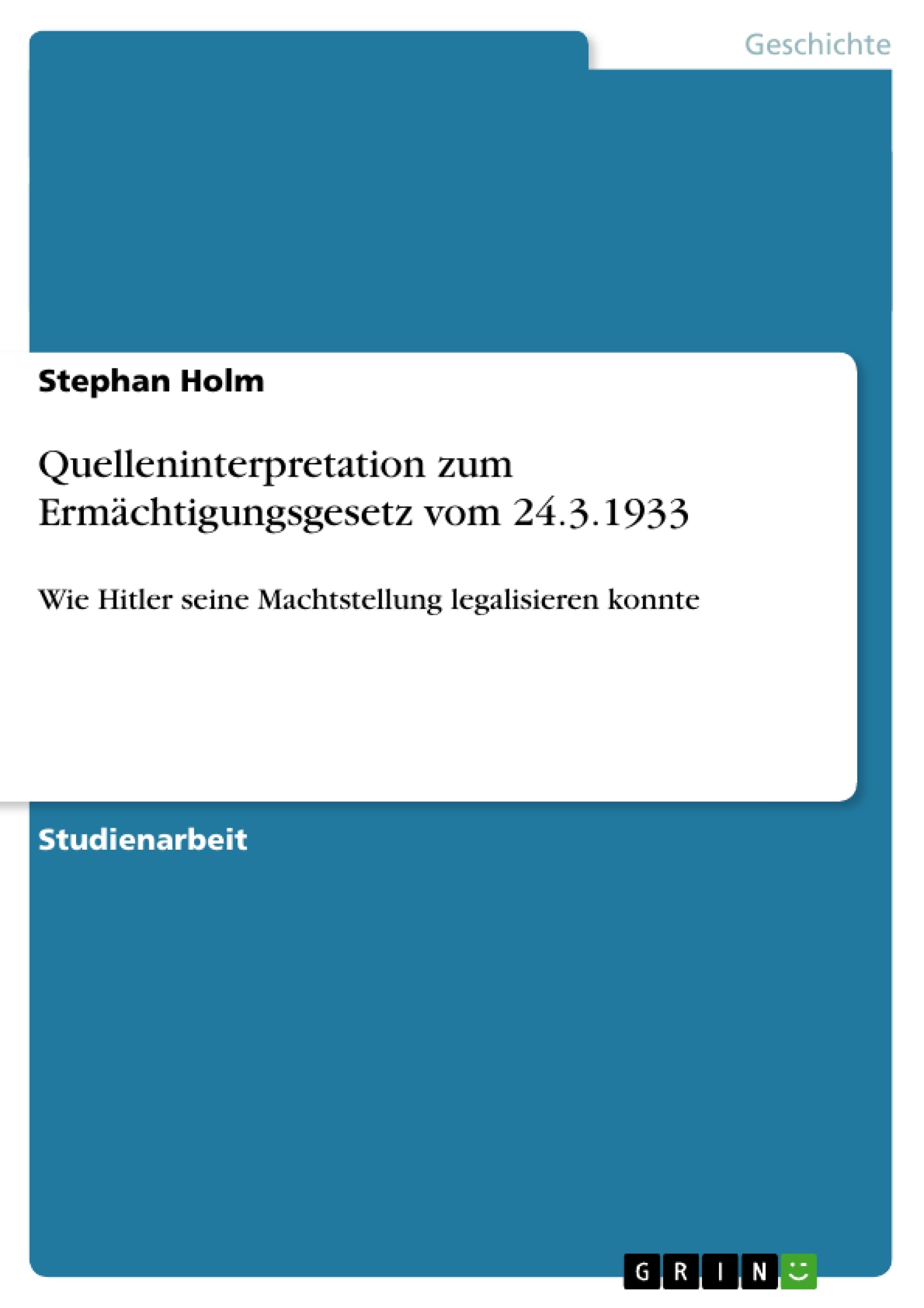Die vorliegende Quelle ist das „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Staat
(Ermächtigungsgesetz) vom 24. März 1933“, unterzeichnet vom Reichspräsidenten
von Hindenburg, Reichskanzler Adolf Hitler, Reichsminister des Innern Frick,
Reichsminister des Auswärtigen Freiherr von Neurath, Reichsminister der Finanzen
und Graf Schwerin von Krosigk. Dieses Gesetz ist für Adolf Hitler ein entscheidender
Schritt gewesen, um mit der NSDAP die uneingeschränkte Macht in Deutschland zu
erlangen. Im folgenden möchte ich die Bedeutung des Gesetzes beleuchten und
darstellen, welche historischen Ereignisse und Vorraussetzungen in der deutschen
Parteienlandschaft dazu führten, dass dieses Gesetz durchgesetzt werden konnte,
und inwiefern Hitler seine Machstellung sichern bzw. legalisieren konnte. Ferner
werden die Folgen des Gesetzes dargestellt.
[...]
Quelleninterpretation zum Ermächtigungsgesetz vom 24.3.1933
Wie Hitler seine Machtstellung legalisieren konnte
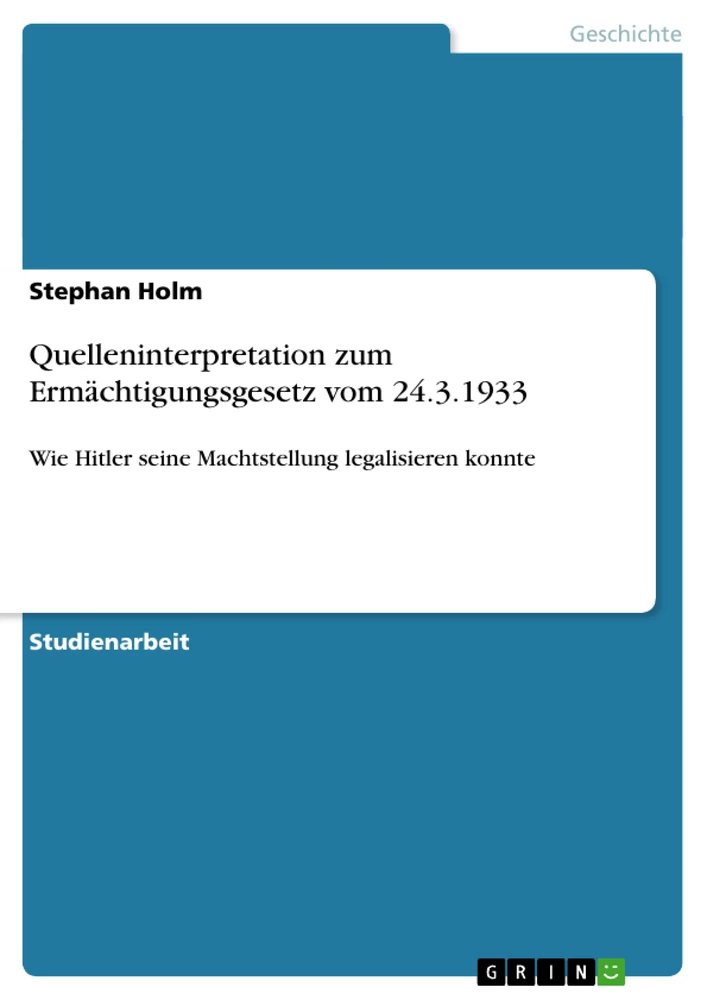
Hausarbeit , 2000 , 10 Seiten , Note: 2
Autor:in: Stephan Holm (Autor:in)
Geschichte Deutschlands - Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg
Leseprobe & Details Blick ins Buch