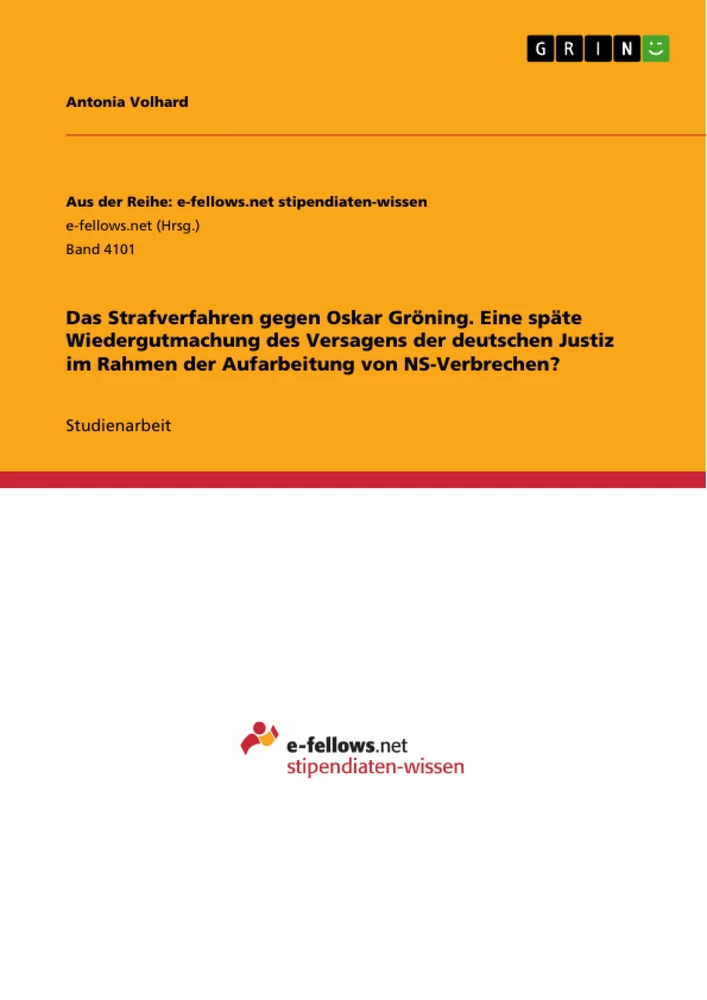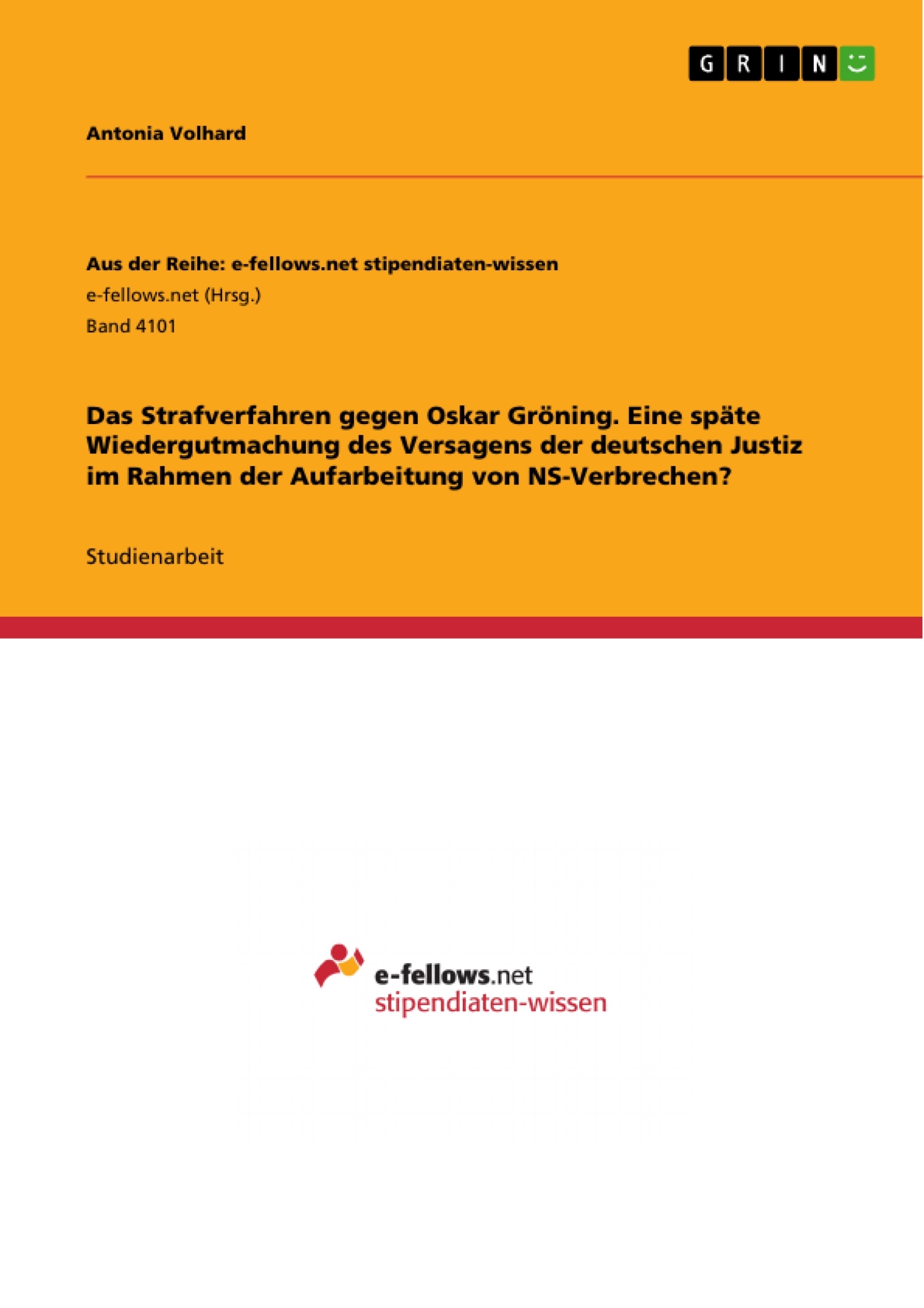Wie kam es dazu, dass Oskar Gröning für seine Taten in Auschwitz so viele Jahre nicht verfolgt wurde? Wie kann es sein, dass Gröning nicht der Einzige ist, der sich im hohen Alter noch vor den Gerichten für seine Taten vor fast 80 Jahren verantworten muss? Der Prozess gegen Oskar Gröning im Jahr 2015 gehört sicherlich zu einem der aufsehenerregendsten Prozesse der letzten Jahre. Grund dafür war nicht nur, dass Gröning wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen angeklagt war, sondern auch, dass er bei Beginn des Prozesses bereits 94 Jahre alt war. Die Frage, wieso sich ein 94-jähriger Mann noch für seine Taten als junger Erwachsener verantworten muss, wurde häufig gestellt.
Um die oben gestellten Fragen zu beantworten, wird zunächst darauf eingegangen, inwiefern die Verbrechen aus der NS-Zeit überhaupt aufgearbeitet wurden. Weiterhin wird geklärt, ob der Prozess gegen Gröning eine „Wiedergutmachung“ für ein mögliches Versagen der deutschen Justiz ist. Dabei sind für die Entwicklung des Verfahrens gegen Gröning während der bundesdeutschen Teilung lediglich die Zustände in Westdeutschland relevant. Zudem war der Fall Gröning auch insoweit besonders, als dass seine Handlungen in Auschwitz nicht eindeutig als Beihilfehandlung zu den Tötungen zu qualifizieren waren.
Es wird daher auch auf die Frage eingegangen, ab wann ein Verhalten als strafrechtlich relevante Beihilfe einzuordnen ist. Dabei soll zum einen auf den Vergleich zwischen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Frankfurter Auschwitzprozess von 1969 und der Rechtsprechung von 2016 eingegangen werden, und zum anderen auf die Frage, was als Haupttat im Rahmen des Holocausts zu werten ist.
INHALTSVERZEICHNIS
A) Einleitung
B) OskarGröning
I) Kindheit(1921 - 1939)
II) NS-Zeit
III) Die Jahre vonl945 bis2015
C) VerfolgungvonNS-Unrecht
I) Die Zeit unmittelbar nach dem Krieg
II) Der Ulmer Einsatzgruppenprozess
III) Die Verjährung von Mord und Totschlagstaten
IV) Der Auschwitzprozess von Frankfurt
V) Das Verfahren gegen John Demjanjuk
D) Die Ermittlungen gegen Oskar Gröning
I) Ermittlungsverfahren von 1977
II) Wiederaufnahmeanregung 2005
III) Wiederaufnahmeanregung von 2011
IV) Ermittlungsverfahren ab2013
E) Der Prozess vor dem Landgericht Lüneburg
I) ProzessualeVorfrage
II) Tatvorwurf
1) Teilnahmefähige Haupttat und Beihilfehandlung
(a) WegdesLandgerichts
(b) Einzeltatbezogene Begründung der Haupttat
(i) Rampendienst
(ii) Tätigkeiten in der Häftlingsgeldverwaltung
(iii) Folgen der einzeltatbezogenen Betrachtung
(c) Gesamttatbezogene Begründung der Haupttat
(d) Vereinbarkeit mit den Grundsätzen der Beihilfe
2) SubjektiveVoraussetzung
Ill) Strafe
F) Folgen des Prozesses
I) Revisionsgründe
1) Verfahrensrügen
(a) Verfahrensverzögerung
(b) Kronzeugenregelung
2) Sachrüge
II) Haftfähigkeit
G) Fazit