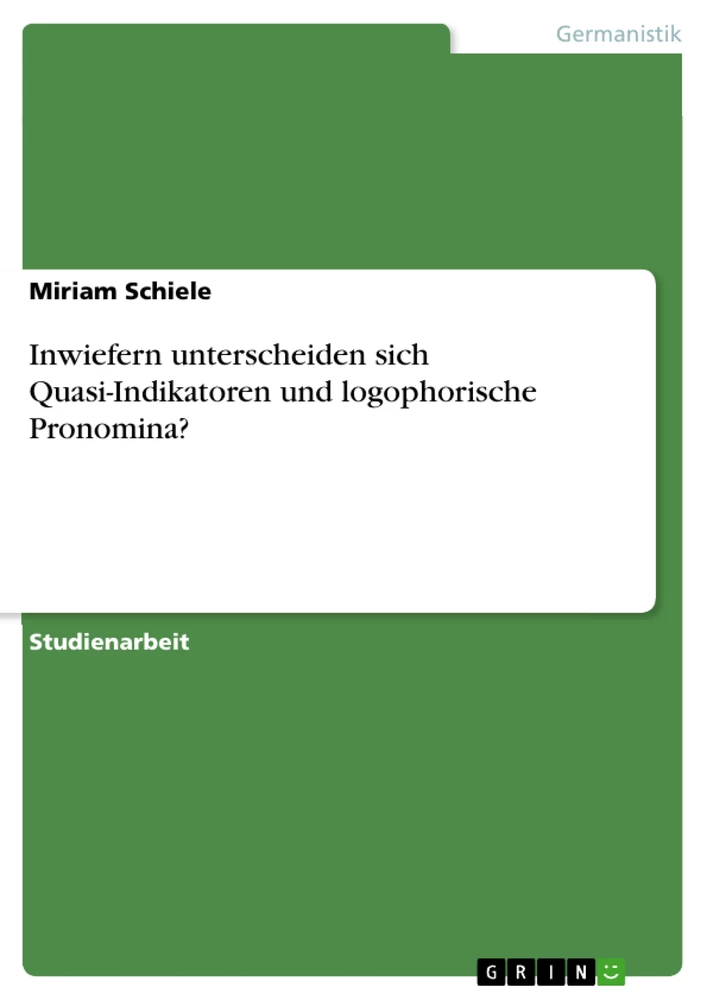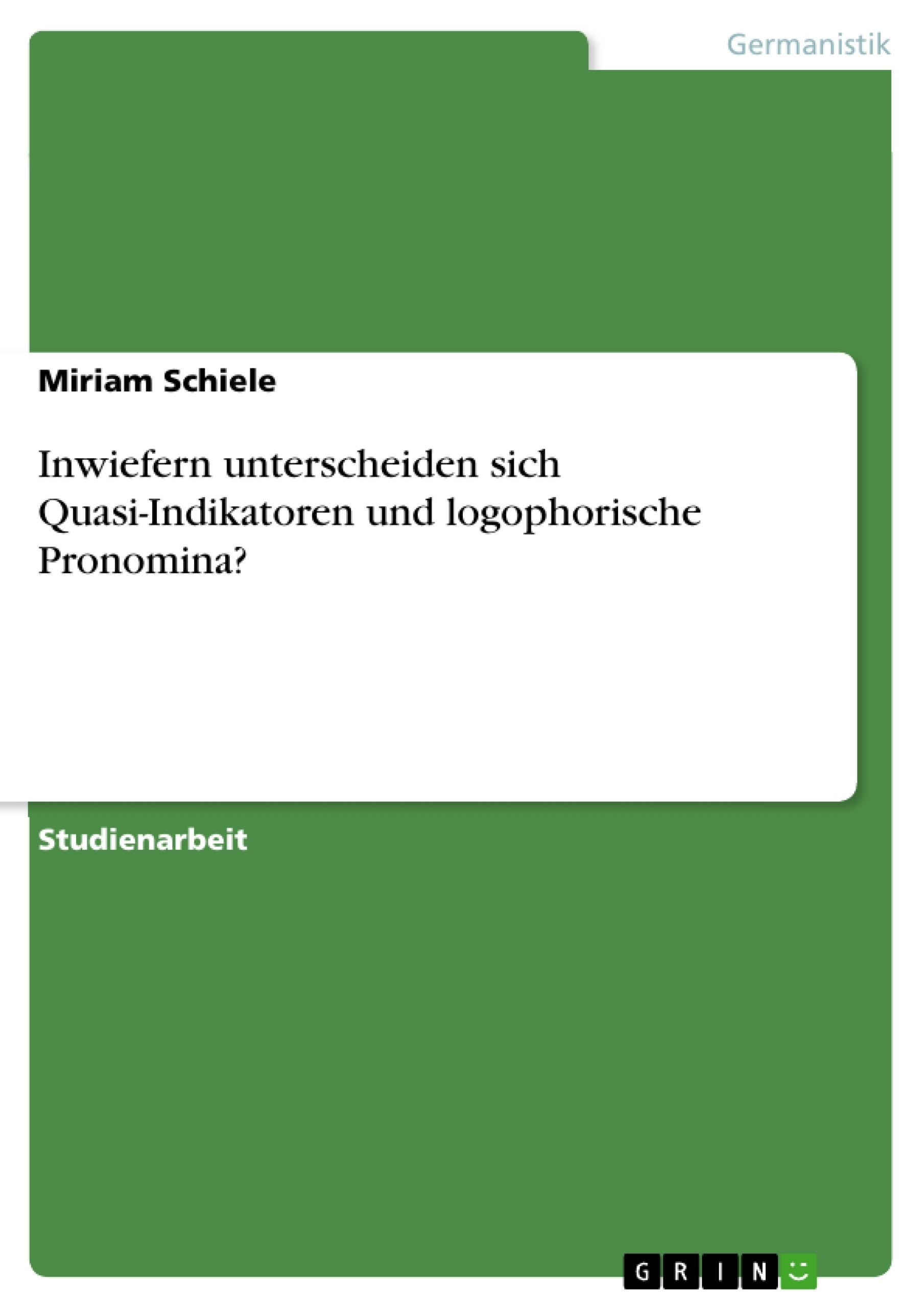Inwiefern unterscheiden sich Quasi-Indikatoren und logophorische Pronomina? Um diese Frage zu beantworten, werden zunächst die beiden Begriffe erläutert und die Merkmale der beiden Phänomene betrachtet. Mittels empirischer Untersuchungen verschiedener Sprachen sollen die Eigenschaften und Verwendungsweisen von Quasi-Indikatoren und logophorischer Pronomina hinsichtlich ihrer formalen Eigenschaften, Referenzen und Lesarten miteinander verglichen werden.
In der direkten Rede ist die Bedeutung eines Indikators im Regelfall eindeutig, wohingegen in der indirekten Rede, insbesondere wenn der Sprecher versucht, eine Überzeugung einer ausstehenden Person zuzuschreiben, Problematiken auftreten können. Dieser Perspektivwechsel wird durch verschiedene Ausdrücke erzeugt, die sich je nach Sprache bzw. ebenso innerhalb von Sprachen je nach Verwendungsweise unterscheiden. Während manche Sprachen sogenannte logophorische Pronomina verwenden, um diesen Perspektivwechsel zu ermöglichen, nutzen andere Sprache sogenannte Quasi-Indikatoren. Auf den ersten Blick gleichen sich logophorische Pronomina und Quasi-Indikatoren, wohingegen bei genauerer Betrachtung Unterschiede in den Eigenschaften und Zwecken zu erkennen sind.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Quasi-Indikatoren
3. Logophorische Pronomina
4. Vergleich
4.1 Formale Eigenschaften
4.2 Referenz
4.3 Lesarten
5. Zusammenfassung
6. Literaturverzeichnis
7. Abkürzungsverzeichnis