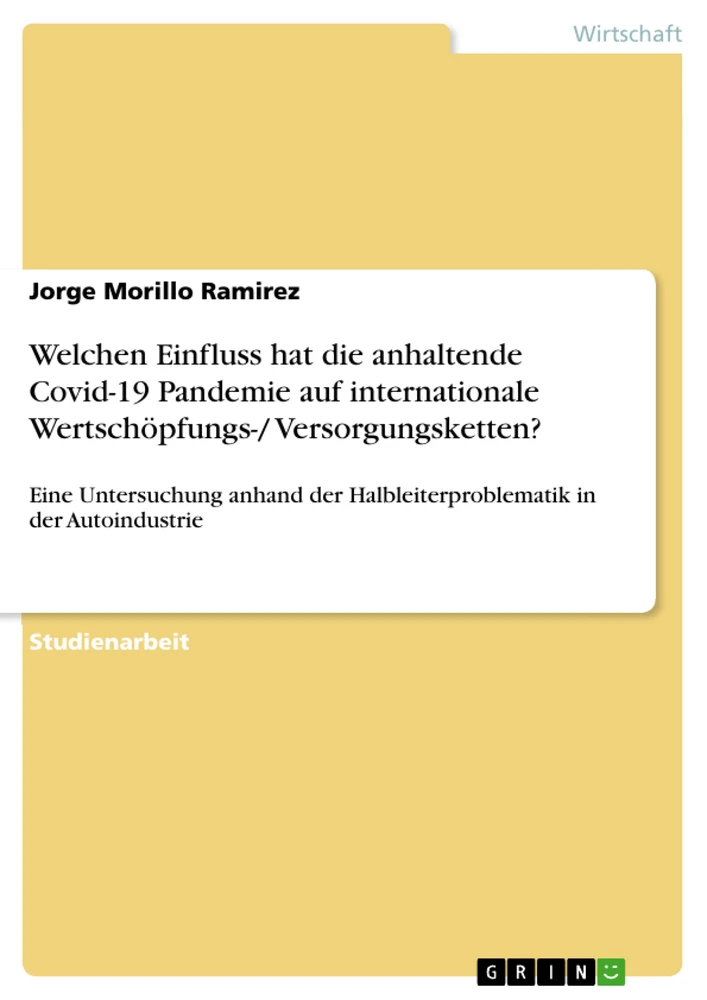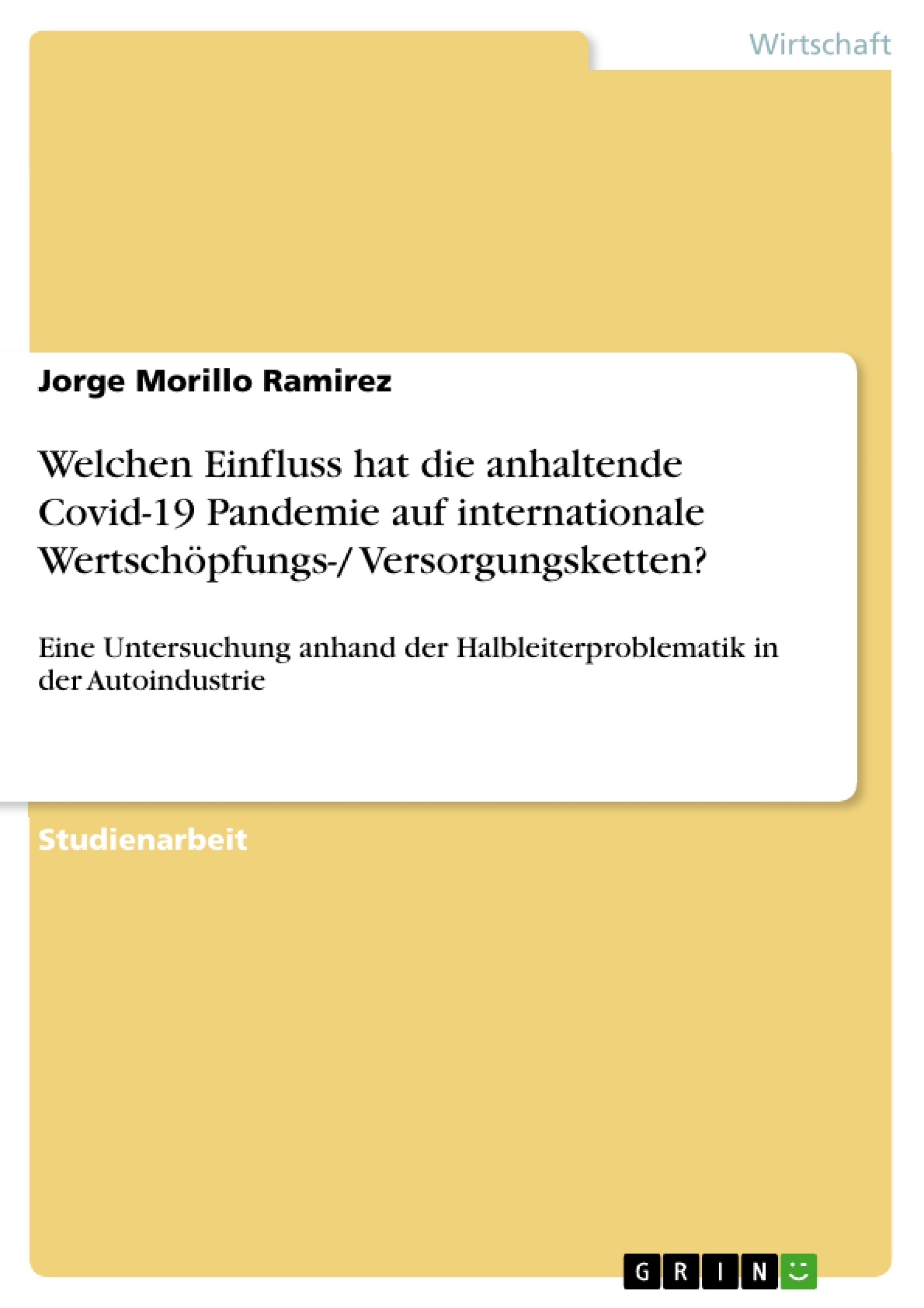Diese Arbeit wird sich, angelehnt an die genannten Herausforderungen mit den Wertschöpfungs- und Lieferketten in der Corona-Krise, mit dem Einfluss der anhaltenden Pandemie auf diese beschäftigen. Der Einfluss wird auf Basis der Halbleiterproblematik und den Auswirkungen für den Industriezweig Automobilbranche untersucht werden. Mithilfe der Untersuchung sollen neben den kurz- und mittelfristigen Auswirkungen ebenfalls Maßnahmen ausgearbeitet werden, welche unter Beachtung der Kennzahlen für die jeweilige Branche unterstützend wirken können.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Definitionen
2.1 Covid-19 Pandemie
2.2 Wertschöpfungsketten
2.3 Supply Chain Management
2.4 Halbleiter
3 Untersuchung der Ursachen und Auswirkungen der Halbleiterproblematik in der Autoindustrie
3.1 Ursache der Halbleiterproblematik
3.2 Auswirkungen der Halbleiterproblematik
4 Empfehlungen
4.1 Maßnahmen
4.2 Adäquates Risikomanagement
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Seit dem weltweiten Ausbruch des Coronavirus im Dezember 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan und der anhaltenden globalen Verbreitung durchlebt die deutsche Gesellschaft viele Herausforderungen. Blickt man retroperspektiv auf die erste Einschätzung des ehemaligen Bundesgesundheitsministers lässt sich diese zwischenzeitlich als Fehleinschätzung kategorisieren. Vor den Weihnachtsfeiertagen 2021 haben sich deutschlandweit mehr als sechs Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Das entspricht knapp zehn Prozent der in Deutschland lebenden Bevölkerung. Für etwas mehr als 1,5 % der Infizierten war die Ansteckung tödlich (Robert Koch Institut, 2021).
Die Auswirkungen der Pandemie sind sowohl in allen persönlichen Lebensbereichen der Bevölkerung als auch im Gemeinwesen präsent. Dadurch werden in der Bevölkerung tief verankerte Themen hinterfragt und nehmen, in Teilen verspätet, die Wichtigkeit ein, die ihnen längst zustehen sollte. Hierzu zählen Themen wie Bildung, Gesundheitswesen, Protestbewegungen, konjunkturelle Themen wie Arbeitsmarktentwicklung oder auch die demokratischen Werte. Auswirkungen auf die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland erscheinen mit Blick auf die jüngere deutsche Geschichte pietätlos. Dennoch kommt es im Land vermehrt zu Protestbewegungen. Eine durchgeführte Studie mit den Corona Protest Bewegungen in Deutschland und der Schweiz der Universität Basel ergab, dass die Protestant*innen überwiegend aus der Mittelschicht stammen. Bei der empirischen Untersuchung stellte sich heraus, dass die Teilnehmer*innen sich stark vom politischen System entfremdet haben (Frei, N. & Nachtwey, O. & Schäfer, R., 2020).
Die vermeintlich größten Folgen für die deutsche Bevölkerung sind die tiefgreifenden, wirtschaftlichen Auswirkungen. Während die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 ihren Ursprung im Finanzsektor hatte und es im Krisenverlauf verzögert zu Auswirkungen auf die reale Wirtschaft kam, findet die aktuelle Krise ihren Ursprung in der Realwirtschaft. Die ergriffenen Maßnahmen und der damit verbundene Arbeitsausfall sorgt somit für unmittelbare wirtschaftliche Einbußen. Ein Grund hierfür ist der notwendige Sicherheitsabstand in Produktionsstätten, der nicht eingehalten werden kann. Die Folge: Einzelne Industriezweige wie die Autoindustrie müssen kurzfristig die Produktionsabläufe ändern oder temporär schließen. Einhergehende Störungen in der Pandemiezeit in den internationalen Lieferketten sind für die deutsche Industriezweige ebenfalls ein weiteres Laster. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Corona-Krise die deutsche Wirtschaft deutlicher schwächen wird als die genannte Finanzkrise (Bundeszentrale für politische Bildung, 2020).
Diese Arbeit wird sich, angelehnt an die genannten Herausforderungen mit den Wert- schöpfungs- und Lieferketten in der Corona-Krise, mit dem Einfluss der anhaltenden Pandemie auf diese beschäftigen. Der Einfluss wird auf Basis der Halbleiterproblematik 1 und den Auswirkungen für den Industriezweig Automobilbranche untersucht werden. Mithilfe der Untersuchung sollen neben den kurz- und mittelfristigen Auswirkungen ebenfalls Maßnahmen ausgearbeitet werden, welche unter Beachtung der Kennzahlen für die jeweilige Branche unterstützend wirken können.
2 Definitionen
Die Fragestellung enthält Begriffe, die zunächst definiert werden. Auf Basis der Definitionen wird sich der Sachverhalt verständlicher gestalten.
2.1 Covid-19 Pandemie
Die Covid-19 Pandemie (Corona Pandemie) findet Ihren Ursprung in der chinesischen Stadt Wuhan. Bei der festgestellten Coronavirus-Krankheit bilden die Coronaviren eine große Familie von Krankheitserregern, die von einer normalen Erkältung bis hin zu schweren Krankheitsverläufen reichen können. Das 2019 erstmals aufgetretene und in 2020 durch den Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus der Weltgesundheitsorganisation als gesundheitliche Notlage definierte Virus war zuvor beim Menschen noch nicht identifiziert worden (World Health Organization, o.J.).
Die Corona Pandemie ist die seit Jahrzehnten größte globale Gesundheitskrise. Weltweit gab es 276.436.319 (Stand 26.12.2021) bestätigte Coronafälle (World Health Organization, 2021). Als Coronafall werden Personen bezeichnet, die nachweislich positiv auf das Virus getestet wurden (Infektionsschutz, 2021). Für mehr als fünf Millionen Menschen endete die Ansteckung tödlich (World Health Organization, 2021). Mit dem Ausbruch veränderte sich auch das globale Alltagsleben der Bevölkerungen in den einzelnen Ländern. Kontaktbeschränkungen zu Mitbürger*innen sowie Einhaltungen von Atemhygiene durch Mund-Nasen-Bedeckungen sind nur zwei von vielen Empfehlungen, die den Bürger*innen als Schutz für die eigene Gesundheit und zum Schutz der anderen empfohlen wurden (World Health Organization, 2021).
Mit Blick auf das zu untersuchende Thema werden die wirtschaftlichen Entwicklungen seit Ausbruch der Pandemie näher betrachtet. Die Weltbank geht von etwa 160 Millionen Menschen aus, die 2021 zusätzlich in Armut abrutschen könnten. Daher ist die Bezeichnung Polypandemie mit Blick auf die ebenfalls auftretenden wirtschaftlichen Folgen folgerichtig. (Bundeszentral für politische Bildung, 2020).
2.2 Wertschöpfungsketten
Die Wertschöpfungskette stellt die Unternehmensaktivitäten der betrieblichen Güterherstellungsprozesse dar (Gabler Wirtschaftslexikon, 2018). Die Aktivitäten, auch Stufen genannt, schaffen Werte, sind in Prozessen miteinander verknüpft und kreieren Werte.
Im Detail zeigt die Wertschöpfungskette den Weg eines Produktes im Transformationsprozess. Somit ist sie ein wesentlicher Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Auch das Erfüllen der Erwartungen und Bedürfnisse der Kund*innen seitens des Betriebs wird deutlich (Gabler Wirtschaftslexikon, 2018.).
Laut dem amerikanischen Betriebswirten Porter besteht die Wertschöpfungskette aus Primäraktivitäten und Unterstützungsaktivitäten, auch Sekundäraktivitäten genannt. Zu den Primäraktivitäten zählen Logistik, Produktion, externe Logistik, Marketing und Verkauf und Service. Sie beschreiben den tatsächlichen Wertschöpfungsprozess. Die ergänzenden vier Unterstützungsaktivitäten sind in Unternehmens-Infrastruktur, Human Ressource Management, Technologie-Entwicklung und Beschaffung unterteilt (Gabler Wirtschaftslexikon, 2018). In der Praxis dient die Wertschöpfungskette zu Analysezwecken der Unternehmensaktivität. Sie ist ein anspruchsvolles Instrument und Bestandteil bei Markt- und Wettbewerbsanalysen. Im Zusammenhang mit der Strategieentwicklung kann ein Unternehmen die Kernkompetenzen erkennen und eine Wettbewerbsstrategie entwickeln (Refa, o.J.).
2.3 Supply Chain Management
Als Supply Chain Management (SCM) wird der Aufbau und die Verwaltung integrierter Logistikketten bezeichnet. Es werden alle Material- und Informationsflüsse von der Rohstoffgewinnung bis hin zum Endverbraucher berücksichtigt. Im Zuge dessen beschreibt das SCM die aktive Gestaltung aller Prozesse, um Kund*innen oder Märkte mit Produkten, Gütern und Dienstleistungen zu versorgen. Der Unterschied zur reinen Logistik liegt in der Berücksichtigung der begleitenden Auftragsabwicklungs- und Geldflussprozesse (Gabler Wirtschaftslexikon, 2018). Das SCM strebt eine Verbesserung der Leistungen und Services des Supply Chain in Bezug zu den eingesetzten Kosten an. Verbunden mit dem Ziel setzt das SCM die Integration der Informationsverarbeitung zwischen den Partnern der Supply voraus. Ein hohes Maß an Vertrauen zwischen den Partnern der Supply Chain wird ebenfalls vorausgesetzt (Gabler Wirtschaftslexikon, 2018).
2.4 Halbleiter
In diesem Abschnitt wird das Material der Elektrotechnik, die Halbleiter, näher betrachtet. Zunächst ist es von Bedeutung, zwischen aktiven und passiven Bauelementen zu unterscheiden. Als passive Elemente werden unter anderem (u.a.) Kondensatoren und Spulen verstanden. Die elektrischen Eigenschaften sind zeitlich konstant und können durch das Verschieben mechanischer Elemente angepasst werden. Als aktives Bauelement versteht man Teile, die nicht-lineare Strom-Spannungskennlinien aufweisen und Schaltfunktionen übernehmen (Wellmann, P., 2019). Die Halbleiter nimmt als aktives Element eine Vielzahl von Aufgaben wahr. Ihr wird bei den Materialien der Elektronik und der Energietechnik eine zentrale Rolle zugewiesen.
[...]