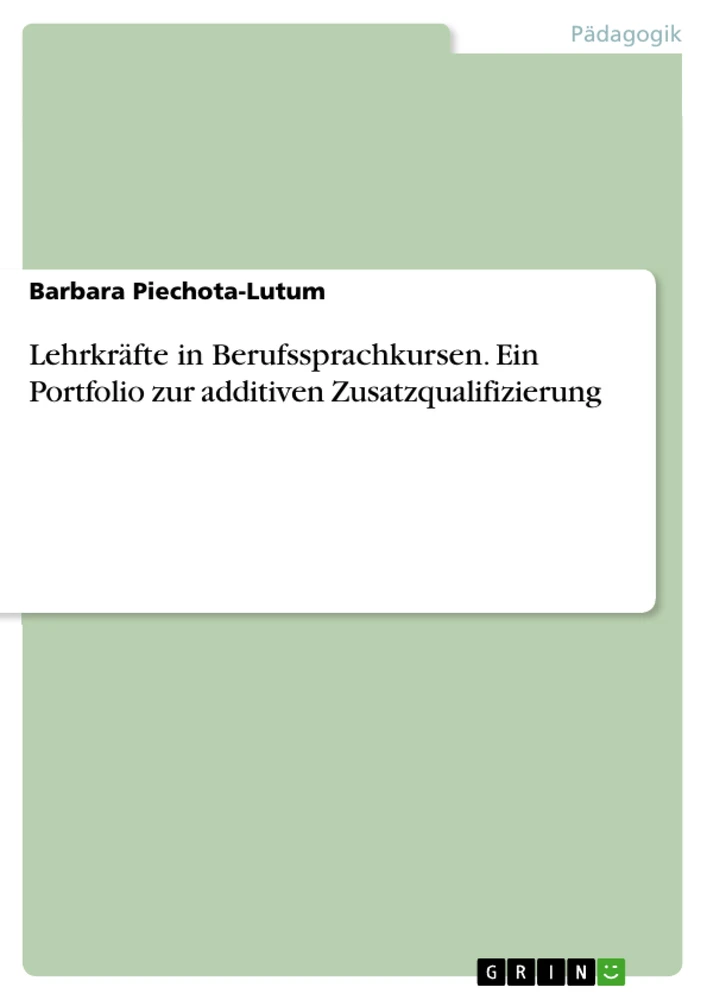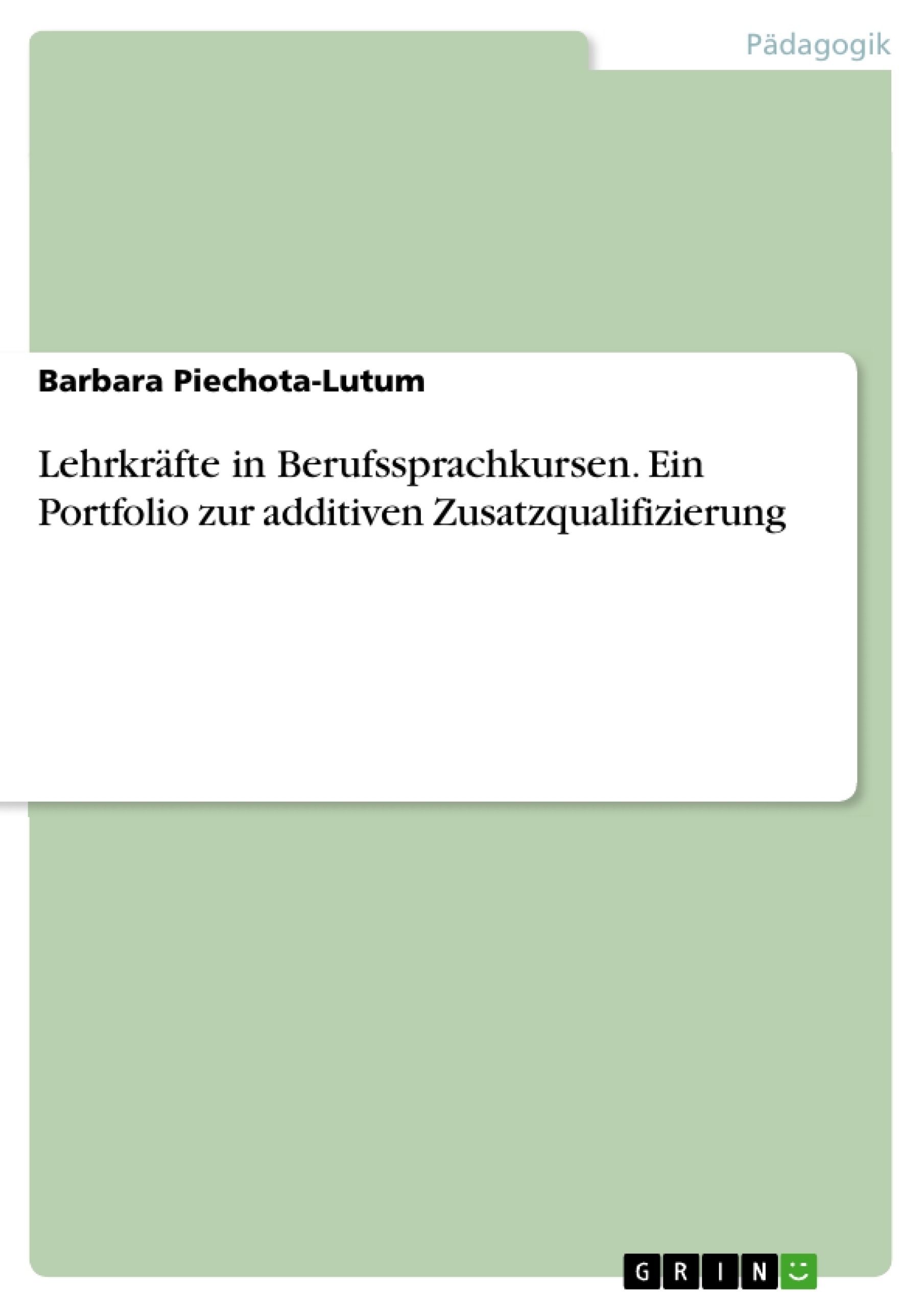Das Portfolio ist eine Sammlung von thematischen Reflexionen zu acht Modulen der additiven Zusatzqualifizierung für Lehrkräfte in Berufssprachkursen und wurde im Rahmen einer von dem Institut für internationale Kommunikation in Düsseldorf durchgeführten Veranstaltung als Abschlussarbeit verfasst. Die Arbeit wurde als sehr gut gelungen bewertet.
Das Portfolio setzt sich aus zehn Kapiteln zusammen. Jedes Kapitel ist eine Reflexion zu dem jeweiligen Thema eines Moduls. Beginnend mit der Einstiegsreflexion, in der über eigene Kompetenzen als Lehrkraft reflektiert wird, befasst sich diese Arbeit mit gewählten Aspekten der Berufspädagogik, der berufsbezogenen linguistischen Kompetenz, der Förderung des selbständigen Sprachenlernens, der Didaktik und Methodik im berufsbezogenen Deutschunterricht, des Evaluierens, Prüfens und Testens, der digitalen Kompetenz, der Lehrerrolle in Berufssprachkursen und der Interkulturalität und Integration in den Arbeitsmarkt. In der Abschlussreflexion werden Ergebnisse zusammengefasst und Ziele für zukünftige Arbeit als Lehrkraft in Berufssprachkursen formuliert.
Inhaltsverzeichnis
1. Einstiegsreflexion
2. Portfolio-Aufgabe zu Modul 1: Grundlagen der Berufspädagogik
3. Portfolio-Aufgabe zu Modul 2: Berufsbezogene linguistische Kompetenz
4. Portfolio-Aufgabe zu Modul 3: Förderung des selbständigen Sprachenlernens und arbeitsmarktrelevanten Schlüsselkompetenzen im Erwachsenenalter
5. Portfolio-Aufgabe zu Modul 4: Didaktik und Methodik im berufsbezogenen Deutschunterricht
6. Portfolio-Aufgabe zu Modul 5: Evaluieren, Prüfen, Testen
7. Portfolio-Aufgabe zu Modul 6: Digitale Kompetenz
8. Portfolio-Aufgabe zu Modul 7: Lehrerrolle in BSK
9. Portfolio-Aufgabe zu Modul 8: Interkulturalität und Integration in den Arbeitsmarkt
10. Abschlussreflexion
Literaturverzeichnis
Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anmerkung der Redaktion:
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden einige Abbildungen und Materialien entfernt.
1. Einstiegsreflexion
Im Folgenden soll auf Grundlage der Bearbeitung des Fragebogens „Selbstreflexion der Lehrkompetenzen“ über vorhandene Erfahrungen und Kompetenzen, Stärken und Schwächen reflektiert werden und daraus ein Schluss gezogen werden, hinsichtlich des Lernziels und der Auswahl der Module, die diese Kompetenzen stärken und erweitern sollen.
Nach der Bearbeitung des Fragebogens hat sich für die Autorin dieser Reflexion folgendes Bild abgezeichnet. Im Bereich der Unterrichtserfahrung verfügt die Autorin über viel Erfahrung, bereitet den Unterricht stets gründlich vor und sorgt dabei für Abwechslung. Besonders viel Freude findet sie am Erklären der grammatischen Strukturen, sprachlichen Interaktionen in Form von Diskussionen und am Einsetzen von Spielen zum Erlernen des Wortschatzes und der Grammatik. Dabei entwickelt die Autorin eigene Ideen und greift gerne auf Anregungen aus dem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen zu.
Auch wenn langjährige Erfahrung im Unterrichten als Stärke angesehen werden kann, merkt die Autorin, dass sich in ihre Arbeitsweise eine gewisse Routine eingeschlichen hat, die sich mal positiv, mal negativ auf den Unterricht auswirkt. Dem könnte durch Auffrischen und Erweitern der Kenntnisse insbesondere im Bereich der Didaktik und Methodik sowohl durch die Teilnahme an der Qualifizierung als auch durch eigene Lektüre der geeigneten Fachliteratur entgegengewirkt werden. Dieses wird als gewinnbringend erkannt und soll während der Qualifizierung angestrebt werden, insbesondere weil die letzte tiefere Auseinandersetzung mit dem theoretischen Wissen ziemlich weit in der Vergangenheit liegt.
Die Autorin stellt ferner fest, dass ihre linguistische Kompetenzen im Allgemeinen gut sind, dennoch eine gezielte Wiederholung und Stärkung dieser Kompetenzen von Vorteil wäre. Hier soll das Augenmerk auf fundiertes theoretisches Wissen im Bereich der Soziolinguistik, insbesondere der Sprachregister sowie des Aufbaus der Texte, der Unterscheidung und der Vielfältigkeit verschiedener Textsorten, gelenkt werden. Dieses Wissen soll dabei behilflich sein, den Schwierigkeitsgrad kompetent einschätzen zu können, um passende Texte auf der jeweiligen GER-Stufe im Unterricht einzusetzen.
Da die Autorin ferner wenig Unterrichtserfahrung auf der GER-Stufe C1 hat, soll sie sich gestärkt mit einigen linguistischen Phänomenen dieser Stufe auseinandersetzten, wie z. B. subjektive Modalität, Passiversatzformen oder Kollokationen. Hierauf soll während der Qualifizierung gestärkt geachtet werden.
Die Kompetenzen in Bereichen des Evaluierens, Prüfens und Testens werden ebenfalls als gut eingeschätzt. Der Autorin ist die Rolle von Fehlern und Fehlerkorrektur bekannt und sie setzt vielfältige Korrekturmethoden ein, wie z. B. Diktate, mündliche und schriftliche Übungen zur Fehlersuche, korrektes Nachsprechen, Abschreiben oder Auswendiglernen von kurzen Texten. Kennenlernen von weiteren Methoden wäre dennoch wünschenswert.
Die Autorin ist ein großer Freund von regelmäßigen Lernstandskontrollen. Diese wird auch vom überwiegenden Teil der Lerner gewünscht. Daher bilden diese einen wichtigen Baustein des Unterrichts. Die jeweiligen Ergebnisse werden mit den Teilnehmern immer besprochen und Feedback abgegeben. In den Kursablauf werden ebenfalls recht früh, spätestens ab der Hälfte des Kurses, Vorbereitungseinheiten auf den Abschlusstest eingebaut, sodass die Teilnehmer rechtzeitig mit den Prüfungsaufgaben vertraut werden und an Schwächen und Defiziten arbeiten können. Es werden dabei insbesondere Strategien im Umgang mit den Prüfungsaufgaben erarbeitet sowie zusätzliche Aufgaben passend vergeben, um einzelne Kompetenzen der Lerner zu stärken. Aus der langjährigen Unterrichtserfahrung der Autorin geht hervor, dass insbesondere die Lesekompetenz gestärkt werden muss. Daher werden den Teilnehmern passende Lesetexte und Aufgaben angeboten.
Standardisierte Kursabschlussprüfungen bilden schließlich einen festen Teil des Unterrichts.
Im Bereich der Medienkompetenz besteht ein Bedürfnis, diese auszubauen, da das Interesse der Lerner groß ist. Außer klassischen Printmedien wie Lehrbüchern, Arbeitsblättern und Zeitschriften setzt die Autorin Audiomedien wie CDs sowie Online-Begleitmaterialien zu Lehrwerken und Lernmaterialien von den Internetseiten zu DaF und DaZ ein. Es wurden ebenfalls bereits einige Erfahrungen im Online-Unterricht gesammelt. Es besteht ein großes Interesse, weitere Medien kennenzulernen, wie z. B. Apps, Tools zur Erstellung von eigener Lernmaterialien oder Online-Lernplattformen. Hier erhofft sich die Autorin, entsprechende Impulse im Rahmen der ZQ BSK zu erhalten.
Da die Autorin vor Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit als Kursleiterin in Deutschkursen zahlreiche Praktika und berufliche Erfahrungen im kaufmännischen Bereich im Rahmen ihres Wirtschaftsstudiums in Polen und in Deutschland gesammelt hat, sowie neben ihrem Studium in Deutschland im Pharmagroßhandel gearbeitet hat, verfügt sie über ausreichend Informationen über Arbeitswelt in Deutschland und kann diese in Deutschkursen vermitteln. Ebenfalls ist sie wegen ihrer Arbeitssuche nach dem Studium mit Recherchearbeiten, schriftlichen Anforderungen und Formalitäten von Bewerbungsunterlagen, Bewerbungsverfahren sowie grundlegenden gesetzlichen Bestimmungen am Arbeitsplatz in Bezug auf Datenschutz, Arbeitssicherheit und Arbeitnehmerrechte- und pflichten vertraut. In ihren Deutschkursen finden diese Aspekte neben allgemeinen Lerninhalten regelmäßig Beachtung und dennoch wäre die Aktualisierung dieses Wissens ebenfalls wünschenswert.
Dank eigenes Migrationshintergrunds und Erfahrung als Kursleiterin von kulturell heterogenen Lerngruppen sowie zahlreicher privater Kontakte mit Menschen aus verschiedener Kulturen kann die Autorin mit Konflikten hinsichtlich inter- und transkultureller Missverständnisse im Unterricht konstruktiv umgehen. Ihre interkulturelle Kompetenz, ergänzt um soziale Kompetenzen, wertet sie als ihre Stärke.
Aufgrund des Dargestellten ergeben sich für die Autorin dieser Einstiegsreflexion folgende Ziele, die sie sich erhofft, im Laufe der Zusatzqualifizierung zu erreichen:
1. Stärkung und Erweiterung der didaktischer und methodischer Kompetenzen, insbesondere in Bezug auf berufsbezogene Lerninhalte der Deutschkurse.
2. Auffrischung, Wiederholung und Verschaffen von Übersicht im Bereich der Linguistik (Sprachregister, Textsorten, Textaufbau, Textanalyse).
3. Stärkung der Medienkompetenz, hier insbesondere Kennenlernen von Apps, Tools und Online-Lernplattformen.
Als begleitender Beruf wird Pharmazeutisch-technischer Assistent gewählt, da es unter den Teilnehmern der Sprachkurse oft das Interesse an diesem Beruf geäußert wird. Sinnvoll ist es daher, sich mit den Gegebenheiten dieses Berufes auseinanderzusetzen, um Beratung anbieten zu können. Außerdem besteht Neugierde, etwas über weniger vertraute Bereiche zu erfahren.
2. Portfolio-Aufgabe zu Modul 1: Grundlagen der Berufspädagogik
Im Auftrag von IIK Düsseldorf fand am 25. November 2021 im Rahmen der Zusatzqualifizierung BSK eine Online-Präsentation einer Beratungsstelle in Düsseldorf statt, deren Beratungsschwerpunkt rund um die Themen Ausbildung, Studium, Praktika, Einstiegsqualifizierung, Überbrückungsmöglichkeiten, Bewerbung und Anerkennung liegt und die Zielgruppe Jugendliche und Unternehmer sind.
Zwei Mitarbeiter der Servicestelle gaben zuerst eine graphische Übersicht der Beratungsschwerpunkte und Wege, auf denen junge Menschen ihre beruflichen Ziele erreichen können.
Für die BSK-Kurse wurde vorab ein wichtiger Tipp gegeben, Kursteilnehmer schon früh mit dem Gedanken zu konfrontieren, was sie können, wollen und was erreichbar ist. Die Präsentierenden verwiesen dabei auf wichtige Informationsseiten der Agentur für Arbeit wie Berufe.net oder Berufe.TV.
Nicht nur frühzeitige Sensibilisierung der Teilnehmer der BSK und das Informieren darüber, wo sie Hilfe finden können, sei wichtig, sondern auch Einleitung konkreter Schritte, wie z.B. die Anerkennung der Schul- und Berufsabschlüsse. Dabei wurde auf die Fristen von in der Regel 2-3 Monaten hingewiesen sowie es wurden entsprechende Internetadressen angegeben. Den Teilnehmern der BSK soll eine breite Palette der Möglichkeiten präsentiert werden und sie sollen mit Merkmalen und Vorteilen des dualen Ausbildungsmodells in Deutschland bekannt gemacht werden. Eine Vorlaufzeit von einem Jahr bis zum Antritt der Ausbildungsstelle soll dabei eingeplant werden.
Neu und positiv überraschend für die Autorin dieser Arbeit war die Information, dass es grundsätzlich keine Vorgaben gibt, welchen Abschluss man haben muss, um einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Bei der dualen Ausbildung entscheidet der Betrieb selbst, wen und mit welchem Abschluss er nimmt. Diese Tatsache stellt aus der Sicht der Autorin eine Chance und eine Motivation für die Teilnehmer der BSK dar, die sich eventuell auch ohne regelrechte Abschlüsse, aber mit den gegebenenfalls in ihren Heimatländern gesammelten praktischen Erfahrungen um einen Ausbildungsplatz bewerben können. Sprachliche Kenntnisse sollen sich erfahrungsgemäß auf mindestens Stufe B2 befinden, wobei es auch in dieser Hinsicht keine verbindlichen Vorgaben gibt. So gibt es immer wieder auch Fälle, in denen die Bewerber mit einem A2-Zertifikat einen Ausbildungsplatz erhalten. Diese Tatsache zeigt die Flexibilität des deutschen Ausbildungssystems, eröffnet Möglichkeiten und kann ermutigend wirken. Die Kursleiter können mit diesen Informationen den Willen der Teilnehmer wecken und ihre Motivation stärken.
Als ein weiteres Instrument, anhand dessen der Einstieg in den Beruf gelingen kann, wurden die Einstiegsqualifizierungen genannt, die als Vorstufe der Ausbildung und zum Kennenlernen des Berufes und eigener Eignung gedacht sind, und die noch vor der eigentlichen Bewerbung angestrebt werden sollten. Die Einstiegsqualifizierungen stellen aus der Sicht der Autorin eine sehr sinnvolle Einrichtung dar, nicht nur in Hinsicht auf die Knüpfung von Kontakten und die Möglichkeit des Kommunizierens in der Sprache, sondern sie ermöglichen den Deutschlernern vor allem, die Arbeitswelt mit ihren unterschiedlichen Aspekten sowie die Realität des jeweiligen Berufes kennenzulernen, noch bevor sie sich für die Ausbildung entscheiden. Vorteilhaft ist dabei, dass diese Einstiegsqualifizierung auf die Ausbildungszeit angerechnet werden kann.
Unter den Fragen der ZQ-BSK-Teilnehmer an die Berater der Beratungsstelle fand die Autorin insbesondere die Frage interessant, ob es Altersbegrenzung für Ausbildungen gibt sowie die Feststellung, dass es viele freie Ausbildungsplätze gibt.
Laut der Antwort der Berater soll es, rein rechtlich gesehen, keine Altersbegrenzungen für Ausbildungen geben (ausgenommen Polizei). Dies ist ein weiterer positiver Aspekt des deutschen Ausbildungsmarktes, der das Prinzip „Alles ist möglich, wenn der Wille da ist.“ gelten lässt und zur Stärkung der Motivation herangezogen werden kann.
Der Feststellung, dass es viele freie Ausbildungsplätze gibt wurde noch eine sehr interessante Bemerkung hinzugefügt, nämlich, dass von den etwa 340 Ausbildungsberufen, die es gibt, höchstens 20 bekannt seien und zur Auswahl gezogen würden. Wichtig wäre es deswegen, die Deutschlerner in berufsbezogenen Deutschkursen auf das breite Spektrum der Möglichkeiten hinzuweisen und Offenheit bezüglich der Entscheidung zu empfehlen. Hierfür könnte man z. B. über die Internetseite der Agentur für Arbeit benachbarte oder verwandte Berufe zu den Wunschberufen der Teilnehmer vorstellen und Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten sammeln.
Resümierend ist es schließlich festzuhalten, dass man sich als Kursleiter der berufsbezogenen Deutschkurse vor Augen halten und dies den Teilnehmern vermitteln sollte, dass das deutsche Ausbildungssystem relativ flexibel ist und viele freie Ausbildungsplätze und Fördermöglichkeiten vorhanden sind. Es ist ferner darauf zu achten, dass die Teilnehmer entsprechend früh für das Thema sensibilisiert werden und Informationen bekommen, an welche Institutionen und Beratungsstellen sie sich wenden und welche Schritte sie bereits während des Deutschkurses einleiten können. Den Deutschlernern muss schließlich bewusst gemacht werden, wie wichtig es für ihre Zukunft ist, die bestehenden Möglichkeiten zu nutzen, vor allem aber ihre Deutschkenntnisse nicht nur im Unterricht, sondern unbedingt auch im Privaten durch eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben konsequent zu verbessern. Das Letzte bildet eine Voraussetzung und eine Grundlage für den beruflichen Erfolg.
3. Portfolio-Aufgabe zu Modul 2: Berufsbezogene linguistische Kompetenz
Art des Sprachkurses / Niveau
Berufsbezogener Sprachkurs/
B2
ausgewählter Text (Titel, Quellen)
,,So ertragen Sie Nervensägen im Job leichter“ aus Jobwoche Nr. 23/20211
Textlänge
Etwa 350 Wörter
Beschreibung des Textes
Es handelt sich um einen Zeitungsartikel (Ratgebertext), in dem der Buisness-Coach und Autor des Buches ,,Überleben unter Kollegen“ Mathias Fischedick Ratschläge gibt, wie man im Job mit verschieden Arbeitskollegen und ihren unterschiedlichen Arbeitsweisen klarkommt und somit besser im Team arbeiten kann.
Der Autor beleuchtet zu Anfang, dass die Beurteilung anderer eine subjektive Wahrnehmung sei, die von verschiedenen Faktoren abhänge. Um mit den Eigenarten von Teammitgliedern zurechtzukommen, sei es wichtig, sich bewusst zu machen, dass es nicht nur die eine, ,,richtige“ Art zu leben und zu arbeiten gibt. Wichtig sei, offen gegenüber anderen Lebenseinstellungen zu bleiben und sie nicht als ,,falsch“ sondern als ,,anders“ wahrzunehmen. Als hilfreiche Strategie empfiehlt der Autor, sich für andere Weltsichten zu interessieren, da dies nicht nur bewirke, dass sich die Kollegen verstanden fühlen und dadurch offener werden, sondern es erweitere den eigenen Horizont. Fischdick konstatiert zum Schluss, dass es unter solchen Bedingungen leichter werde, gemeinsame Spielregeln für Teamarbeit zu entwickeln.
Begründung der Textauswahl
Der Text wurde ausgewählt, um KTN der BSK auf Arbeitskonflikte und Schwierigkeiten der Teamarbeit sowie mögliche Gründe solcher Konflikte aufmerksam zu machen. Der Artikel eignet sich als Sprechanstoß zur Diskussion. Da Konflikte auch in den Sprachkursen entstehen, und später im Job, ist es wichtig, sich in den berufsbezogenen Deutschkursen mit dem Thema zu beschäftigen.
Der Text ist ferner ein gutes Beispiel für die Anwendung des Konjuntktivs I zur Wiedergabe der Aussagen von anderen Personen.
Ein anderer Grund für die Auswahl war es , die KTN mit der kostenlosen Zeitung Jobwoche bekannt zu machen und ihnen das Lesen zu empfehlen, insbesondere, weil darin informative, interessante und nicht zu lange Artikel rund um die Arbeitswelt enthalten sind, die sich ab der Stufe B1 zum selbstständigen Lesen gut eignen.
Analyse der sprachlichen Merkmale
[...]
1 Der Artikel befindet sich in der Anlage 1.