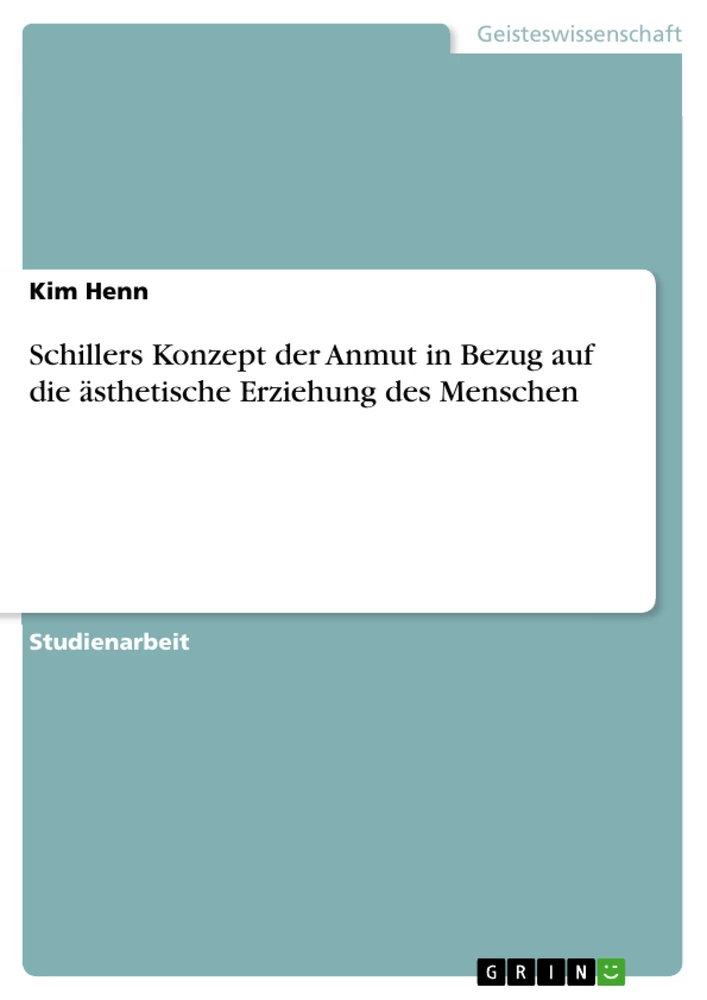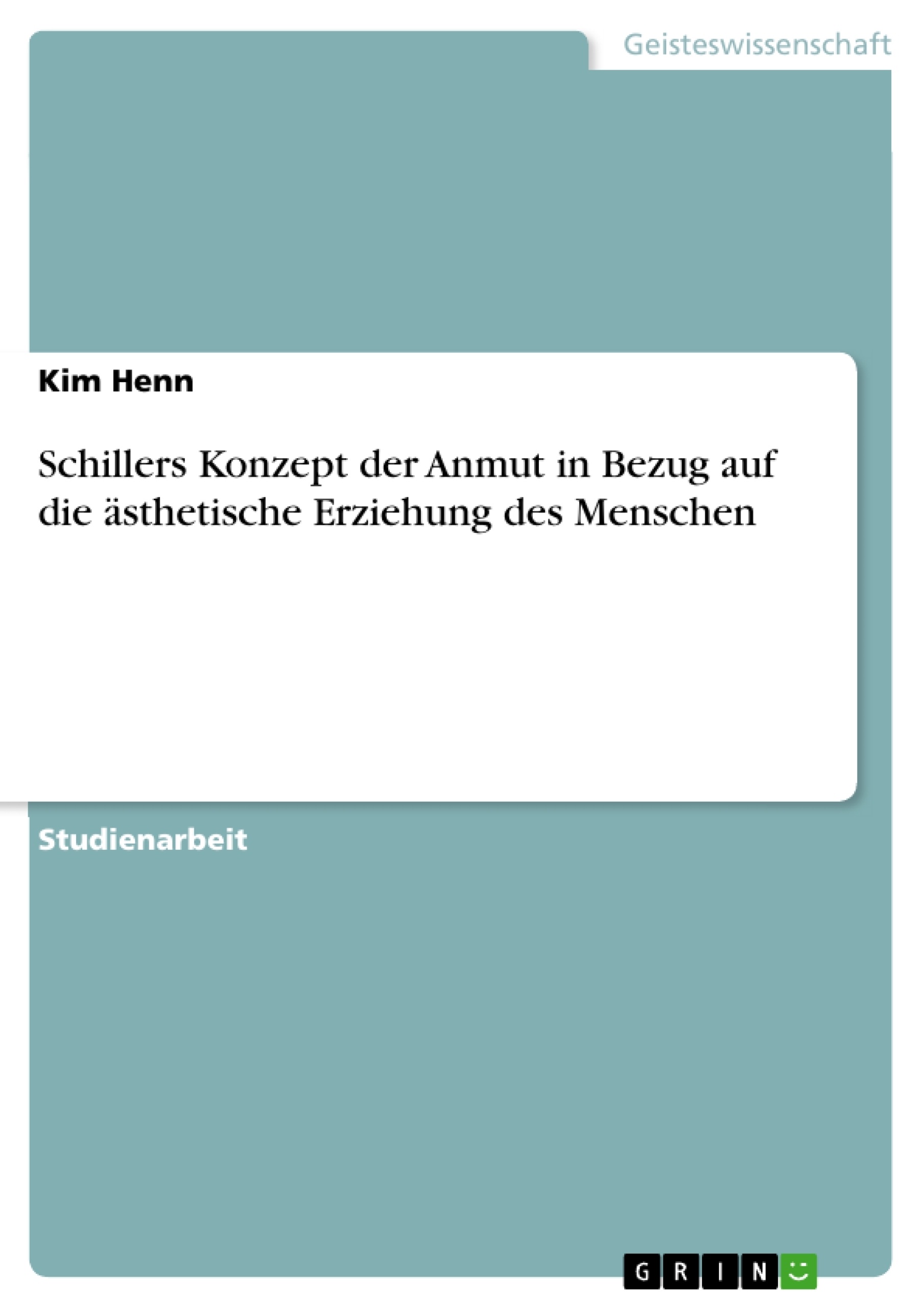Das Konzept der Anmut soll in dieser Arbeit zweifach dargestellt werden: Seine Beschaffenheit bzw. wie diese uns in der Abhandlung „Über Anmut und Würde“ präsentiert wird und welche Rolle dieses Konzept in der ästhetischen Erziehung spielt.
Um diese Aufgabe zu bewältigen, wird diese Arbeit sich nur auf die für dieses Ziel relevantesten Textstellen aus beiden Schriften beziehen. Hierbei müssen Themen, wie zum Beispiel die Übertragung des ästhetischen Charakters auf den Staat, die genaue Darstellung von Bestimmung und Bestimmbarkeit im Menschen oder die drei Stufen der Entwicklung ausbleiben. Dies ist der Fall, da diese Themen indessen wichtige Bestandteile der Schriften darstellen, allerdings nicht nötig sind, um das Konzept der Anmut und dessen Relation zur ästhetischen Erziehung zu verstehen. Um die Verständlichkeit und Übersichtlichkeit der Arbeit zu gewährleisten, werden diese also außenvorgelassen.
Hierbei wird sich vorwiegend auf die mittleren Briefe (11-16) konzentriert, wobei die weiteren Briefe gleichwohl berücksichtigt und für Ergänzungen genutzt werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Konzept der Anmut: „die Schönheit des Spiels“
2.1. Auftreten der Anmut
2.2. Der anmutige Charakter mit „Neigung zu der Pflicht“ (A&W. S. 366)
3. Schillers Anthropologie und Bildungstheorie in den Briefen „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“
3.1. Schillers Menschenbild
3.1.1. Person und Zustand
3.1.2. Die „Grundbegriffe“ Schillers Anthropologie: Sach- und Formtrieb
3.1.2.1. Sachtrieb
3.1.2.2. Formtrieb
3.2. Bildungstheorie: Erziehung zum anmutigen Charakter
3.2.1. Das verbindende Prinzip: Der Spieltrieb
3.2.2. Die ästhetische Erziehung
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis