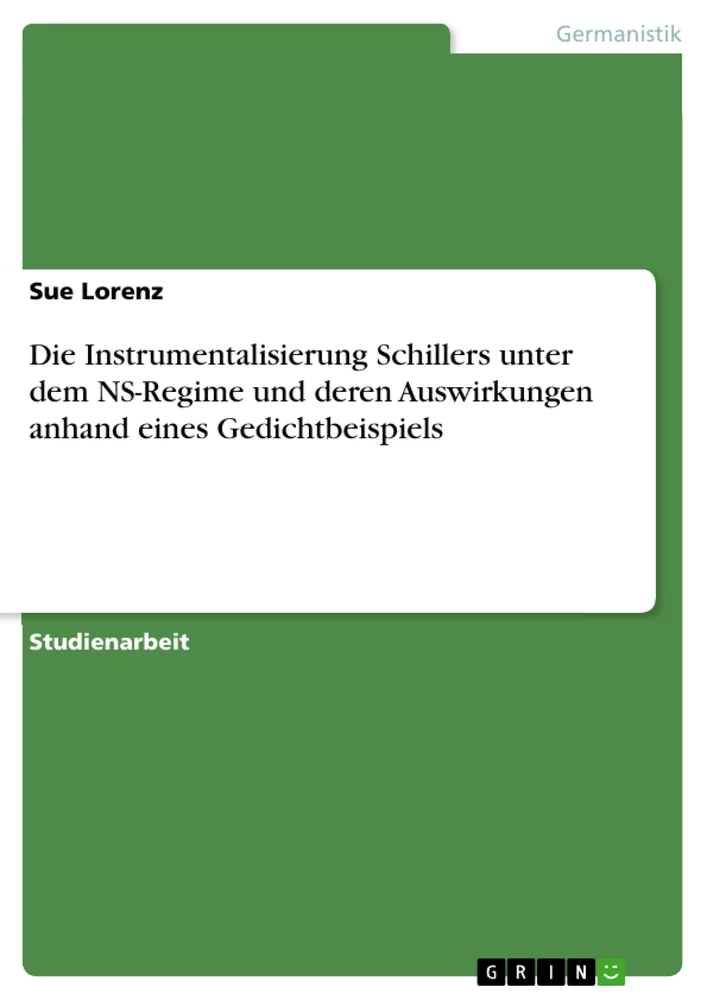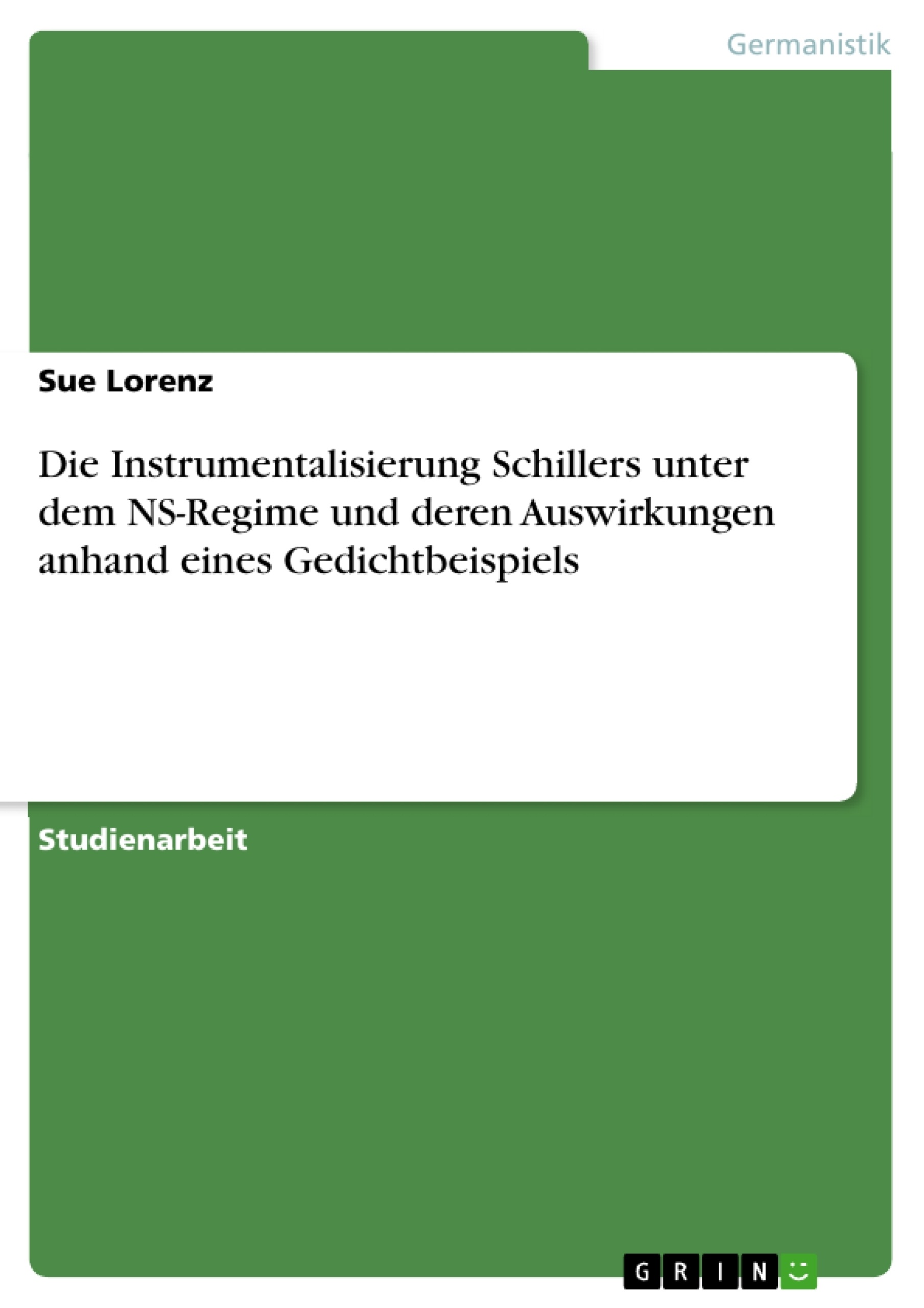Da Schiller der am höchsten Verehrte und neuer Hero der Nazis bezüglich der Kultur war, soll in dieser Ausarbeitung auch ein Gedicht auf ihn näher analysiert werden. Dabei ist es jedoch unerlässlich, im Vorfeld zu klären, warum gerade Schiller instrumentalisiert wurde und wie es dem NS-Regime letztendlich gelang, einen regelrechten Kult um den Dichter auszulösen.
Überall auf der ganzen Welt werden Personen auch heute noch für fragwürdige politische Machenschaften instrumentalisiert. So nutzte man im Nationalsozialismus beispielsweise Großindustrielle, Medien oder hochrangige Persönlichkeiten für das geplante neue, braune Regime. Inwieweit später diese Diktatur Einfluss genommen hatte, erkennt man, wenn verschiedene Bereiche wie Medizin, Meinungsfreiheit, Forschung oder Bildung im Nachhinein näher analysiert werden. Was jedoch sicherlich nicht gleich mit Nationalsozialismus in Verbindung gebracht wird, ist die Weimarer Klassik. Leider wurden zwischen 1933 und 1945 Größen dieser Zeit instrumentalisiert, um die neue deutsche Kultur glaubhaft und beeindruckend darzustellen. Dabei interpretierte man Werke von Kleist, Goethe, Schiller oder Hölderlin völlig frei und falsch und gestaltete diese um, sodass sie ins braune System passten. Das NS-Regime schaffte es mit dieser fragwürdigen Masche jedoch tatsächlich, Tausende für die neue deutsche Kultur zu begeistern. Somit entstanden auch einige Gedichte auf die Größen der Weimarer Klassik.
Inhaltsverzeichnis:
„Klassiker in finsteren Zeiten“ Die Instrumentalisierung Schillers unter dem NS-Regime und deren Auswirkungen anhand eines Gedichtbeispiels
1. Einleitung
2. Die Instrumentalisierung Schillers unter dem NS-Regime
3. Entstehung und Thematik des Gedichts „Hymne an Friedrich Schiller“
4. Verzerrung der Wirklichkeit und die damit zusammenhängende Bedeutung von Wortwahl, Klang und Stilfiguren
5. Schlussbetrachtung und Fazit