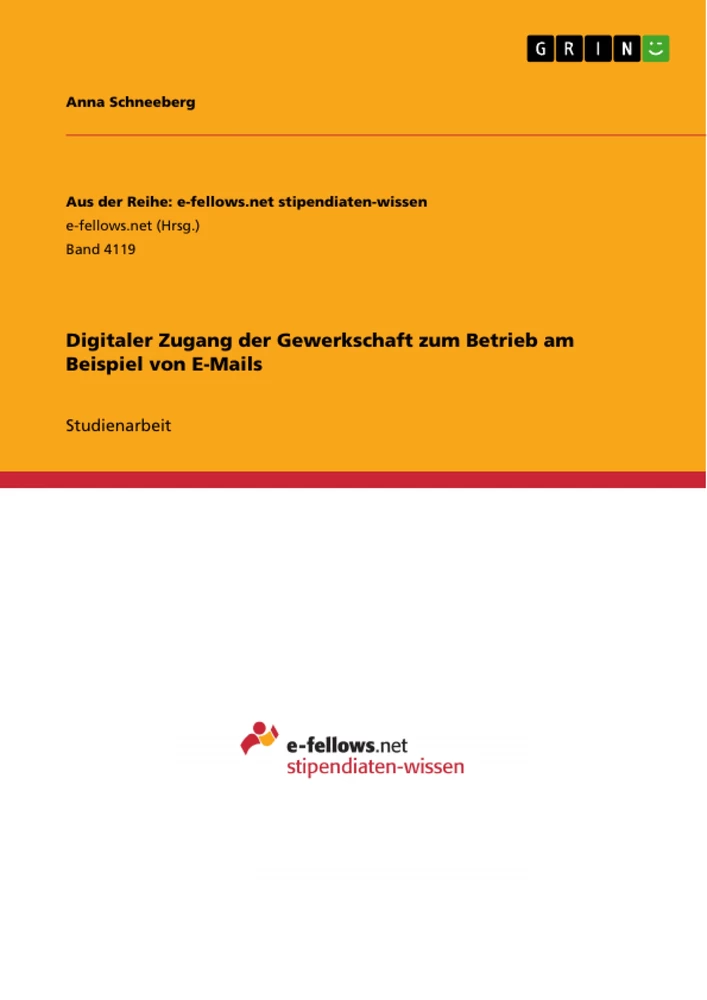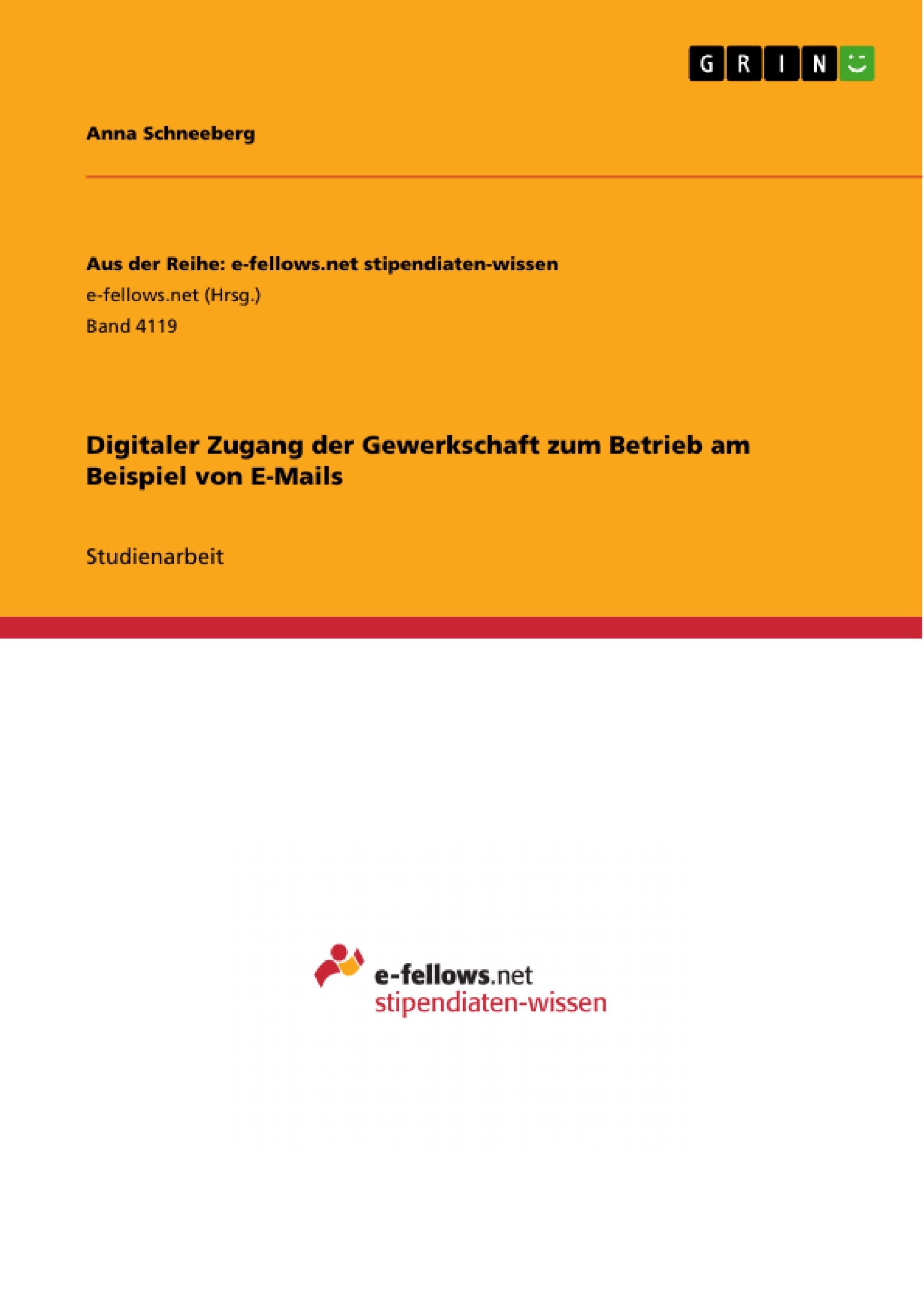Die vorliegende Arbeit beginnt mit der Vorstellung der Anspruchsgrundlagen für Zugangsrechte der Gewerkschaften. Der Hauptteil der Arbeit behandelt den Zugang tariffähiger Gewerkschaften über betriebliche E-Mail-Adressen. Im Anschluss werden kurz die Unterschiede beim Zugang nicht tariffähiger Gewerkschaften erläutert. Die Darstellung schließt mit zusammenfassenden Thesen und einem Ausblick.
Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in der Arbeitswelt vorangetrieben. Tätigkeiten werden dezentralisiert und die Kommunikationsformen reformiert. Die Arbeit wird auch in Zukunft vermehrt aus dem "Home-Office" erfolgen, sodass die Arbeitnehmer fast nur noch digital miteinander und mit dem Arbeitgeber kommunizieren. Daneben sind neue Formen der
Erwerbstätigkeit entstanden, die ausschließlich auf digitalen Kommunikationsformen basieren, wie die Arbeit als Essenslieferant, Taxifahrer oder "crowdworker" über sog. "Plattformökonomien". Der Betrieb verschwindet als örtliche Stelle oder verliert an Bedeutung.
Das hat zur Folge, dass die Arbeitnehmer gewerkschaftliche Plakate oder schwarze Bretter nicht mehr zur Kenntnis nehmen und Gespräche mit Gewerkschaftsvertretern nicht mehr zustande kommen. Die gewerkschaftliche Arbeit und Interessenvertretung verlieren somit an Bedeutung. Gleichzeitig verlieren viele Gewerkschaften Mitglieder und damit an Durchsetzungskraft. Werbung und Information sind daher essenziell. Doch wie können die Gewerkschaften die Arbeitnehmer in der "neuen Arbeitswelt" weiterhin gleich effektiv erreichen? Hat die Gewerkschaft als Pendant zum analogen Zugangsrecht auch ein digitales Zugangsrecht zum Betrieb?
Inhaltsverzeichnis
Gliederung
Gliederung
Literaturverzeichnis
A. Einleitung
B. Anspruchsgrundlagen für Zugangsrechte der Gewerkschaft
I. Betriebsverfassungsrechtliches Zugangsrecht, § 2 II BetrVG
II. Verfassungsrechtliches Zugangsrecht, Art. 9 III GG
C. Digitaler Zugang tariffähiger Gewerkschaften über E-Mails
I. Herausgabe der E-Mail-Adressen
1. Namentliche E-Mail-Adressen
a) Beschäftigungskontext, § 26 BDSG
b) Wahrung berechtigter Interessen, Art. 6 I 1 Buchst. F. DS-GVO
aa) Berechtigtes Interesse
(1) Ausschließlich mobile Arbeit
(2) Gewöhnliche Kommunikation per E-Mail
(3) Betriebe mit ausschließlich analoger Kommunikation
(4) Zwischenergebnis
bb) Interessenabwägung
c) Ergebnis zu C.1.1
2. E-Mail-Verteiler
3. Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers
4. Ergebnis zu C.1
II. Duldung der E-Mails
1. Eigentumsfreiheit des Arbeitgebers, Art. 14 I GG
a) Vergleich mit analogem Postverteilungssystem
b) IT-Sicherheit
c) Besondere Beziehung
d) Grenzen
e) Ergebnis zu C.II.1
2. Wirtschaftliche Betätigungsfreiheit, Art. 2 I GG
a) Betriebsstörung
aa) Lektüre der E-Mails als Betriebsstörung
bb) Lektüre der E-Mails keine Betriebsstörung
b) Gewerkschaft zurechenbar
c) Ergebnis zu C.II.2
3. Rechte der Arbeitnehmer
a) Negative Koalitionsfreiheit, Art. 9 III GG
b) Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG..
c) Ergebnis zu C.II.3
D. Digitaler Zugang nicht tariffähiger Gewerkschaften über E-Mails 23
I. Voraussetzungen
II. Digitale Zugangsrechte
1. Verfassungsmäßiges Recht
2. Praktische Konkordanz
a) Spam-Gefahr
b) Große Bedeutung der Koalitionsfreiheit, Art. 9 III GG
c) Abwägungsergebnis
E. Fazit und Ausblick