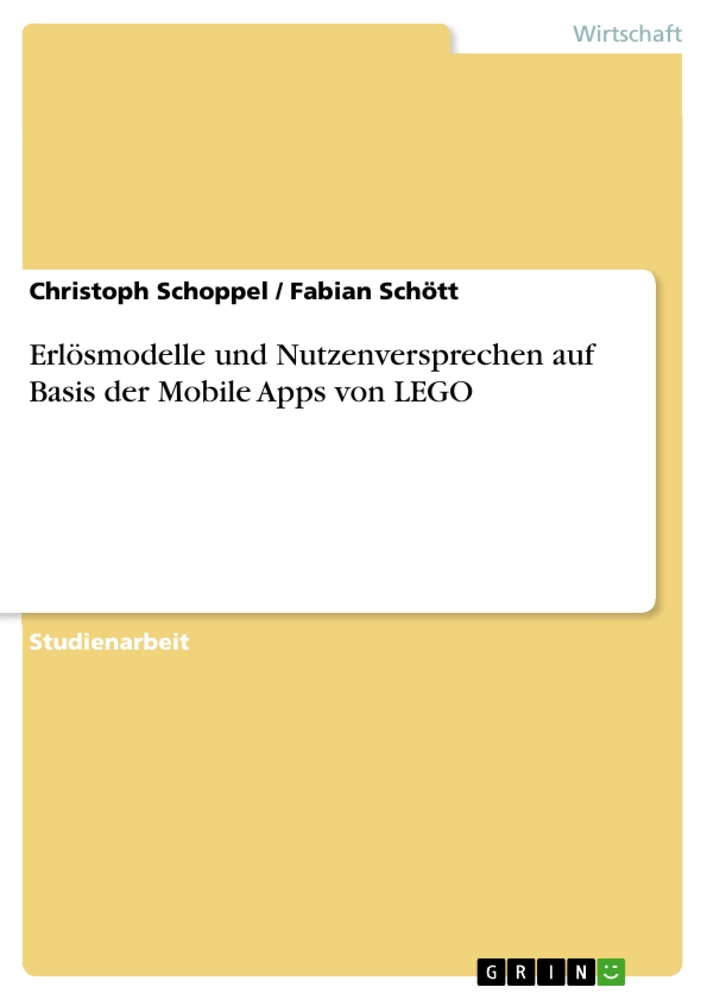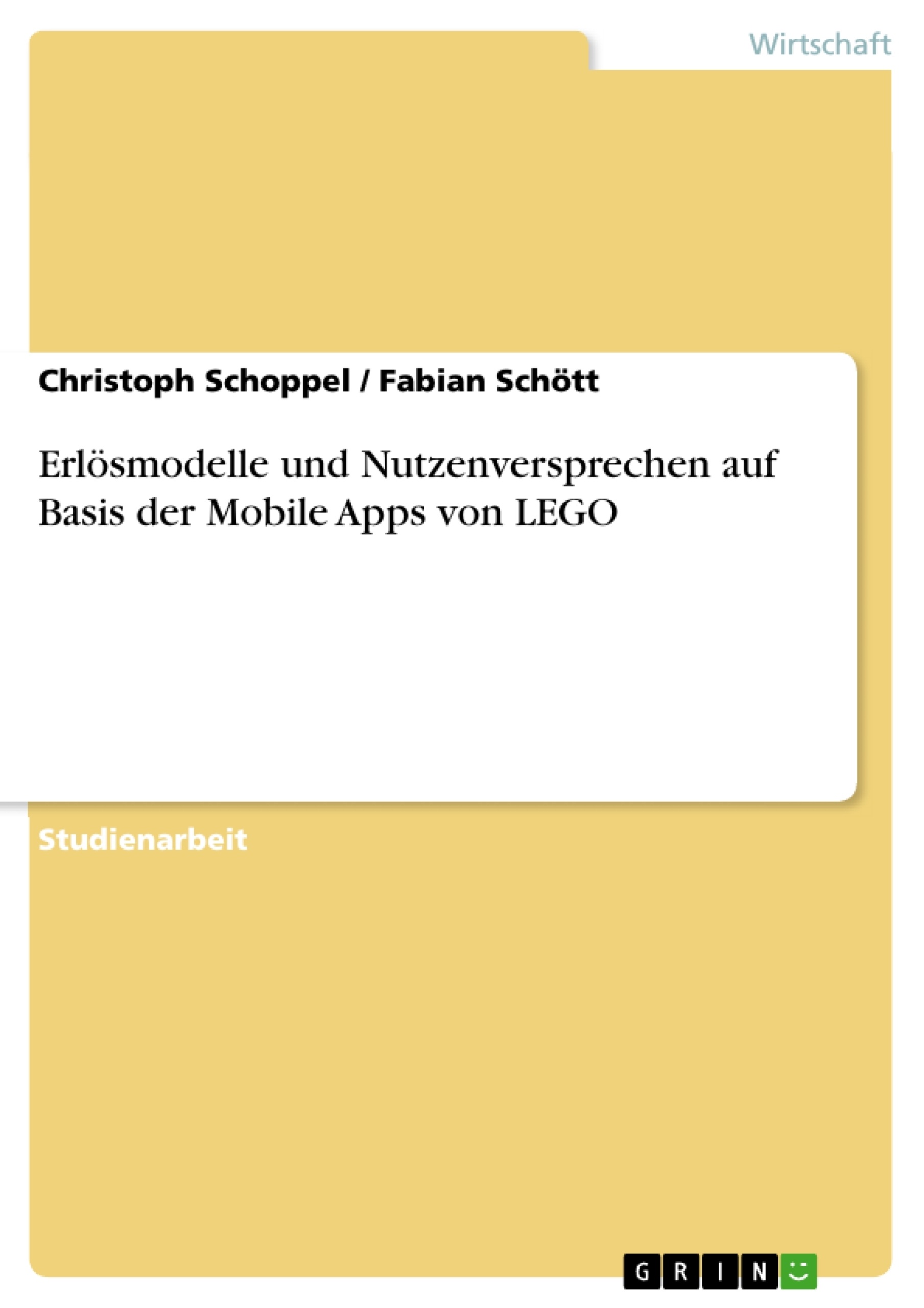Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Erlösmodellen und dem Nutzenversprechen des Unternehmens Lego. Die Kapitel und Themen wurden von beiden Autoren zusammen bearbeitet, recherchiert und ausgewertet. Die Analyse der Arbeit erfolgte speziell unter dem Gesichtspunkt der Mobile Apps von Lego auf den digitalen Vertriebsplattformen App Store
von Apple (Betriebssystem: IOS) und dem Google Play Store (Betriebssystem: Android). Insgesamt wurden 35 Apps für den App Store und 30 für den Google Play Store unter verschiedenen Gesichtspunkten aus Erlösperspektive und Sicht des Werteversprechens untersucht. Die Forschungsfragen lauten wie folgt:
1) Welche Erlösmodelle verkörpern die Lego Apps?
2) Welche Nutzenversprechen repräsentieren die Lego Apps der App-Entwickler „Lego System A/S“ und „Lego Education“?
Die Analyse erfolgte auf Basis zwei eigenständig erstellter Taxonomien für IOS und Android mit unterschiedlichen Attributen. Als Ergebnisse wurden zwei übergreifende Modelle der Erlösmodelle entwickelt sowie eine taxonomische Übersicht der
Werteversprechen der Lego Apps, aufgegliedert nach verschiedenen Wesensmerkmalen, präsentiert und daraus erzielte Erkenntnisse erörtert.
Gliederung
Gliederung
Abbildungsverzeichnis Fehler! Textmarke nicht definiert
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Lego und sein Werdegang bis 2004
1.2 Digitale Transformation von Lego
2 Ausgangssituation und Fragestellung
3. Zielsetzung und Vorgehensweise
4 Erlösmodelle
4.1 Definition des Erlösmodells
4.2 Erlösmodelle der mobilen Applikationen
4.2.1 Lego als Publisher
4.2.2 Fremde Publisher
5 Nutzenversprechen der Lego Apps
5.1 Begriffe und Abgrenzung
5.2 Ergebnisse der Nutzenversprechen
6 Fazit
Literaturverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
Abstract
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Erlösmodellen und dem Nutzenversprechen des Unternehmens Lego. Die Kapitel und Themen wurden von beiden Autoren zusammen bearbeitet, recherchiert und ausgewertet. Die Analyse der Arbeit erfolgte speziell unter dem Gesichtspunkt der Mobile Apps von Lego auf den digitalen Vertriebsplattformen App Store von Apple (Betriebssystem: IOS) und dem Google Play Store (Betriebssystem: Android). Insgesamt wurden 35 Apps für den App Store und 30 für den Google Play Store unter verschiedenen Gesichtspunkten aus Erlösperspektive und Sicht des Werteversprechens untersucht. Die Forschungsfragen lauten wie folgt:
1) Welche Erlösmodelle verkörpern die Lego Apps?
2) Welche Nutzenversprechen repräsentieren die Lego Apps der App-Entwickler „Lego System A/S“ und „Lego Education“?
Die Analyse erfolgte auf Basis zwei eigenständig erstellter Taxonomien für IOS und Android mit unterschiedlichen Attributen. Als Ergebnisse wurden zwei übergreifende Modelle der Erlösmodelle entwickelt sowie eine taxonomische Übersicht der Werteversprechen der Lego Apps, aufgegliedert nach verschiedenen Wesensmerkmalen, präsentiert und daraus erzielte Erkenntnisse erörtert. Legos Erlösmodelle untergliedern sich in direkte und indirekte transaktionsabhängige Einnahmen.
Die Nutzenversprechen der 22 untersuchten Apps der zwei Hersteller sind unter anderem eine erhöhte User Experience, erweiterte Funktionen und die Förderung von MINT-Kompetenzen. Diese Apps liefern dem User einen Strukturierungs-, Selektions- und Kommunikationswert.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: LEGO transaktionsabhängige direkte Erlöse 9 Abbildung 2: LEGO transaktionsabhängige indirekte Erlöse.….
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Lego-Apps-Taxonomie - Apple App Store
Tabelle 2: Lego-Apps-Taxonomie - Google Play Store
Tabelle 3: Lego Nutzenversprechen-Taxonomie Lego System A/S und Lego Education
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
1.1 Lego und sein Werdegang bis 2004
Der Grundstein des Unternehmens LEGO wurde im Jahr 1932 von Ole Kirk Kristiansen gesetzt, der zu diesem Zeitpunkt damit begann, Spielzeuge aus Holz herzustellen. Die Kombination der beiden ersten Buchstaben der dänischen Wörter „leg godt“, zu Deutsch „spiel gut“, steht bis heute für ein Unternehmen, das die Menschen unabhängig von deren Alter über Generationen fasziniert. Im Jahr 1949 erkannte der damalige Gründer das Potenzial von Plastikbausteinen und sein Sohn entwickelte 1955 LEGO® System-in-Play, dass durch die Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Steine die Kreativität von Kindern fördern sollte. Drei Jahre später wurde das Patent für den Legostein eingereicht, der bis heute den Kern der Geschäftstätigkeit bildet. Mit der Zeit erweiterte LEGO seine Geschäftstätigkeiten zunehmend und erschloss neue Kundensegmente. Der erste LEGOLAND® Park im Jahr 1968, ein Jahr später LEGO DUPLO® Bausteine für Kleinkinder, im Jahr 1978 die ersten Themensets und 1998 wurde mit LEGO MINDSTORMS® eine Verbindung zur Robotertechnologie geschaffen (The Lego Group, o.D.) Lego führte in den 1990er Jahren seine bisherigen Bemühungen fort, stets neue Themensets zu produzieren und gehörte zu diesem Zeitpunkt zu den zehn größten Spielzeugherstellern weltweit. Nachdem das Patent auf ihr Kernprodukt auslief und die Computerspielindustrie zunehmend an Bedeutung gewann, sah sich LEGO gezwungen durch eine Diversifikation des Produktportfolios konkurrenzfähig zu bleiben. Dieser Strategiewandel verursachte teure und komplexe Produktionsprozesse sowie Fehlinvestitionen, weshalb sich das Unternehmen im Jahr 2004 aufgrund ineffizienter Prozesse und rückläufiger Gewinne in einer sehr schlechten wirtschaftlichen Verfassung wiederfand (Konzack, 2014, S.5f.)
Lego ist in der Spielwaren- und Spieleindustrie tätig. Kundensegmente in diesem Markt sind vier wesentliche Kundengruppen: Vorschulkinder (0-5), Kinder (6-12), Jugendliche (13-18) und Erwachsene (18+) (Luwisch et al. 2021, S.18ff.) Im Geschäftsjahr 2020 belief sich der Jahresumsatz der Lego Gruppe auf insgesamt 43,7 Milliarden DKK (Dänische Kronen) (The Lego Group, 2021, S.10). Die Kundengruppe von Lego bewegt sich im Business-to-Consumer (B2C) Segment. Werte, die Lego als Marke für seine Kunden repräsentiert sind unter anderem: Kreativität, Vorstellungskraft, Lernen und Freude (Begeisterung) (Lego Group, o.D).
1.2 Digitale Transformation von Lego
Eine Digitale Transformation repräsentiert eine Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen. Sie basiert auf einem digitalen Wettbewerb gepaart mit digitalen Technologien und digitalem Verbraucherverhalten (Verhoef et al., 2019, S.2). Lego hat sich an die technologischen Entwicklungen in der Wirtschaft angepasst und konnte somit innovative Produkte entwickeln, die an Attraktivität bei den Kunden gewannen (Bejerano, 2014; Rusu & Avasilcăi, 2015, S.4)
Unter Betrachtung der Geschäftsmodellmuster von Gassmann sind bei Lego folgende Geschäftsmodellmuster zu identifizieren: E-Commerce, Direct Selling, Digitalization, Lizenzen und Lock-In Effekte (Gassmann et al., 2013, S.110-113, S.114-120, S.160-162, S.163-166).
Im Rahmen dieser Arbeit wird auf das Geschäftsmodellmuster Digitalization näher eingegangen mit Fokus auf die Mobile Apps als Untersuchungsgegenstand.
2 Ausgangssituation und Fragestellung
Vor der eigentlichen Beantwortung der zwei Forschungsfragen ist es zuallererst notwendig Klarheit bei den Begriffen „Geschäftsmodell“ „Erlösmodell“ und „Nutzenversprechen“ und „App“ zu schaffen.
Bei dem Terminus „Geschäftsmodell“ gibt es in der Wissenschaft und im praktischen Anwendungsbereich verschiedene Ansichten und Definitionen. Bis heute ist es nicht gelungen eine allgemein akzeptierte Definition des Begriffs „Geschäftsmodell“ zu instituieren (Schneider et al., 2013, S.25; Foss et al., 2017, S.12).
Teece (2018, S.2) beispielsweise beschreibt den Ausdruck „Geschäftsmodell“ als eine Modellierung, wie ein Unternehmen einen Mehrwert für Kunden schafft und Prozesse zur Erfassung dieses Wertes generiert. Es handelt sich um eine abgestimmte Gesamtheit von Elementen, die die Abläufe von Kosten, Erlösen und Gewinnen umfassen. Nach Auffassung der Autoren Wirtz et al. (2015, S.6) ist ein Geschäftsmodell eine aggregierte und vereinfachte Darstellung der relevanten Aktivitäten eines Unternehmens. Es beschreibt, wie marktfähige Informationen, Produkte und Dienstleistungen in der unternehmenseigenen Wertschöpfungskette generiert werden. Neben der Architektur der Wertschöpfung werden strategische Komponenten sowie Kunden- und Marktkomponenten berücksichtigt, um den Wettbewerbsvorteil als ein übergeordnetes Ziel zu erreichen beziehungsweise zu sichern.
Stähler (2001, S.41f.) gliedert ein Geschäftsmodell in drei Grundelemente nieder:
1) Nutzenversprechen (engl. Value Proposition: Welcher Wert und Nutzen wird für den Kunden durch die Produkte und Dienstleistungen generiert?)
2) Wertschöpfungsarchitektur (Wie wird dieser Wert generiert, also wie und aus welchen Komponenten setzt sich der Leistungserstellungsprozess zusammen?)
3) Ertragsmodell (auch Erlösmodell: Welche Erlöse werden aus welchen Quellen generiert?)
Ebenso soll ein Geschäftsmodell aufgrund interner und externer Veränderungen dynamisch betrachtet werden. Es kann daher notwendig sein, sein(e) Geschäftsmodell(e) weiterzuentwickeln oder zu innovieren (Wirtz et al., 2016). Genau solch eine Weiterentwicklung vollzog sich auch bei dem Unternehmen Lego durch seine digitale Transformation ab Anfang des 21. Jahrhunderts (Kapitel 1.2).
Ein digitales Geschäftsmodell ist digital, wenn es digitale Technologien in seinem Modell verwendet (Veit et al., 2014). Digitale Technologien sind maschinelle Komponenten, die unter anderem auf Software und Netzwerken basieren (Müller, 2018).
Mobile Applikationen (kurz: App) sind auf mobilen Endgeräten laufende Software-Anwendungen, in Form von gekapselten Programmen (Aichele & Schönberger, 2014, S.8). Somit sind Mobile Apps digitale Technologien, die sich in ein digitales Geschäftsmodell eingliedern lassen. Diese Technologien im mobilen Bereich können spezielle Mehrwerte erzeugen (Behrendt et al., 2004, S.71). Da die Dynamik, die bei appbasierten Geschäftsmodellen von kontinuierlicher Verbesserung und Erweiterung geprägt ist, innovatives Denken erfordert und Anregung zu neuen ökonomischen und technologischen Entwicklungen fordert, stellt der Untersuchungsgegenstand der mobilen Apps von Lego in Bezug der Erlösmodelle und der Nutzenversprechen (engl. Value Proposition) eine reizvolle wie interessante Aufgabe dar.
Wie in Kapitel 1.1. erwähnt, hat das Unternehmen Lego unterschiedliche Geschäftsmodellmuster in seinem Portfolio. Im Rahmen dieser Fallstudie ist das Muster „Digitalization“ relevant, da sich Lego unter anderem diesem Muster neben weiteren Mustern mit seiner digitalen Transformation bedient (Kapustina et al., 2021, S.1). Im Rahmen der Digitalisierung können physische Güter um immaterielle Zusatzleistungen, die auf Informations- und Kommunikationstechnik fußen, ergänzt werden (Gassmann et al., S.110f.). Genau diese Kombination aus physischen Lego-Sets und digitalen Erweiterungen in Form von Apps wird in Kapitel 5 untersucht.
Die Fallstudienarbeit stützt sich bei den beiden Teilbereichen Erlösmodell und Werteversprechen grundlegend auf der Definition von Stähler (2001, S.41f. ). Verfeinerungen sind in den Kapiteln 4.1 und 5.1 enthalten.
Ziel der vorliegenden Fallstudienarbeit ist es einen Überblick der derzeitigen Erlösmodelle und der Nutzenversprechen der Lego Apps zu erarbeiten. Die Forschungsfragen lauten wie folgt:
1) Welche Erlösmodelle verkörpern die Lego Apps?
2) Welche Nutzenversprechen repräsentieren die Lego Apps der App-Entwickler „Lego System A/S“ und „Lego Education“?
3. Zielsetzung und Vorgehensweise
Die Autoren fokussieren sich bei der App-Betrachtung auf die Apps der Betriebssysteme IOS und Android. Diese beiden Betriebssysteme bilden einen Marktanteil von über 99%. (Statista, 2022). Zur Übersicht wurden für die zwei App Stores von Apple und Google zwei Taxonomien mit mehreren Attributen angelegt.
Auf Basis der beiden unten stehenden Taxonomien auf den nächsten 2 Seitenwerden die beiden Forschungsfragen und nachfolgenden Recherchen die Forschungsfragen beantwortet. Die Recherche erstreckte sich auf Journals, Bücher und Webseiten, die in Verbindung mit den Begriffen Geschäftsmodell, Erlösmodell und Nutzenversprechen mit und ohne den Unternehmensnamen Lego in Verbindung stehen.
[...]