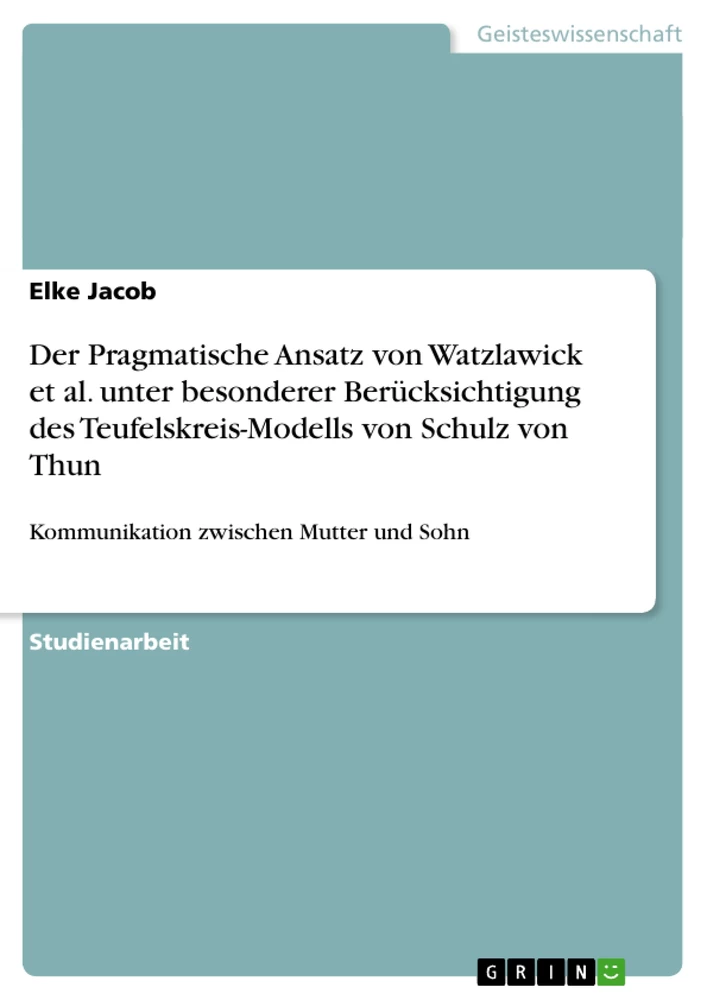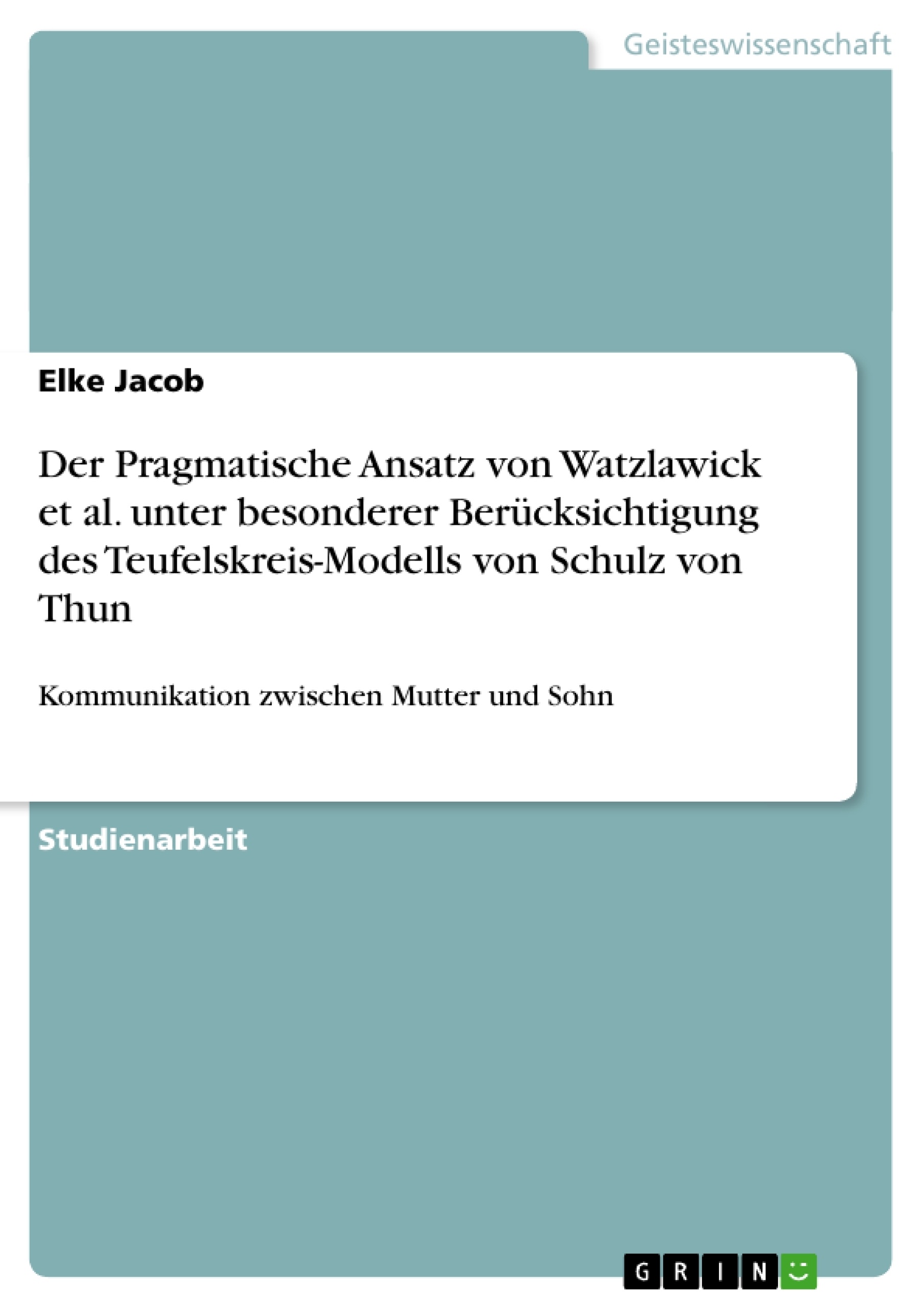Oft unberührt von Theorien und Modellen tun Menschen täglich das, was allgemein
Kommunikation genannt wird. Nicht immer kommt dabei eine, für alle Beteiligten,
befriedigende Kommunikation zustande. In den alltäglichen, spontanen Formen der zwischenmenschlichen
Kommunikation entstehen durch Fehlinterpretationen Missverständnisse
zwischen den Beteiligten. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen für den
weiteren Kommunikationsverlauf.
Mit Hilfe des Pragmatischen Ansatzes von Watzlawick at al. und des Teufelskreis-
Modells von Schulz von Thun soll die Wirkung der Meta-Ebene von Kommunikation
dargestellt werden. Es wird der Frage nachgegangen, welche Bedeutung Metakommunikation
bei Kommunikationsproblemen hat und welche Rolle dabei die nonverbale
Kommunikation spielt. Diese Arbeit soll mit Hilfe des praktischen Problems auch zeigen,
welche Faktoren für eine gelungenen Kommunikation aus Sicht der oben genannten
Kommunikationsmodelle von Bedeutung sind.
Der Aufbau dieser Arbeit ist wie folgt gestaltet. Um Fehlinterpretationen und
Missverständnisse zu vermeiden werden die wichtigsten Begriffe für diese Arbeit definiert.
Es folgt ein kurzer Abriss der geschichtlichen Entwicklung und Grundlagen des
Pragmatischen Ansatzes von Watzlawick at al.. Anschließend werden Die Pragmatischen
Axiome ausführlich dargestellt und mit Beispielen illustriert. Für ein umfassenderen Einblick
werden die Pragmatische Axiome in die Modelle der Kommunikation eingeordnet
und es wird eine kritische Würdigung vorgenommen.
Der Aufbau und die Struktur des Teufelskreis-Modell wird unter Verwendung
einer Grafik vorgestellt. In einer kurzen Gegenüberstellung beider Modelle wird beleuchtet,
welche Inhalte es Pragmatischen Ansatzes sich im Teufelskreis-Modell wieder finden
bzw. weiter entwickelt oder modifiziert wurden.
Um zu zeigen wie nun tatsächlich praktische Kommunikationskonflikte gelöst
werden könnten, wird als praktisches Beispiel ein Mutter-Sohn-Konflikt vorgestellt. Dieser
Kommunikationskonflikt wird mit Hilfe des Teufelskreis-Modells unter Einbeziehung
des Pragmatischen Ansatzes analysiert und ausgewertet.
Einleitung
Oft unberührt von Theorien und Modellen tun Menschen täglich das, was allge- mein Kommunikation genannt wird. Nicht immer kommt dabei eine, für alle Beteiligten, befriedigende Kommunikation zustande. In den alltäglichen, spontanen Formen der zwi- schenmenschlichen Kommunikation entstehen durch Fehlinterpretationen Miss- verständnisse zwischen den Beteiligten. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen für den weiteren Kommunikationsverlauf.
Mit Hilfe des Pragmatischen Ansatzes von Watzlawick at al. und des Teufelskreis- Modells von Schulz von Thun soll die Wirkung der Meta-Ebene von Kommunikation dargestellt werden. Es wird der Frage nachgegangen, welche Bedeutung Metakommuni- kation bei Kommunikationsproblemen hat und welche Rolle dabei die nonverbale Kommunikation spielt. Diese Arbeit soll mit Hilfe des praktischen Problems auch zeigen, welche Faktoren für eine gelungenen Kommunikation aus Sicht der oben genannten Kommunikationsmodelle von Bedeutung sind.
Der Aufbau dieser Arbeit ist wie folgt gestaltet. Um Fehlinterpretationen und Missverständnisse zu vermeiden werden die wichtigsten Begriffe für diese Arbeit defi- niert. Es folgt ein kurzer Abriss der geschichtlichen Entwicklung und Grundlagen des Pragmatischen Ansatzes von Watzlawick at al.. Anschließend werden Die Pragmatischen Axiome ausführlich dargestellt und mit Beispielen illustriert. Für ein umfassenderen Ein- blick werden die Pragmatische Axiome in die Modelle der Kommunikation eingeordnet und es wird eine kritische Würdigung vorgenommen.
Der Aufbau und die Struktur des Teufelskreis-Modell wird unter Verwendung einer Grafik vorgestellt. In einer kurzen Gegenüberstellung beider Modelle wird beleuch- tet, welche Inhalte es Pragmatischen Ansatzes sich im Teufelskreis-Modell wieder finden bzw. weiter entwickelt oder modifiziert wurden.
Um zu zeigen wie nun tatsächlich praktische Kommunikationskonflikte gelöst werden könnten, wird als praktisches Beispiel ein Mutter-Sohn-Konflikt vorgestellt. Die- ser Kommunikationskonflikt wird mit Hilfe des Teufelskreis-Modells unter Einbezie- hung des Pragmatischen Ansatzes analysiert und ausgewertet.
Begriffsdehnition
Modell
Modelle sind vereinfachende Darstellungen der Realität. Diese Vereinfachungen machen es möglich, komplexe Zusammenhänge und Vorgänge besser zu verstehen. Die vorzustellenden Modelle bilden auch nur ausgewählte Aspekte von Kommunikation ab. Das bedeutet, nicht jedes Phänomen der Kommunikation soll mit ihnen erklärt werden können, wohl aber die isolierten Aspekte, auf die sich das jeweilige Modell bezieht. Die hier vorgestellten Modellen der Kommunikation können helfen, bei zwischenmenschli- chen Kommunikationsproblemen, die Ursachen zu lokalisieren.
Kommunikation
Der Begriff Kommunikation hat seinen Ursprung in der lateinischen Sprache. Der lateinische Begriff co mmuni c ati o hat die Bedeutung von Verbindung, Mitteilung.
Die große Anzahl von Definitionen des Kommunikationsbegriffes weißt darauf hin, dass es sich bei der Kommunikation um ein sehr vielgestaltiges, von verschiedenen Perspektiven zu betrachtendes Thema handelt, dass auch unterschiedlichste Anwendun- gen hervorbringt. Die hier angebotenen Definitionen des Kommunikationsbegriffes, dienen dem möglichst unmissverständlichen Rezipieren dieser Hausarbeit und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Ganz allgemein ist Kommunikation eine „Sammelbezeichnung für alle Vorgänge, in denen eine bestimmte Information gesendet (signalisiert) und empfangen wird, auch wenn es nicht wechselseitig geschieht; hierzu zählt z.B. jede Organismusreaktion auf Umweltreize oder die lineare Informationsübertragung zwischen Sender und Empfänger.
K. wird zur sozialen Interaktion, wenn sie mit Hilfe von Signalen und Symbolen einen Prozeß wechselseitiger Beeinflussung der K.spartner in Gang setzt. Der Informati- onsaustausch erfolgt über Zeichensysteme, die vorher verabredet werden müssen (z.B. eine bestimmte Sprache oder Schrift).“ (Humboldt-Psychologie-Lexikon, 1990, S. 184)
Als Bestandteile zwischenmenschlicher Kommunikation werden von H. Schmidtmann (2006) Sender, Inhalt, Beziehung, Empfänger, Situation herausgestellt. Diese Begriffe finden sich in beiden, der hier vorgestellten, Theorien wieder, dienen der Beschreibung von Kommunikation und werden auch in dieser Arbeit benutzt.
Der Ansatz von Schulz von Thun und Watzlawick at al. lässt sich gut mit Zitat von W. Frindte charakterisieren: „Kommunikation ist ein sozialer Prozess, in dessen Verlauf sich die beteiligten Personen wechselseitig zur Konstruktion von Wirklichkeit anregen.“ (W. Frindte, 2001, S. 17) Kommunikation kann differenziert werden in sprachliche, nichtsprachliche und ver- bale, nonverbale Kommunikationsanteile.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. Modalitäten der Kommunikation nach W. Rechtien (2002, S. 17)
Metakommunikation
Metakommunikation ist eine Kommunikation ü be r die Kommunikation. Ein Kommunikationsverhältnis wird zum Gegenstand eines Informationsaustausches ge- macht. (Dorsch - Psychologisches Wörterbuch, 1998, S. 535) Metakommunikation meint aber auch, dass dem inhaltlich, sprachlich formulierten Anteil einer Kommunikati- on, der nichtverbale Beziehungsanteil (Metakommunikation) gegenübersteht, bei dem der Sender z.B. durch Gesten, Mimik, Stimmenführung mitteilt, wie er die Information verstanden haben will. (Humboldt-Psychologie-Lexikon, 1990, S. 223)
Entwicklung und Grundlage des Pragmatischen Ansatzes von Watzlawick at al. Paul Watzlawick (1921-2007), studierte in Venedig Philosophie und wurde nach seiner Promotion am C. G. Jung-Institut in Zürich zum Psychotherapeuten ausgebildet. Im Jahre 1957 wurde er an die Universität in El Salvador berufen. 1960 wechselte er an das Mental Research Institute in Palo Alto/Kalifornien. Dort war er als Wissenschaftler und Psychotherapeut tätig. Auf der Internetseite des Mental Research Institute wird er als Pio- nier in der Familientherapie, der Systemtheorie und in der konstruktivistischen Philosophie gewürdigt.
Der systemische Ansatz, betrachtet in welchem Verhältnis die einzelnen Bestandteile der Kommunikation zu einander stehen und wie sie das Verhalten der Individuen beein!ussen. Watzlawick betonte auf der Konferenz „Evolution of Psycho- therapy“ (Hamburg 1994), dass natürlich auch beim systemischen Ansatz der Mensch im Minelpunkt stehe. Der systemische Ansatz ermöglicht ein Verständnis, in welcher Art und Weise die Personen miteinander kommunizieren, um dann mit der Person weiter arbeiten zu können, die am ehesten Veränderungen bewirken kann. Patient ist nicht ein Einzelner, sondern eine Beziehung.
Zusammen mit Janet H. Beavin und Don D. Jackson erarbeitete er die Pragmati- schen Axiome. Sie entstanden als Ergebnis der therapeutischen Arbeit. Dabei formulie- ren Watzlawick at al. vorsichtig, dass es sich um versuchsweise Formulierungen handelt, die weder Anspruch auf Vollständigkeit oder Endgültigkeit erheben. ( Watzlawick at al., 2000, S. 50, 70)
Watzlawick at al. sehen eine Dreiteilung der menschlichen Kommunikation in Syntaktik, Semantik und Pragmatik. Die Syntaktik ist das Gebiet der Informationstheoreti- ker, die sich mit der Nachrichtenübertragung (Code, Kanäle, Kapazität, Rauschen, Re- dundanz) beschäftigen. Mit der Bedeutung von Symbolen und Signalen setzt sich die Se- mantik auseinander. Es ist möglich Symbolserien mit syntaktischer Genauigkeit zu über- mitteln. Sie würden aber sinnlos bleiben, wenn sich Sender und Empfänger nicht vorher über ihre Bedeutung geeinigt hätten. Der Pragmatische Aspekt ist, dass jede Kommunikati- on das Verhalten der Teilnehmenden beeinflusst. Watzlawick at al. weisen darauf hin, dass der Schwerpunkt ihrer Arbeit hauptsächlich auf den verhaltensmäßigen Auswirkungen der Kommunikation, der Pragmatik, liegt. (Watzlawick at al., 2000, S. 22, 23)
Pragmatische Axiome nach Paul Watzlawick, Janet H. Beavin und Don D. Jackson
1. Axiom - „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ (Watzlawick at al., 2000, S. 53)
Mit diesem Axiom wird beschrieben, dass jegliches menschliches Verhalten als Kommunikation interpretiert wird. Es ist nicht nur die verbale Form, sondern auch die nonverbale Form der Kommunikation gemeint.
Watzlawick at al. beobachteten, dass schizophrene Menschen versuchen, nicht zu kommunizieren. Da aber auch Teilnahmslosigkeit und Schweigen Mitteilungscharakter haben und auch die Vermeidung von Kommunikation selbst Kommunikation ist, befin- den sich schizophrene Menschen in einem Dilemma. (Watzlawick at al. 2000, S. 53)
Das „Material“ jeglicher Kommunikation besteht nicht nur aus Worten, sondern auch aus paralinguistischen Phänomenen wie, Tonfall, Schnelligkeit der Sprache, Pausen, Lachen, Seufzen und Körperhaltung, Ausdrucksbewegungen (Körpersprache). Verhal- ten in zwischenmenschlichen Situationen hat immer Mitteilungscharakter. Auch Schwei- gen und Nichthandeln haben Mitteilungscharakter. Verhalten hat kein Gegenteil! Man kann sich nicht nicht verhalten. (Watzlawick at al. 2000, S. 51)
Ein Eltern-Kind-Phänomen lässt sich mit dem ersten Axiom gut darstellen. Wenn sich Kinder allein beschäftigen, ist das meist mit einer gewissen Geräuschkulisse (Stim- men, Klopf- und Klappergeräusche, Fußgetrappel) verbunden. Die Eltern interpretieren mit ihren Erfahrung diese Geräusche und schließen auf die Tätigkeiten im Kinderzim- mer. Für die meisten Eltern ist aber gerade das Ausbleiben jeglicher Signale (Geräu- schen), die Stille aus dem Kinderzimmer, höchstes Alarmsignal. Aus der Alltagserfahrung wissen sie, dass Kinder oft besonders still sind, wenn diese verbotenen oder unerwünsch- te Dinge tun. In dem die Kinder nun versuchen keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, in dem sie, mehr oder weniger bewusst, keine Signale senden, um damit Sanktionen der Eltern zu entgehen, passiert genau das Gegenteil. Die Eltern kommen, alarmiert von der Stille im Kinderzimmer und kontrollieren ob alles in Ordnung ist. Der Versuch, der Kin- der, nicht zu kommunizieren ist gescheitert. Denn Eltern interpretieren auch Ruhe bzw. Stille als Mitteilung, Signal. Da, wie im dritten Axiom beschrieben wird (siehe unten), Kommunikation zirkulär ist, lernen die Kinder daraus. Beim nächsten mal, wenn sie et- was Verbotenes oder Unerwünschtes tun wollen, täuschen sie mit Geräuschen eine ande- re Tätigkeit vor, in der Hoffnung ungestört ihr eigentliches Ziel verfolgen zu können.
[...]