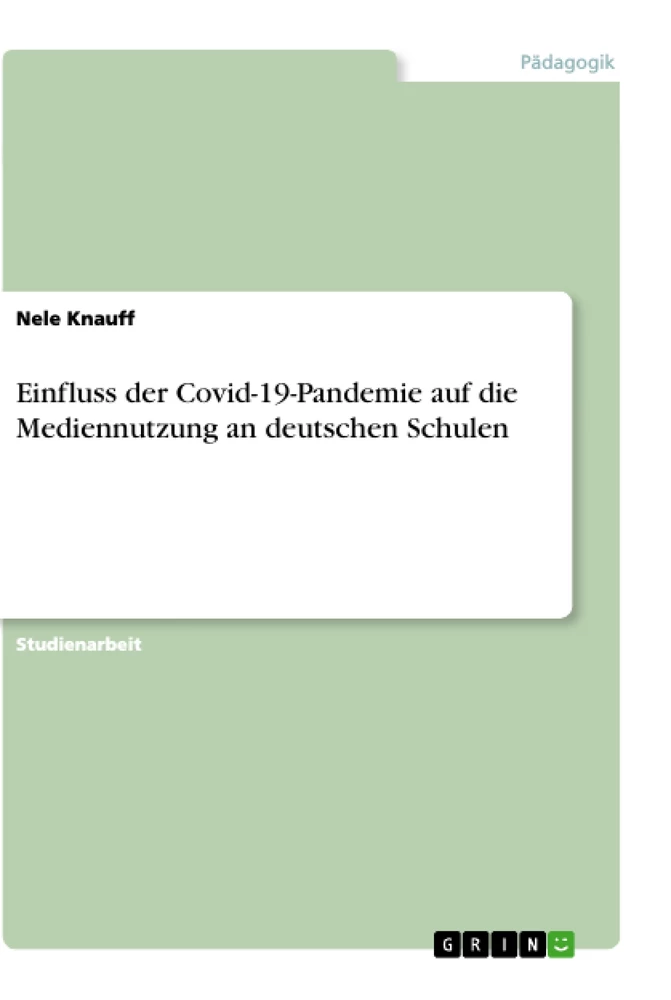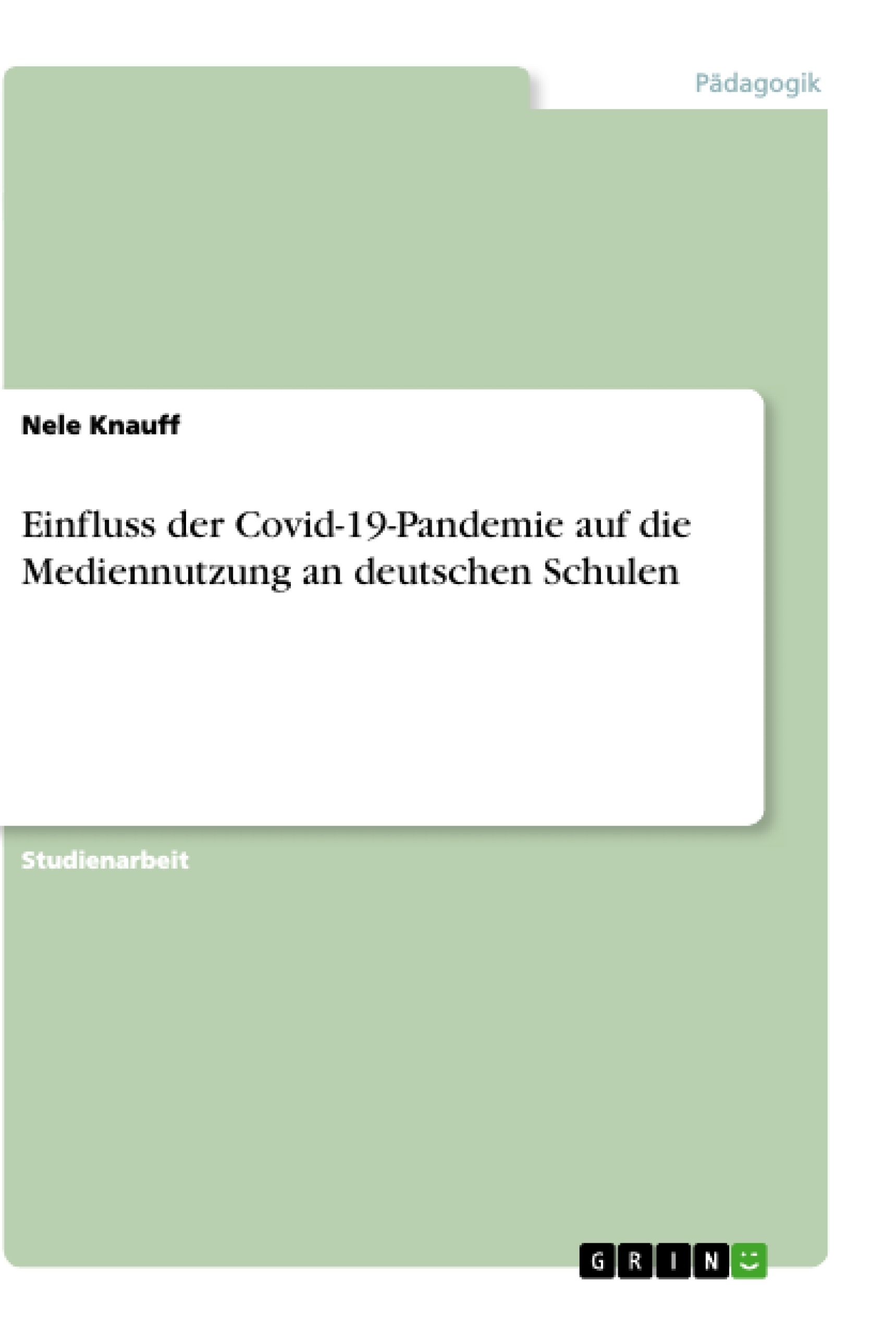"Deutschlands Schulen bei der Digitalisierung noch hinter Moldawien", "Pisa-Auswertung zeichnet düsteres Bild in Deutschland" oder "Deutschland weit abgeschlagen" sind nur einige Überschriften, die die Sonderauswertung der Pisa Studie 2018 beschreiben. Alle drei Jahre finden die Studien des "Programme for International Student Assessment" (PISA) statt. Die Sonderauswertung der aktuellen Studie weist einen deutlichen Nachholbedarf im Bereich der Digitalisierung von Schulen sowie Schülerinnen und Schülern auf
.
Die weiter vorherrschende Covid-19-Pandemie bestätigt die Ergebnisse der Studie und gibt Raum für viel Diskussion rund um die Digitalisierung und die Mediennutzung an deutschen Schulen. Doch wie genau änderte sich die Mediennutzung aufgrund des Pandemiegeschehens? Dieser Frage geht die vorliegende Arbeit auf den Grund und vergleicht dafür unter anderem Ergebnisse der Studien "Kindheit, Internet, Medien" aus den Jahren 2018 und 2020, eine Studie des Leibniz-Instituts für Medienforschung und eine der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Vergleich der Mediennutzung vor und während der Pandemie mündet in einen Überblick über Veränderungen und eine Diskussion mit folgendem Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Mediennutzung an deutschen Schulen vor der Covid-19-Pandemie
3. Mediennutzung während der Pandemie
4. Diskussion
5. Ausblick
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Deutschlands Schulen bei der Digitalisierung noch hinter Moldawien“, „Pisa-Auswertung zeichnet düsteres Bild in Deutschland“ oder „Deutschland weit abgeschlagen“ sind nur einige Überschriften, die die Sonderauswertung der Pisa Studie 2018 beschreiben (Warnecke, 2020). Alle drei Jahre finden die Studien des „Programme for International Student Assessment“ (PISA) statt. Die Sonderauswertung der aktuellen Studie weist einen deutlichen Nachholbedarf im Bereich der Digitalisierung von Schulen sowie Schülerinnen und Schülern auf (Warnecke, 2020).
Die weiter vorherrschende Covid-19-Pandemie bestätigt die Ergebnisse der Studie und gibt Raum für viel Diskussion rund um die Digitalisierung und die Mediennutzung an deutschen Schulen. Doch wie genau änderte sich die Mediennutzung aufgrund des Pandemiegeschehens? Dieser Frage geht die vorliegende Arbeit auf den Grund und vergleicht dafür unter anderem Ergebnisse der Studien „Kindheit, Internet, Medien“ aus den Jahren 2018 und 2020, eine Studie des Leibniz-Instituts für Medienforschung und eine der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Vergleich der Mediennutzung vor und während der Pandemie mündet in einen Überblick über Veränderungen und eine Diskussion mit folgendem Ausblick.
2. Mediennutzung an deutschen Schulen vor der Covid-19-Pandemie
Wie eingangs erwähnt, vergleicht diese Arbeit die Situationen vor der Pandemie, währenddessen und stellt Veränderungen dar.
In diesem Abschnitt wird die Mediennutzung an deutschen Schulen vor der Pandemie offengelegt.
Im Jahr 2018 erfolgte die letzte Befragung durch PISA. Sie untersucht alle drei Jahre 37 westlich orientierte Industriestaaten, die sich im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zusammengeschlossen haben (Bundeszentrale für politische Bildung, 2016). 2018 nahmen insgesamt 32 Millionen 15-Jährige aus 79 Ländern teil, darunter 5451 Schülerinnen und Schüler von 226 deutschen Schulen (Warnecke, 2020).
Die Studie kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass in Deutschland lediglich 0,61 Computer pro Lernenden zur Verfügung stehen, das ist deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von 0,85. Vorreiter in diesem Bereich sind beispielsweise Luxemburg (1,6) und die USA sowie Großbritannien mit 1,5 (Warnecke, 2020). Zudem hat die Qualität der Geräte im Vergleich zur vorangegangenen Studie nachgelassen. Zu diesem Zeitpunkt waren 18 Prozent der Geräte tragbar, im Jahr 2018 betrifft dies lediglich 7,3 Prozent (Warnecke, 2020). Des Weiteren zeigt die Pisa Studie, dass nur 33 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Deutschland Zugang zu digitalen Lernplattformen haben. Im OECD-Durchschnitt sind es mehr als 54 Prozent. Besonders weit vorne liegen Singapur, Teile Chinas und Dänemark mit über 90 Prozent (Warnecke, 2020). Darüber hinaus forscht die Studie auch im Bereich der Weiterbildung von Lehrkräften. Auch hier ist Deutschland weit abgeschlagen und belegt Platz 76, denn nur 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler besuchen Schulen, an denen Möglichkeiten zur digitalen Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer bestehen (Warnecke, 2020).
Abschließend ist noch zu nennen, dass in Deutschland ein großes Gefälle zwischen sozial benachteiligten und bessergestellten Lernenden sichtbar ist, so haben 7 Prozent der Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Familien weniger Zugang zu digitalen Lernplattformen (Warnecke, 2020).
Weiterführend zu den Ergebnissen der PISA-Studie bringt die Studie „Kindheit, Internet, Medien“ Informationen zu der genauen Nutzung von digitalen Medien an Schulen. Sie untersuchte 1.171 Schülerinnen und Schüler im Alter von sechs bis 13 Jahren (Feierabend, S., Rathgeb, T. & Reutter, T., 2019, S. 51).
Die Ergebnisse sind unterteilt in die Nutzung zu Hause und in der Schule. Für diese Arbeit sind vor allem die Ergebnisse, die die Schule widerspiegeln von Interesse, sie sind in Prozent angegeben und stellen die einmalige Nutzung pro Woche dar.
Sie zeigen, dass 31 Prozent der Kinder angeben, mindestens einmal pro Woche einen Computer im Unterricht zu nutzen (Feierabend et al., 2019, S. 50). Darauf folgt die Nutzung von Smartphones (16%) und von Laptops (15%). Weniger genutzt werden Whiteboards (11%) und Tablets (8%) (Feierabend et al., 2019, S.50). Insgesamt zeigt die Umfrage, dass ältere Lernende im Unterricht mehr digitale Medien nutzen als jüngere Kinder (Feierabend et al., 2019, S. 50).
Die Geräte, die im Unterricht genutzt werden, dienen überwiegend zum Schreiben von Texten, das gibt ungefähr ein Drittel der Befragten an (Feierabend et al., 2019, S. 51). Darauf folgen Internetrecherche (24%) und die Nutzung von Lernprogrammen (23%). Weniger genutzt werden digitale Medien zum Kommunizieren (14%) oder Schauen von Filmen und Videos (13%). Das Schlusslicht in der Nutzung bildet die Bildbearbeitung (11%) (Feierabend et al., 2019, S. 51).
Anders als in den vorangegangenen Studien befragten Lohr und Kollegen (2021) in ihrer Untersuchung zum Thema digitale Bildung an bayerischen Schulen vor und während der Corona-Pandemie auch Lehrkräfte. Die Befragung wurde an Grund- und weiterführenden Schulen durchgeführt. Im Folgenden werden erst die Ergebnisse der Befragung an Grundschulen dargestellt und darauffolgend die der weiterführenden Schulen.
Eingangs wurden die Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügbarkeit digitaler Medien befragt, dazu werden für die vorliegende Arbeit nur die wichtigsten, beziehungsweise die Medien genannt, die auch für die Lernenden von Bedeutung sind.
Von den Befragten geben 86 Prozent an in jedem Klassenzimmer einen Beamer zu haben, in 14 Prozent der Fälle lediglich in zentralen Räumen (Lohr et al., 2021, S. 18). Als zweites folgen die Dokumentenkameras, die zu 75 Prozent in jedem und zu 21 Prozent in zentralen Räumen zur Verfügung stehen. Stationäre Computer haben 56 Prozent in jedem Klassenzimmer und 38 Prozent in zentralen Räumlichkeiten (Lohr et al., 2021, S. 18). Entgegengesetzt verhält es sich bei den Notebooks, diese befinden sich lediglich zu 37 Prozent in jedem Klassenzimmer, allerdings zu 52 Prozent in zentralen Räumen der Schule (Lohr et al., 2021, S. 18). Auch Smartboards sind eher in zentralen Räumen (48%) als in jedem Klassenzimmer zu finden (22%). Ähnlich verhält es sich mit der Verfügbarkeit von Tablet Computern, die sich auch nur zu 19 Prozent in den Klassenräumen wiederfinden, wohingegen sie zu 43 Prozent zentral verfügbar sind (Lohr et al., 2021, S. 18).
Zu den genannten Geräten wurden die Lehrkräfte auch zu ihrer Nutzung im Unterricht befragt. 87 Prozent geben an den Beamer täglich zu nutzen, ein geringer Teil (2%) nutzt ihn mindestens einmal in der Woche (Lohr et al., 2021, S. 32). Dokumentenkameras werden ebenfalls sehr häufig genutzt, zu 64 Prozent täglich und 17 Prozent geben an, sie einmal in der Woche zu nutzen (Lohr et al., 2021, S. 32). Stationäre Computer hingegen werden deutlich seltener benutzt. 35 Prozent nutzen sie täglich und 19 Prozent einmal pro Woche (Lohr et al., 2021, S. 32). Dicht gefolgt geben 34 Prozent der Lehrkräfte an Smartboards täglich zu nutzen, 27 Prozent wöchentlich (Lohr et al., 2021, S. 32). Dahinter befinden sich in der Befragung Notebooks, die von 22 Prozent täglich genutzt werden und von 28 Prozent wöchentlich (Lohr et al., 2021, S. 32).
[...]