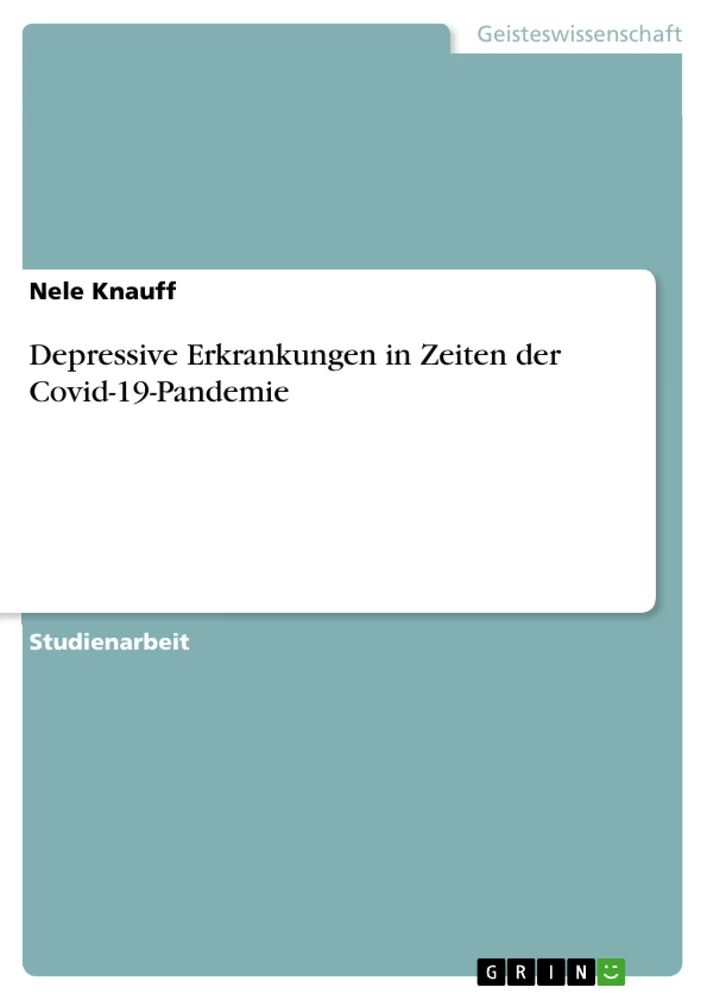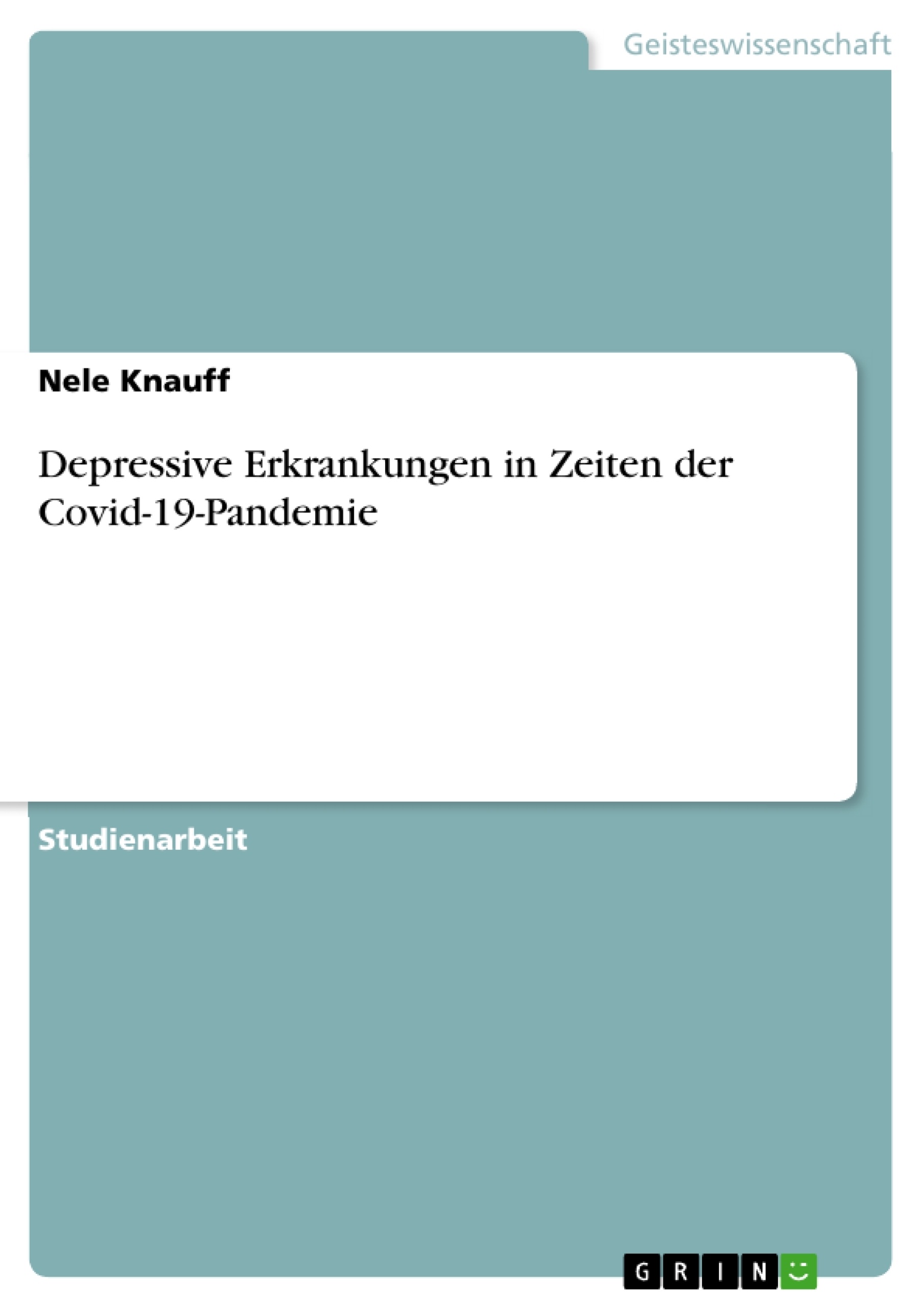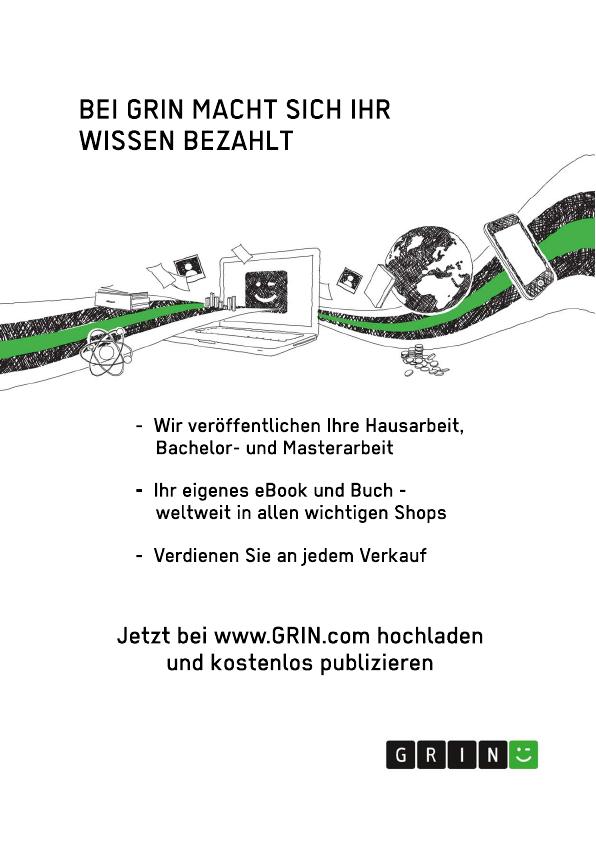In Deutschland erkranken laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. (2021) jährlich 27,8 Prozent der Erwachsenen an psychischen Erkrankungen. Das entspricht 17,8 Millionen Menschen. Die häufigsten Erkrankungen sind Angststörungen (15,4%) und affektive Störungen, die in unipolare Depression (9,8%) und bipolare Depression (8,2%) unterteilt werden (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V., 2021). Damit zählen psychische Erkrankungen zu den vier wichtigsten Ursachen für Einschränkungen in der Gesundheit und verringern die Lebenserwartung von Betroffenen um ungefähr 10 Jahre (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V., 2021).
Die Jahre 2020 und 2021 waren aufgrund der Covid-19-Pandemie einschneidende Jahre in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens. Daher beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit den Einflüssen der Pandemie auf depressive Erkrankungen. Dabei geht sie auf die Neuerkrankungen in Deutschland ein und behandelt nicht die möglichen Veränderungen bei bereits erkrankten Patientinnen und Patienten. Dafür wird zu Beginn ein Grundstein für das Verständnis dieser Erkrankung gelegt und das Krankheitsbild beschrieben sowie die Prävalenz und die Risiko- und Schutzfaktoren dargestellt. Darauf folgt die Darlegung der Lage vor der Covid-19-Pandemie und die Veränderungen durch diese. Abschließend werden die Ergebnisse diskutiert und münden in einen Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Depressionen als Krankheitsbild
2.1 Prävalenz
2.2 Risiko- und Schutzfaktoren
3. Depressive Erkrankungen vor der Covid-19-Pandemie
4. Einfluss der Pandemie auf Depressionen
5. Diskussion
6. Ausblick
7. Literaturverzeichnis