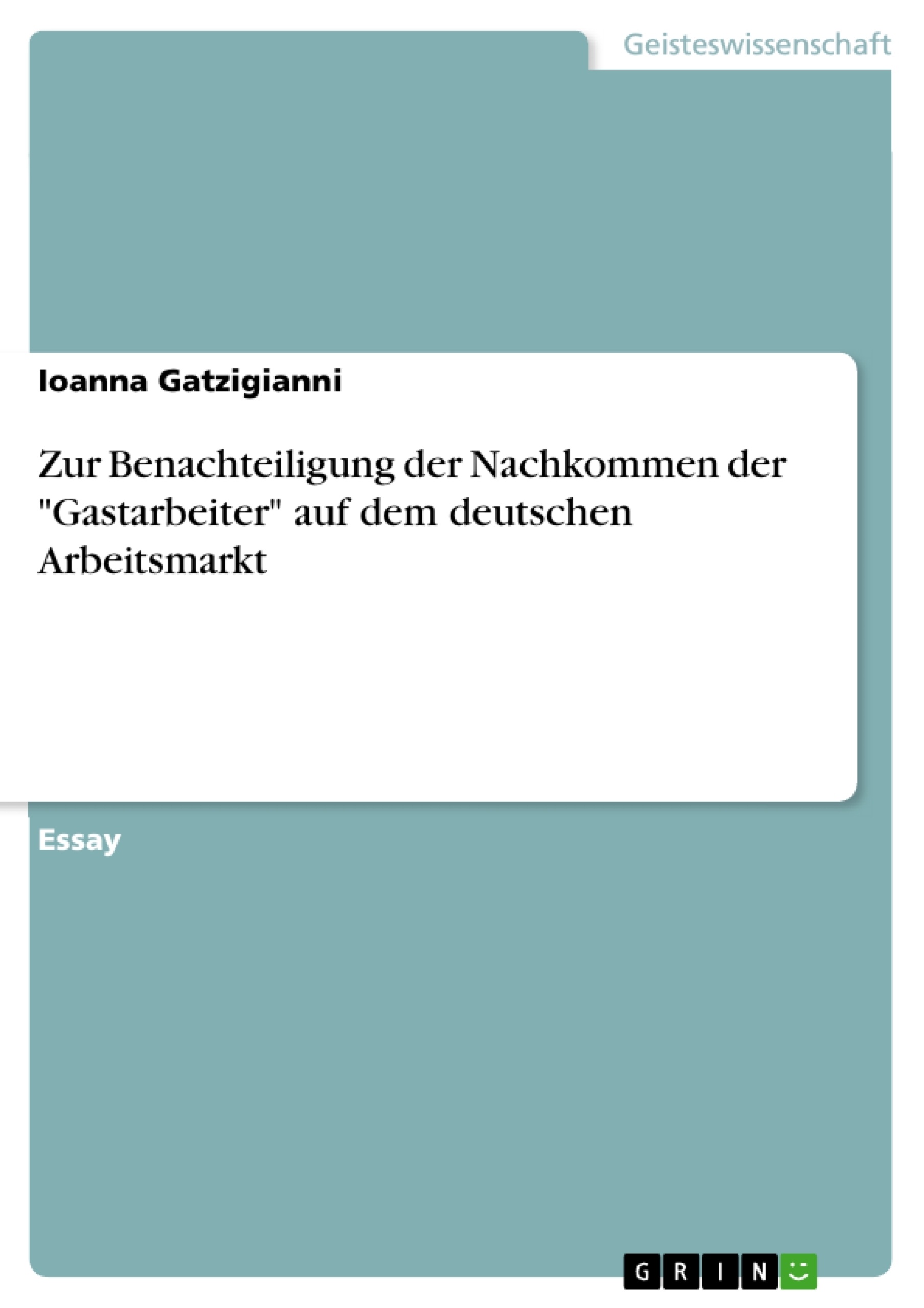Die Einwanderungsgeschichte der Bundesrepublik nach dem 2. Weltkrieg ist besonders geprägt durch die Gruppe der „Gastarbeiter“, der nach Deutschland angeworbenen Arbeitsmigranten, und ihrer Familienangehörigen. Diese bilden seit Beginn der Anwerbung bis heu-te einen quantitativ bedeutenden Teil in der Gesellschaft Deutschlands. Ihre Einwanderung hatte und hat Auswirkungen einerseits auf ihre individuelle Lebenssituation und andererseits auf die bundesrepublikanische Gesellschaft. Untersuchungen über Art und Bedeutung der sozialstrukturellen Lage dieser Gruppe wurden in zahlreichen soziologischen Studien vorgenommen. In seiner bedeutenden migrationstheoretischen Auseinandersetzung beschrieb Hoffmann-Nowotny die sozialstrukturelle Positionierung der angeworbenen Arbeitsmigranten mit dem Begriff der „Unterschichtung“. Demnach traten diese Einwanderer in den entschei-denden Dimensionen der Sozialstruktur, also berufliche Stellung, Einkommen und Wohnsitu-ation, in die untersten Positionen derselben ein. (Hoffmann-Nowotny, 1987).
Die Pioniermigranten wurden für die untersten Stufen der beruflichen und betrieblichen Hie-rarchien angeworben und so im untersten Segment des Arbeitsmarktes beschäftigt. Größtenteils verblieben sie dort auch in der gesamten Phase ihrer Erwerbstätigkeit, da ihre Sprachkenntnisse, ihr Bildungs- und Qualifikationsniveau zu gering waren, um eine andere Position auf dem Arbeitsmarkt zu erlangen . Daraus ergaben sich geringere Einkommen und schlechtere Wohnbedingungen als weitere Kennzeichen ihrer sozialen Lage (Hoffmann-Nowotny, 1987; Heckmann, 1992; Geissler 2006). Strukturell gelten daher die Arbeitsmigranten der ersten Generation als unzureichend integriert.
Hier geht es nun darum, wie sich die Lage der in Deutschland geborenen und aufgewachsenen Kinder und Enkel dieser Pioniergeneration darstellt. Haben sie den „Aufstieg“ auf dem deut-schen Arbeitsmarkt geschafft? Hat eine intergenerationale, soziale Mobilität stattgefunden oder ist eine strukturelle Verfestigung der Benachteiligung zu beobachten? Wenn man davon ausgeht, dass sich Assimilationsprozesse über mehrere Generationen vollziehen, wäre zu erwarten, dass die hier geborenen und aufgewachsenen Kinder der Arbeitsmigranten eine bessere Arbeitsmarktposition aufweisen als ihre Eltern.
Zur Benachteiligung der Nachkommen der "Gastarbeiter" auf dem deutschen Arbeitsmarkt
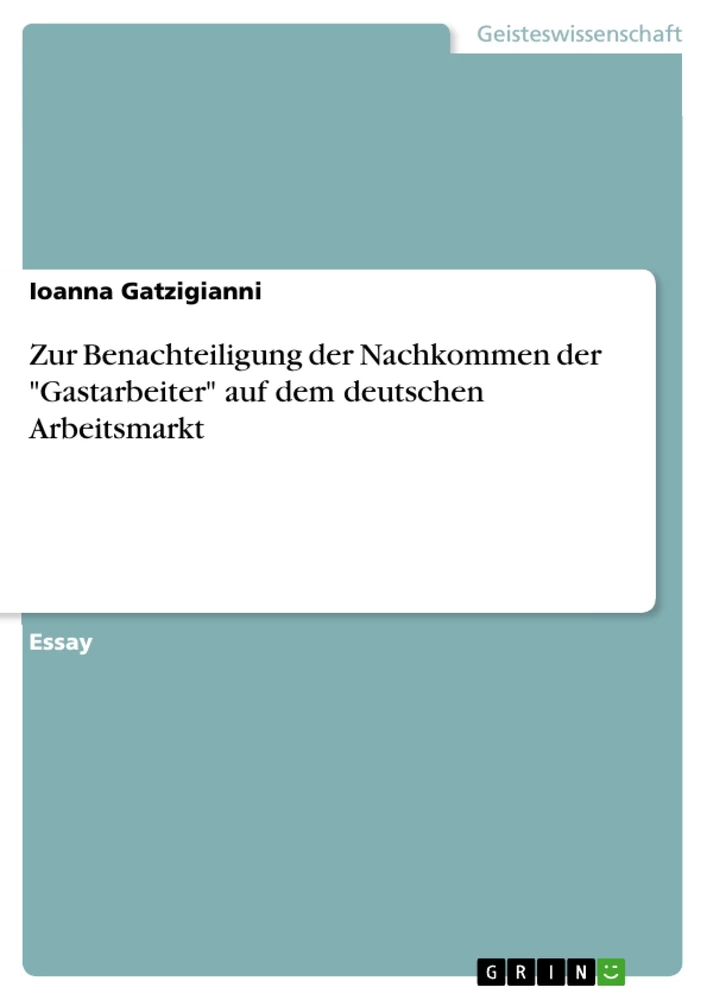
Essay , 2007 , 6 Seiten , Note: 1,3
Autor:in: Ioanna Gatzigianni (Autor:in)
Soziologie - Arbeit, Ausbildung, Organisation
Leseprobe & Details Blick ins Buch