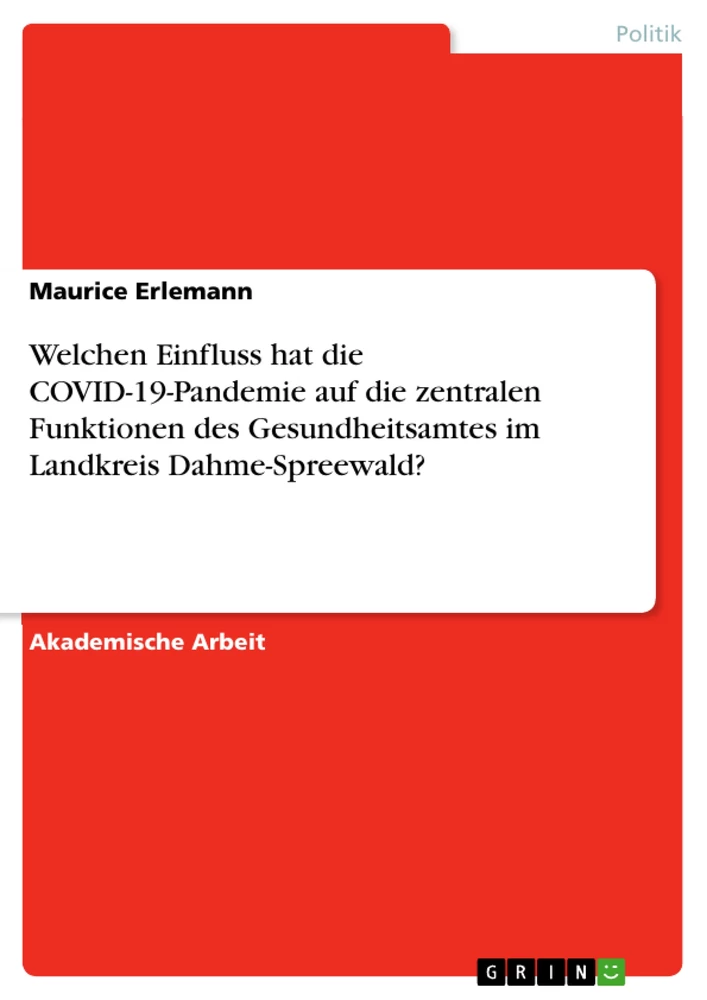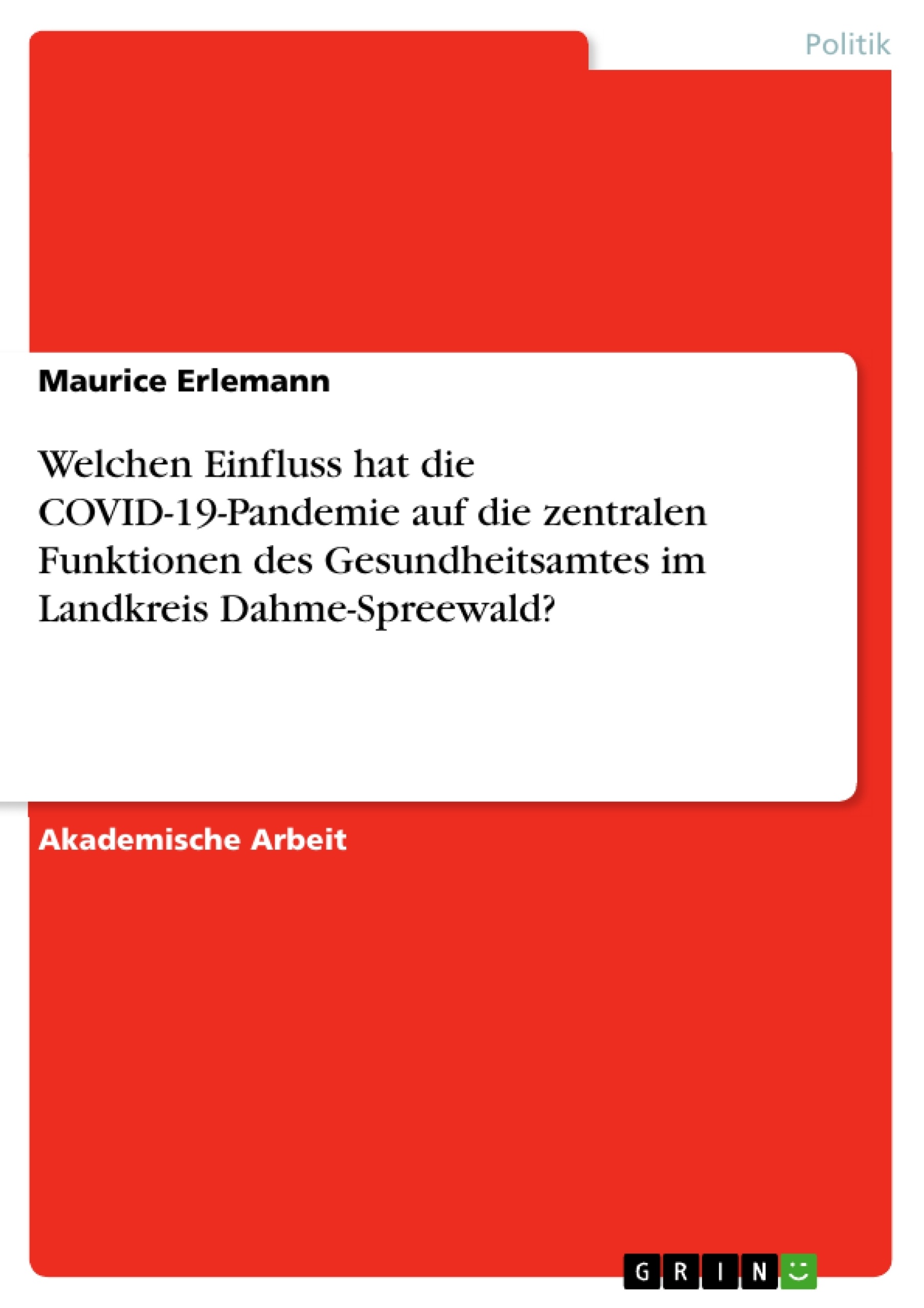Der Kern dieser Studie besteht in den Auswirkungen der Situation auf die zentralen Aufgaben der Ämter, welche auch außerhalb der Pandemie zum Erhalt der allgemeinen Gesundheit der Bevölkerung erledigt werden müssen. Demnach wird in dieser Fallstudie hypothetisch von einem negativen Effekt auf die Arbeit des ÖDG ausgegangen. Das im späteren Verlauf gewählte Fallbeispiel ist der brandenburgische Landkreis Dahme-Spreewald beziehungsweise das in diesem Landkreis zuständige Gesundheitsamt mit Hauptsitz in Königs Wusterhausen, wo die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf dessen Aufgaben anhand der vorhandenen Datenlage ermittelt werden sollen.
Die Relevanz der Thematik liegt eindeutig in dessen Aktualität aufgrund der weiterhin anhaltenden pandemischen Lage, sowie in der bereits vorher misslichen Situation des öffentlichen Gesundheitsdienstes aufgrund finanzieller Engpässe und Mangel an Personal, sowohl bezogen auf den Nachwuchs als auch auf die Aussparung von Beschäftigungsstellen. Von daher soll bestmöglich erörtert werden, wie groß die Auswirkungen der Pandemie sind, bzw. wie sich
die allgemeine Auslastung der Gesundheitsämter in dieser Zeit geändert hat. Demzufolge bildet die Erläuterung der Aufgaben der Gesundheitsämter sowie deren Konstellation im bundesdeutschen, aber aufgrund der Thematik insbesondere brandenburgischen Kontext, die erste Phase dieser Fallstudie.
Zum Zweiten werden diese Aufgaben mit den Begebenheiten der COVID- 19-Pandemie in Verbindung gebracht, bzw. inwiefern die Gesundheitsämter ihren essentiellen Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens leisten. In der dritten Phase wird der Fokus explizit auf den Landkreis Dahme-Spreewald und dessen Gesundheitsamt gelegt und mithilfe der verfügbaren Publikationen eine Korrelation zwischen dessen Arbeit und der pandemischen Lage festgestellt. Vorab muss jedoch erwähnt werden, dass es sich bei dieser Fallstudie um eine Auswertung von Daten aus der kommunalen Verwaltungsebene handelt, weswegen die allgemeine Verfügbarkeit von Studien oder etwaigen wissenschaftlichen Literaturen, anders als auf der Ebene der Bundesländer oder des Bundes, ziemlich rar sein dürfte.
Auch der Forschungsstand bezüglich der Pandemie ist nach lediglich zumindest gegeben, aber dennoch ausgedünnt. Aus diesem Grund kann sich in der empirischen Analyse nur auf Herausgaben des Gesundheitsamtes Dahme-Spreewald selbst bezogen werden.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Das Gesundheitsamt als kommunale Institution
2.1. Struktur und gesetzlicher Rahmen
2.2. Aufgaben
3. Aufgabenspektrum der Gesundheitsämter während der pandemischen Lage
4. Fallbeispiel Landkreis Dahme-Spreewald
4.1. Institutioneller Rahmen im brandenburgischen Kontext
4.2. Einfluss der Pandemie auf die Aufgaben des Gesundheitsamtes
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis