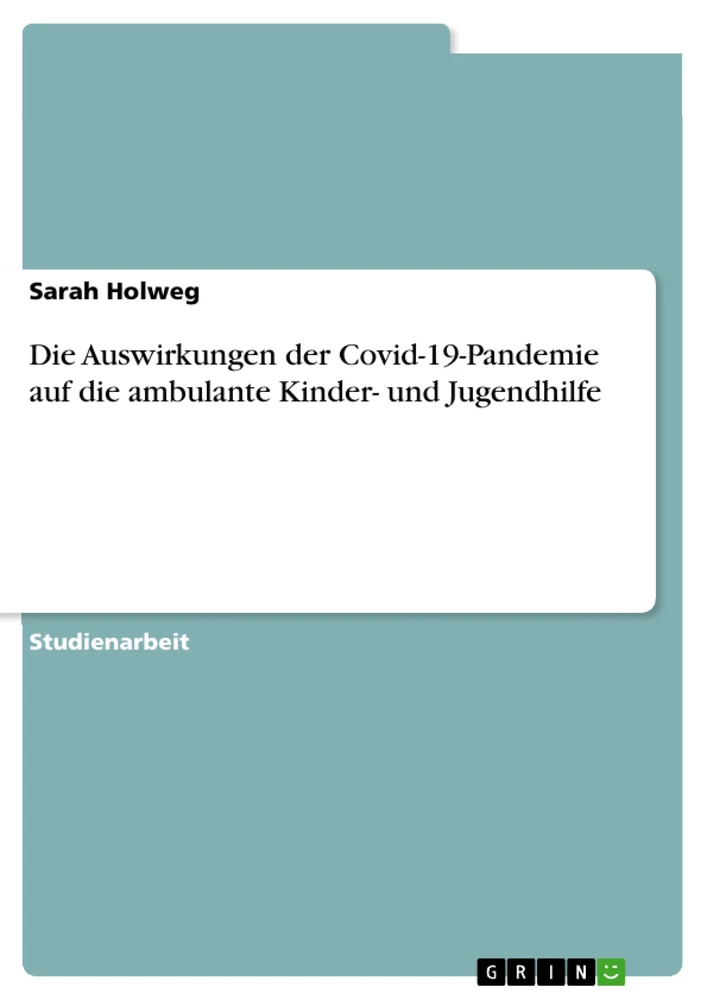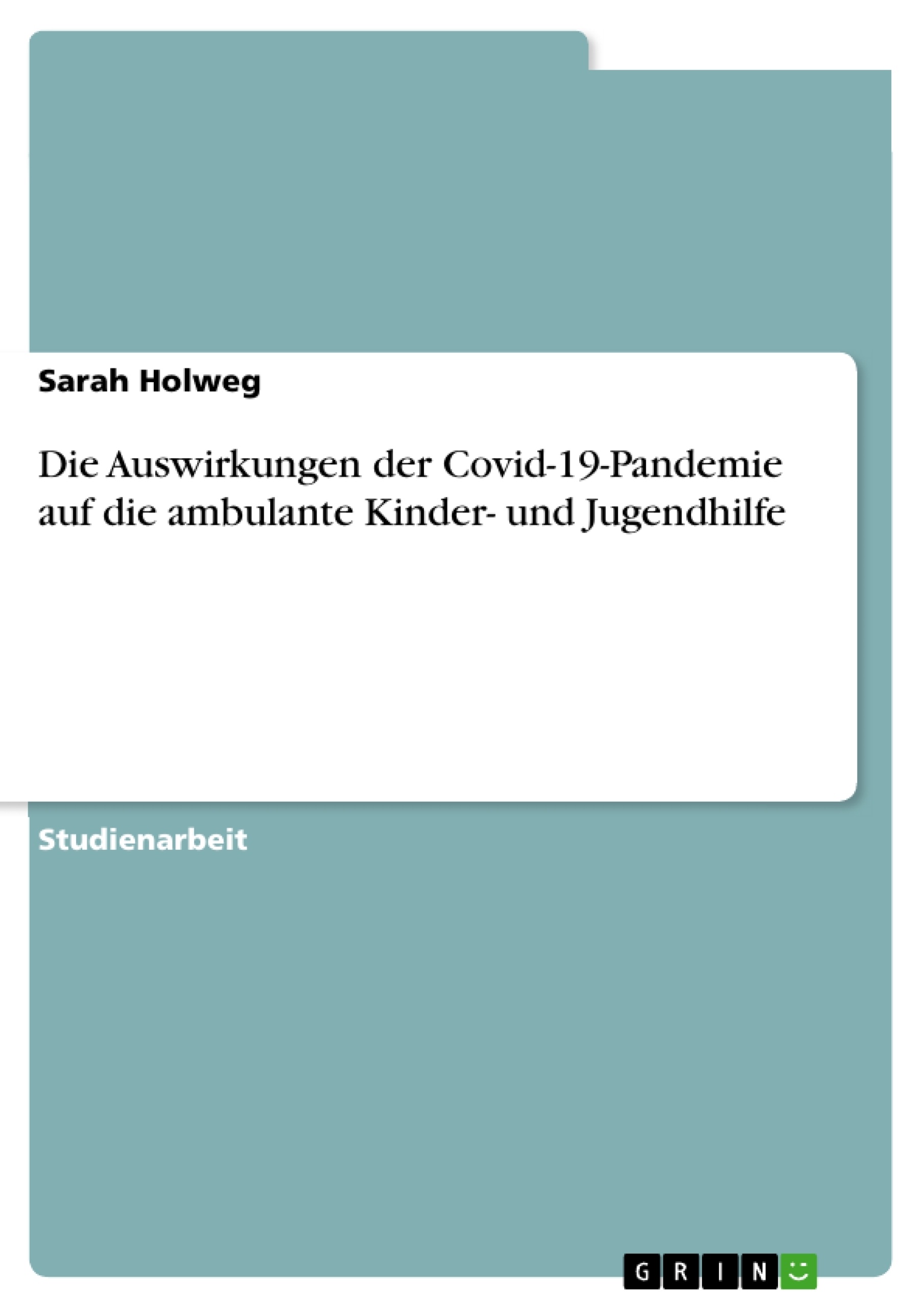Die vorliegende Arbeit widmet sich der Frage, welche Herausforderungen die Maßnahmen der Covid-19-Pandemie für die Adressat*innen der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe mit sich bringen.
Zunächst wird auf die ambulante Kinder- und Jugendhilfe und die Adressat*innen dieser eingegangen. In diesem Zusammenhang werden die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Aufgabenbereiche und die Tagesstruktur dargelegt. Darüber hinaus wird der chronologische Verlauf der Maßnahmen der Covid-19-Pandemie festgehalten, um einen besseren zeitlichen Überblick zu erhalten. Im darauffolgenden Schritt werden die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Adressat*innen beleuchtet. Interessant ist hierbei die Situation rund um das Thema Homeschooling. Auch zu betrachten ist die innerfamiliäre Situation, die psychische Situation und Zukunftsperspektiven der Adressat*innen und die Entwicklung des Medienkonsums seit Beginn der Pandemie. Zuletzt wird ein Fazit aus den gewonnenen Erkenntnissen gezogen und die Fragestellung beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die ambulante Kinder- und Jugendhilfe
2.1 Gesetzliche Grundlagen
2.2 Adressat*innen
2.3 Aufgabenbereiche und Tagesstruktur der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe
3. Die Entwicklung der Covid-19 Pandemie
4. Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Adressat*innen
4.1 Homeschooling
4.2 Familiäre Situation
4.3 Medienkonsum
4.4 Psychische Auswirkungen
4.5 Zukunftsperspektiven
5. Fazit
Literaturverzeichnis