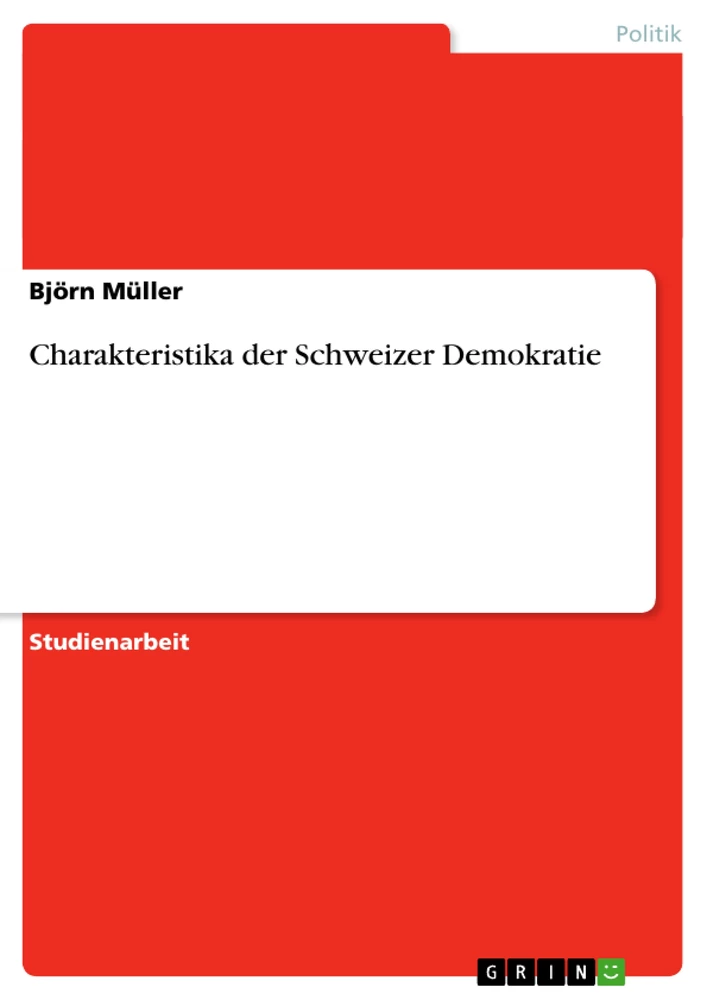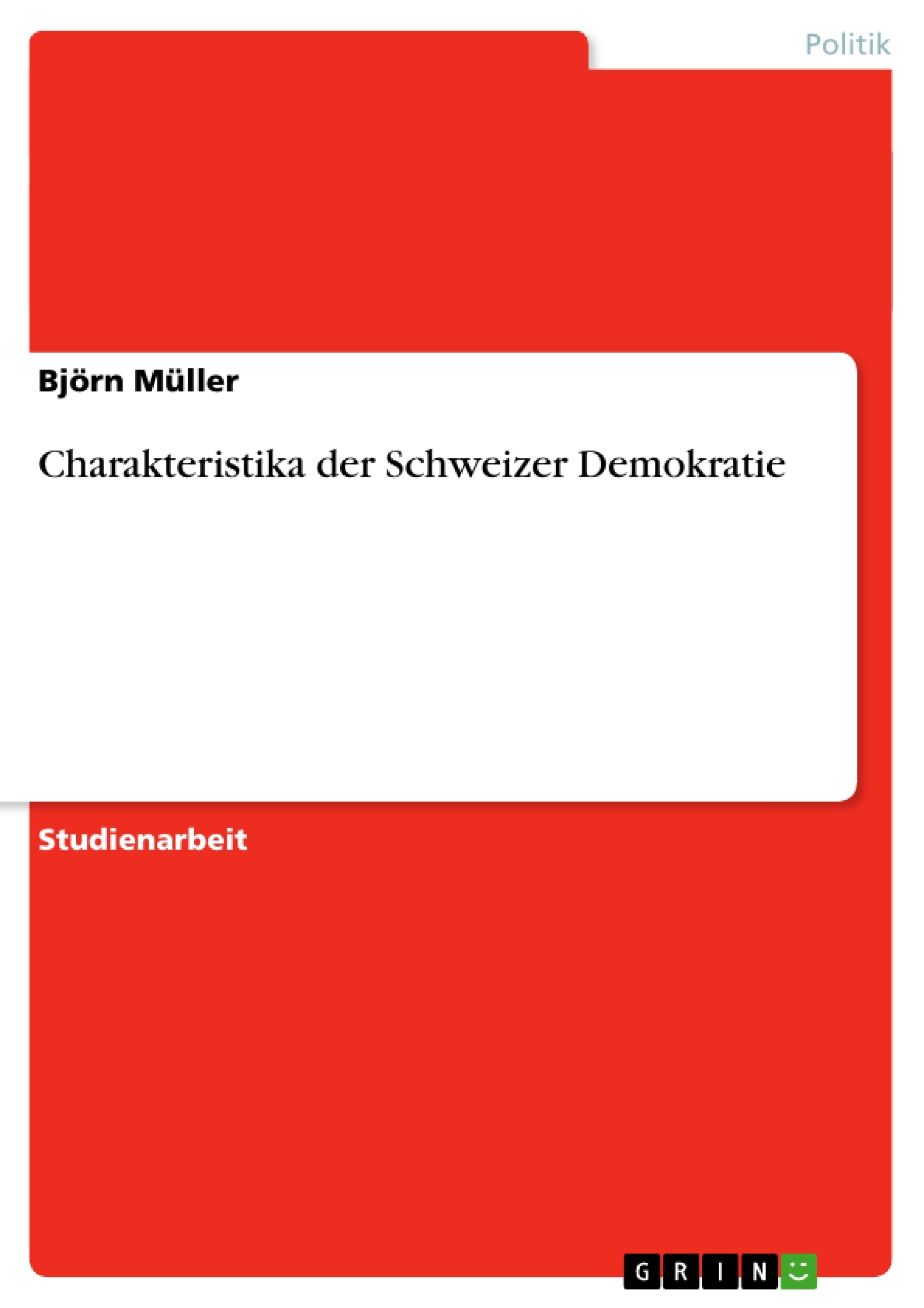Im Dezember 2007 starrte Deutschland fasziniert auf den Nachbarn Schweiz. Christoph Blocher, Vorsitzender der stärksten Partei, der SVP (Schweizerische Volkspartei) war von der Bundesversammlung nicht als Mitglied der Regierung bestätigt worden. Die SVP ging daraufhin in die Opposition. Das einem Bundesrat die Wahl versagt wurde, kommt zwar seit Einführung der „Zauberformel“ selten vor, ist im System aber vorgesehen. Das eine Regierungspartei ankündigte den Weg des Konsens zu verlassen, und es schließlich auch tat, war neu. In deutschen Zeitungen war vom Ende des „Schweizer Models“ die Rede. Hierzulande gilt das Staatswesen der Schweiz als „So sollte Demokratie eigentlich sein“- Typus schlechthin. In die Wahrnehmung der Vorgänge mischte sich nicht selten ein wenig Schadenfreude. Bis dato schien die von der „Zauberformel“ dirigierte „Wohlfühldemokratie“ der Eidgenossen unantastbar zu sein. Immer wieder wurde der Tod des berühmten „Zwangs zum Konsens“ attestiert. Fast ein Jahr später, zeichnet sich jedoch ein Sieg der Schweizer Konkordanz ab. Im Oktober 2008 versagte die SVP ihrer Führungsspitze die Gefolgschaft. Auf Grund von Skandalen droht der Sturz des zweiten von der SVP in die Regierung entsandten Rates, Samuel Schmid. Doch die SVP verweigerte eine Vorabnominierung Blochers. Vielen geht der Konfrontationskurs ihres Vorsitzenden inzwischen zu weit. Also doch kein Ende des Sonderfalls Schweiz? Der Schweizer Politologe Silvano Möckli schreibt in seinem Buch „Das politische System der Schweiz verstehen“: „Die Schweiz hat über sieben Jahrhunderte jenes politische System herausgebildet, das ihren Verhältnissen angemessen ist. In der Kombination der Einzelteile ist es einzigartig und unterscheidet sich von allen anderen politischen Systemen. Es ist deswegen aber nicht 'besser' als andere politische Systeme. Jedes politische System ist ein 'Sonderfall'.“ Die vorliegende Seminararbeit möchte dieser Aussage folgen und die spezifischen Charakteristika der Schweizer Demokratie aufzeigen. Als erstes werden prägenden Einflüsse bei der Herausbildung der politischen Kultur anhand eines historischen Entwicklungsüberblicks des eidgenössischen Staates aufgezeigt. Es folgt eine Beschreibung über deren Einbindung in die erste demokratische Verfassung der Schweiz von 1848. Von dieser Basis aus endet die Arbeit mit einem Überblick der Ausentwicklung der „halbdirekten Demokratie“ Schweizer Typs.
Björn Müller
Inhaltsverzeichnis
1.) Einleitung
2.) Historische Entstehung der Charakteristika der Schweizer Demokratie
2.1.) Die „Alte Eidgenossenschaft“ entsteht
2.2.) Die Ausformung eines besonderen Staatswesens
2.3.) Die Gefahr der Spaltung
2.4.) Das Ende der „Alte Eidgenossenschaft“
2.5.) Der Weg zur Bundesverfassung von 1848
3.) Die Schweizer Bundesverfassung von 1848
3.1.) Kernelemente der neuen Verfassung
3.2.) Bund und Kantone
3.3.) Legislative und Exekutive neuen Zuschnitts
3.4.) Zum Wesen der neuen Verfassung
3.5.) Die Grundlagen der „halbdirekten“ Schweizer Demokratie
(Tabelle: Entwicklung der Referenden und Volksinitiativen in der
Schweiz seit 1848)
3.6.) Leistungen der Bundesverfassung von 1848
4.) Weitere wichtige Entwicklungslinien der Schweizer Demokratie bis heute
Literaturverzeichnis
1.) Einleitung
Im Dezember 2007 starrte Deutschland fasziniert auf den Nachbarn Schweiz. Christoph Blocher, Vorsitzender der stärksten Partei, der SVP (Schweizerische Volkspartei) war von der Bundesversammlung nicht als Mitglied der Regierung bestätigt worden. Die SVP ging daraufhin in die Opposition. Das einem Bundesrat die Wahl versagt wurde, kommt zwar seit Einführung der „Zauberformel“[1] selten vor, ist im System aber vorgesehen.[2] Das eine Regierungspartei ankündigte den Weg des Konsens zu verlassen, und es schließlich auch tat, war neu. In deutschen Zeitungen war vom Ende des „Schweizer Models“ die Rede. Hierzulande gilt das Staatswesen der Schweiz als „So sollte Demokratie eigentlich sein“- Typus schlechthin. In die Wahrnehmung der Vorgänge mischte sich nicht selten ein wenig Schadenfreude.[3] Bis dato schien die von der „Zauberformel“ dirigierte „Wohlfühldemokratie“ der Eidgenossen unantastbar zu sein. Immer wieder wurde der Tod des berühmten „Zwangs zum Konsens“[4] attestiert.[5] Fast ein Jahr später, zeichnet sich jedoch ein Sieg der Schweizer Konkordanz ab. Im Oktober 2008 versagte die SVP ihrer Führungsspitze die Gefolgschaft. Auf Grund von Skandalen droht der Sturz des zweiten von der SVP in die Regierung entsandten Rates, Samuel Schmid. Doch die SVP verweigerte eine Vorabnominierung Blochers. Vielen geht der Konfrontationskurs ihres Vorsitzenden inzwischen zu weit. Also doch kein Ende des Sonderfalls Schweiz? Der Schweizer Politologe Silvano Möckli schreibt in seinem Buch „Das politische System der Schweiz verstehen“: „Die Schweiz hat über sieben Jahrhunderte jenes politische System herausgebildet, das ihren Verhältnissen angemessen ist. In der Kombination der Einzelteile ist es einzigartig und unterscheidet sich von allen anderen politischen Systemen. Es ist deswegen aber nicht 'besser' als andere politische Systeme. Jedes politische System ist ein 'Sonderfall'.“[6] Die vorliegende Seminararbeit möchte dieser Aussage folgen und die spezifischen Charakteristika der Schweizer Demokratie aufzeigen. Als erstes werden prägenden Einflüsse bei der Herausbildung der politischen Kultur anhand eines historischen Entwicklungsüberblicks des eidgenössischen Staates aufgezeigt. Es folgt eine Beschreibung über deren Einbindung in die erste demokratische Verfassung der Schweiz von 1848. Von dieser Basis aus endet die Arbeit mit einem Überblick der Ausentwicklung der „halbdirekten Demokratie“[7] Schweizer Typs.
2.) Historische Entstehung der Charakteristika der Schweizer Demokratie
2.1.) Die „Alte Eidgenossenschaft“ entsteht
Das Gebiet der heutigen Schweiz Ende des 13. Jahrhunderts. Im Alpenraum, wo die Ränder der Mächte Europas aufeinander stoßen, hat sich ein bunter Flickenteppich verschiedenster Herrschaften gebildet. Adelsherrschaften wie jene der Habsburger mischen sich mit städtischen Territorien wie Zürich oder Luzern. Daneben gibt es noch der Reichsunmittelbarkeit unterstellte Ministerialherrschaften, geistliche Gebiete und sogar solche in denen unter der Leitung führender Familien die Bauern das Sagen haben.[8] Der größte Teil von ihnen gehört zum Heiligen Römischen Reich, dass sich zu jener Zeit in einer schweren Krise befindet. Nach dreiundzwanzig jährigem Interregnum wird der Habsburger Rudolf 1273 zum König gekrönt, stirbt aber bereits 1291. Regionale Sicherheitsbündnisse, wie jenes des Schwäbischen Städtebundes zur Wahrung wirtschaftlicher Interessen, haben Hochkonjunktur.[9] Im Jahr von Rudolfs Tod gründen auch drei alpenländische Kleinherrschaften, Uri, Schwyz und Nidwalden, genannt die „drei Waldstätte“ einen Bund, die Keimzelle der späteren Schweiz. (Streng genommen wird in dem Vertrag ein nicht näher verifizierter, früherer Bund erneuert). Während in Uri und Nidwalden Freiherrenfamilien und Ministerialendynastien herrschen, dominieren in Schwyz lokale Bauerngeschlechter.[10] In ihrem Bundesbrief geht es zum einen um die Wahrung des Landfriedens, zum anderen um den Schutz vor Angriffen. Man richtet ein Schlichtungsverfahren für Streitigkeiten ein und versichert sich gegenseitigen Beistand bei Aggressionen von Außen.[11] Anders als oft kolportiert, sind es somit handfeste politische Interessen die am Beginn des Gründungsweges der Eidgenossenschaft stehen, und keine unüberbrückbaren soziokulturellen Gegensätze. Es geht nicht um einen Kampf bäuerlicher Bergbewohner gegen adelige Fremdherrschaft. Das der Konflikt mit den Habsburgern in der Folge zum prägenden Faktor für die frühen Jahre des Bundes wird, hat machtpolitische Gründe. Die über Nid- u. Obwalden als Grafen herrschenden Habsburger wollen ihre Macht erweitern, was nicht im Interesse der lokalen Eliten ist. Nachdem sich Nidwalden durch das Bündnis mit Uri und Schwyz teilweise von der Habsburger Herrschaft emanzipiert hat, möchte auch Obwalden folgen. Es kommt zum Krieg. Am 15. November 1315 siegen die Waldstätte und Obwalden gegen das Ritterheer der Habsburger. Der folgende Vertrag zeugt vom gewachsenen Selbstbewusstsein der nun vier Bundmitglieder und zeigt eine neue Qualität. Ohne Zustimmung des Neulings Obwalden sollen keine Verträge mit auswärtigen Mächten geschlossen werden. Keiner der Bundmitglieder soll einen Oberherren ohne die Zustimmung der anderen anerkennen. Die grundherrlichen Rechte der Habsburger bleiben zwar in Kraft, werden aber de facto suspendiert.[12] Das Bündnis zeigt nun, nach seiner ersten nach außen gerichteten Aktion, schon ein gesteigertes Maß an Exklusivität. Die Mitglieder gewähren sich untereinander erstmals eine Art Vetorecht, wenn es um wichtige politische Belange geht. In der Folge erweitert sich diese Eidgenossenschaft, deren politische Kultur rückblickend von Anfang an ein starkes föderales[13] Element enthält.
2.2.) Die Ausformung eines besonderen Staatswesens
In den folgenden Jahrzehnten erweitert sich der Bund durch Herrschaften verschiedenster Interessenslagen. Er gliedert sich nicht vollberechtigte Bundesgenossen an, die „zugewandten Orte“, und schafft sich sogar praktische Lehnsverhältnisse, die „Untertangebiete“. Die meisten Länder des wachsenden Bundes gehören dem deutschen Kulturkreis an. Doch in den Randlagen kommen auch zunehmend Italienisch und Französisch sprechende Territorien hinzu.[14] Was das Bündnis so attraktiv macht für Klein- u. Mittelherrschaften, sind zwei miteinander verknüpfte Faktoren. Die beitretenden Herrschaften sehen zum einen ihre innere Ordnung vor weitgehender Einmischung geschützt bei einem gleichzeitigen Mehr an außenpolitischer Gestaltungsmöglichkeiten. Vor allem Stadtrepubliken wie Zürich und Bern schließen Verträge mit dem Bund, um ihre außenpolitischen Interessen durchzusetzen; sehen darin jedoch nur eine relative Option unter Vielen.[15] In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts kommt es zu bedeutenden Veränderungen in den inneren Herrschaftsstrukturen des Bundes. In zahlreichen Kantonen werden die alten Eliten gestürzt und es entstehen dort neue mit demokratischen Elementen durchsetzte Herrschaftsformen. Unter anderem in den drei Waldstätten werden die alten Herrschergeschlechter von neuen Familien verdrängt, die den Machtwechsel durch Mitspracherechte der Gesamtheit absichern. Die „Landsgemeinden“ entstehen. Bei gewichtigen Entscheidungen sind nun alle Männer der Talgemeinschaft stimmberechtigt. Meist einmal im Frühjahr trifft sich die Landsgemeinde zur Rechtssprechung, Wahl der Gemeindehäupter und zur Gesetzgebung. Bis heute gilt die Landsgemeinde als das Synonym für „direkte Demokratie“ in der Schweiz. Doch handelt es sich bei ihr damals eher um ein Modell ständischer Mitspracherechte. Die ökonomisch dominanten Sippen beherrschen das Geschehen. Frauen und die besitzlose Landbevölkerung sind nicht involviert.[16] Im 15. Jahrhundert findet die „alte Eidgenossenschaft“ schließlich ihre Grundform durch eine Reihe innerbündischer Konflikte, wie beispielsweise mit Zürich, dass sich in einem Territorialstreit mit Schwyz dem eidgenössischen Schiedsspruch nicht fügen will. Im „Alten Zürichkrieg“ von 1440 bis 1446/50 behält die Eidgenossenschaft die Oberhand. Es wird deutlich, dass die Mitgliedschaft im Bund für die einzelnen Kantone nun Verbindlichkeit besitzt. Trotzdem kann nicht von einem Bundesstaat die Rede sein, sondern weiterhin nur von einem Staatenbund. Dessen Hauptbeschlußorgan wird bis 1798 die „Tagsatzung“ sein. Ein Gesandtenkongress, der je nach Dringlichkeit von den Bundmitgliedern einberufen wird. Abgesandte mit einem imperativen Mandat der Kantone reisen zu den Treffen. Bei grundsätzlichen, das Bündnis bzw. die Eigenständigkeit der Kantone betreffenden Fragen gilt das Prinzip der Einstimmigkeit. Für das Tagesgeschäft kleinerer Rechtsstreitigkeiten und Ähnlichem, wird aus Gründen des Pragmatismus das Mehrheitsprinzip verwendet. 13 Orte sind als Vollmitglieder zu bezeichnen, (Uri, Schwyz, Nidwalden, Zürich, Bern, Luzern, Zug, Glarus, Freiburg, Solothurn, Basel, Schaffhausen sowie Appenzell). Daneben gibt es noch die nur eingeschränkt stimmberechtigten „zugewandten Orte“ wie St. Gallen oder Mühlhausen, sowie einige stimmlose „Untertangebiete“. Dieses politische Gebilde, dass sich selbst in Verträgen als „ die Gemeine Eidgenossenschaft des großen Bunds oberdeutscher Lande von Städten und Ländern“ bezeichnet, ist immer noch Teil des Heiligen Römischen Reiches. So wie die maximale Eigenständigkeit Motivation für die Kantone zum Eintritt in die Eidgenossenschaft gewesen ist, so ist es die unverbindliche Struktur des Reiches, die es für den Bund so attraktiv macht. Als das Wormser Konkordat 1495, für das Reich ein höheres Maß an Organisation und damit der Einbindung seiner Teile beschließt, verweigert sich die Eidgenossenschaft und kann ihre alte Stellung in der Folge bewahren. Während in Resteuropa die feudalen Landesherren Zug um Zug ihre ständischen Konkurrenten ausschalten, manifestiert sich mit der Eidgenossenschaft ein Staatswesen, dessen Machtausübung stark auf dem Mittel des Kompromisses basiert, und das dabei ist, demokratische Elemente in seiner Kultur fest zu verwurzeln.[17]
[...]
[1] Siehe Erläuterung in Kapitel 4, Seite 14/15
[2] Vgl. Wolf Linder: Schweizerische Demokratie, Bern u. a. 2005, Seite 228
[3] Vgl. www.sueddeutsche.de/ausland/artikel/437/148087/
[4] Gängige Charakterisierung des Schweizerischen Konkordanzsystems
[5] Vgl. www.tagesschau.de/ausland/schweiz 20.html
[6] Silvano Möckli: Das politische System der Schweiz verstehen, Altstätten 2007, S. 39
[7] Wolf Linder: Schweizer Demokratie, Bern u.a. 2005, S. 242
[8] Vgl. Ulrich im Hof: Geschichte der Schweiz, Stuttgart u.a. 1997, S. 18-26
[9] Vgl. Ulrich im Hof: Geschichte der Schweiz, Stuttgart u.a. 1997, Kapitel 2.3 u. 3.1
[10] Vgl. Volker Reinhardt: Geschichte der Schweiz, München 2007, S. 14
[11] Vgl. Quellenwerk zur Entstehung der Schweizer Eidgenossenschaft Abt. 1, Urkunden Bd., 1 Aarau 1933 auf www. admin.ch
[12] Vgl. Volker Reinhardt: Geschichte der Schweiz, München 2007, S. 15-16
[13] „Föderal“ hier im Sinne größtmöglicher Entscheidungshoheit der Gliedstaaten des Bundes
[14] Vgl. Volker Reinhardt: Geschichte der Schweiz, München 2007, S. 18-22 sowie Ulrich im Hof: Geschichte der Schweiz, Stuttgart u.a. 1997, Kapitel 3.6
[15] Vgl. Volker Reinhardt: Geschichte der Schweiz, München 2007, S. 16-19
[16] Vgl. Ulrich im Hof: Geschichte der Schweiz, Stuttgart u.a. 1997, Kapitel 3.3
[17] Vgl. Ulrich im Hof: Geschichte der Schweiz, Stuttgart u.a. 1997, Kapitel 4.4 sowie Volker Reinhardt: Geschichte der Schweiz, München 2007, Kapitel 4