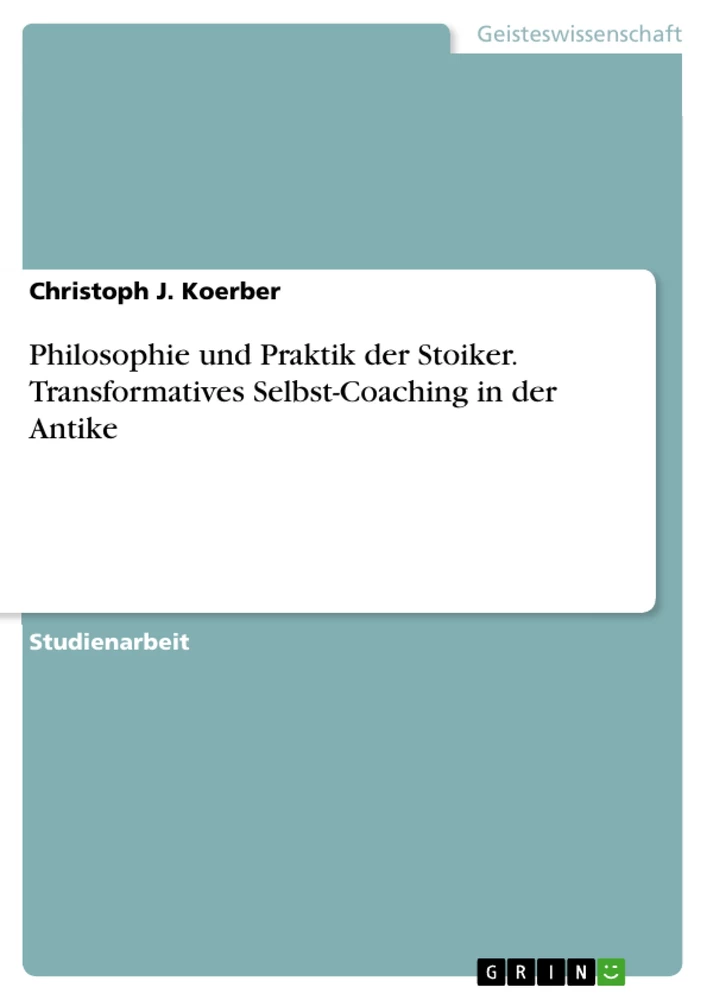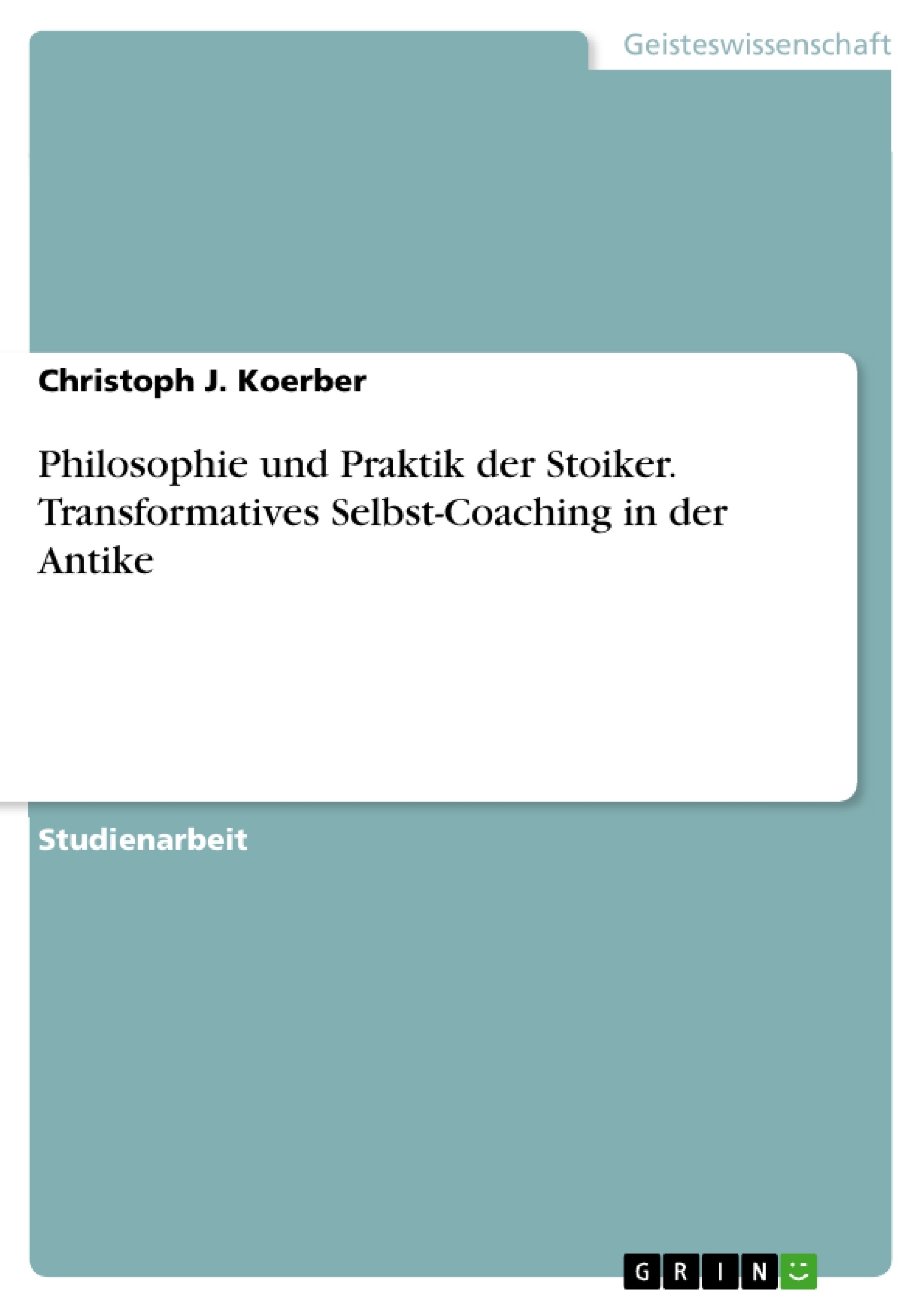Diese Abhandlung beinhaltet die beiden Biographien von Seneca und Aurelius, eine kompakte und auch für junge Menschen griffige Darstellung der stoischen Philosophie anhand von sieben Themen und einen Abschnitt zur Praktik eines Stoikers. Wir alle glauben an irgendeinen Zweck, bewusst oder unbewusst, ansonsten hätten wir keinen Grund irgendetwas zu tun.9 Die einen glauben vielleicht, dass das Streben nach Lustgewinn und Schmerzvermeidung zu einer Glückseligkeit führe, die Stoiker dagegen glauben an den absoluten Wert von Tugendhaftigkeit.10 Sie wollen ein Leben führen, in dem sie anstreben, nur das zu tun, was tugendhaft, sittlich geboten, löblich oder weise genannt werden könnte.
INHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung
2.Biographien zweier Stoiker
2.1. Lucius Annaeus Seneca
2.2. Marcus Antonius Aurelius
3. Philosophie der Stoiker
3.1. Interpretationen
3.2. Wirkungsbereich
3.3. Akzeptanz
3.4. Tugendhaftigkeit
3.5. Perspektiven
3.6. Verbundenheit
3.7. Training
4. Praktik des Stoikers
4.1. Allgemeines
4.2. Praemeditatio Malorum
5. Zusammenfassung und Diskussion
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Übersetzungen:
Sekundärliteratur:
Weitere Literaturquellen:
Internet-Quellen:
Abbildungsverzeichnis