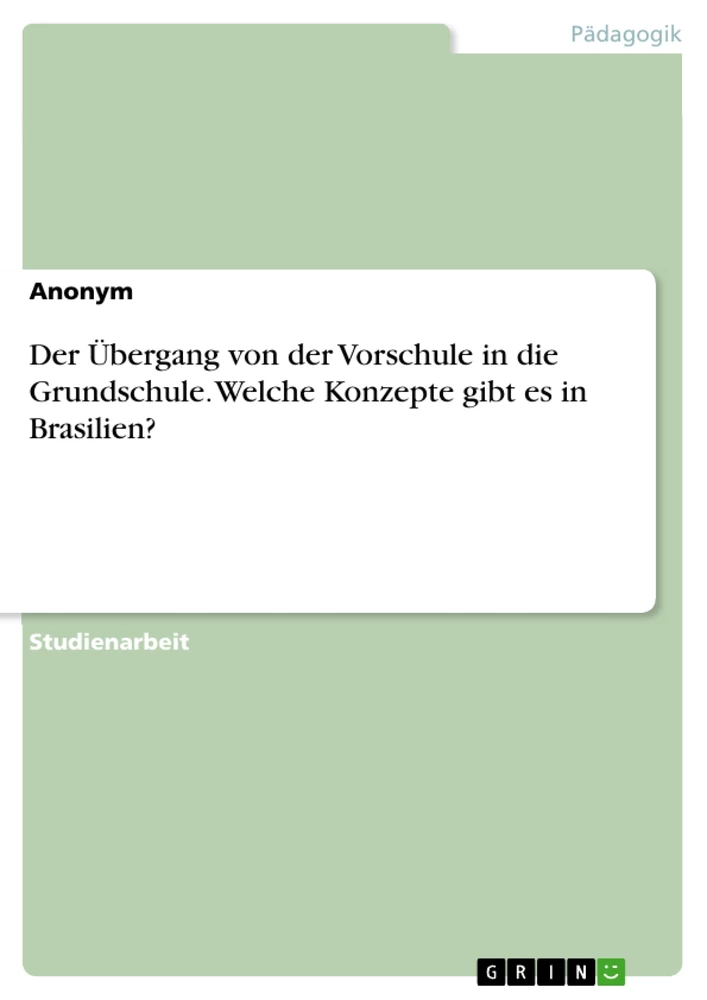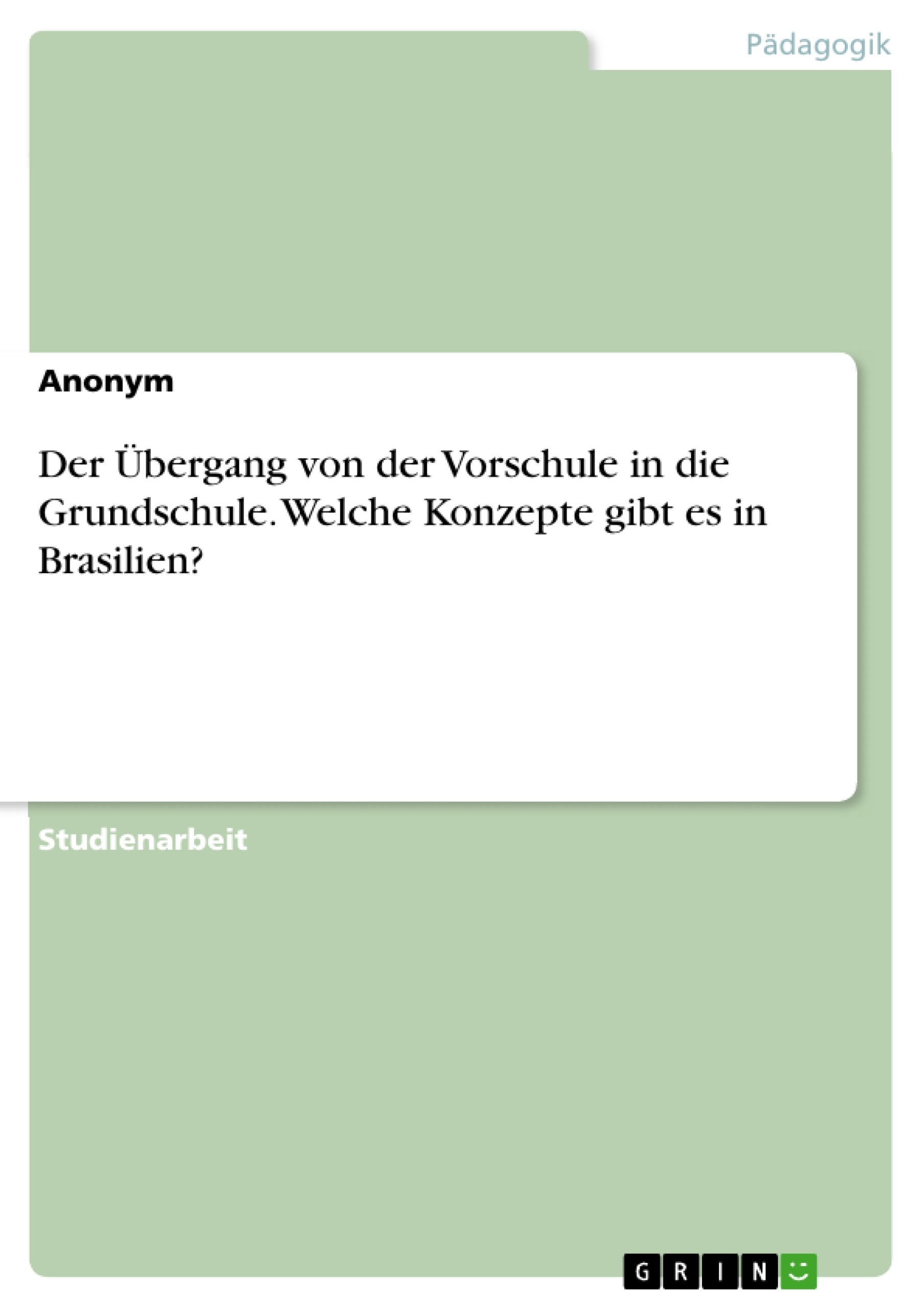Diese Arbeit ist ein Forschungsbericht mit dem Thema "Übergang von der Vorschule in die Grundschule in Brasilien", der Teil meines absolvierten Pflichtpraktikums in Brasilien ist. Hierzu werden sowohl theoretische als auch praktische Einblicke gegeben. Es wird der Frage nachgegangen, wie die Übergangsgestaltung von den pädagogischen Fachkräften realisiert und mit den Besonderheiten umgegangen wird.
Das Kapitel zwei stellt das Bildungssystem Brasiliens, die Hinweise zur Gestaltung des Übergangs aus dem Bildungsplan sowie wissenschaftliche Erkenntnisse vor. Im Kapitel drei werden zwei Expertinneninterviews, bei denen jeweils eine Lehrerin einer Vor-und Grundschule befragt wurden, ausgewertet. Hier wird die Übergangsgestaltung von Vorschule in die Grundschule in der Praxis näher aufgezeigt und in thematischen Einheiten verglichen. Der Interviewleitfaden hierzu ist im Anhang zu finden. Das abschließende Kapitel vier stellt die Forschungsergebnisse dar.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Brasilianisches Bildungssystem und wissenschaftliche Erkenntnisse
3. Forschungsdesign
3.1. Forschungsfeld
3.2. Erhebungs- und Auswertungsmethode
4. Forschungsergebnisse
4.1. Übergangsgestaltung
4.2. Die Wichtigkeit der frühkindlichen Bildung für den Übergang
4.3. Bildungsplan - Übergang aus einer Notwendigkeit entstanden
4.4. Mehr Aufmerksamkeit für die Übergangsgestaltung
5. Fazit und Vergleich mit theoretischem Bezug
Literaturverzeichnis
Anhang