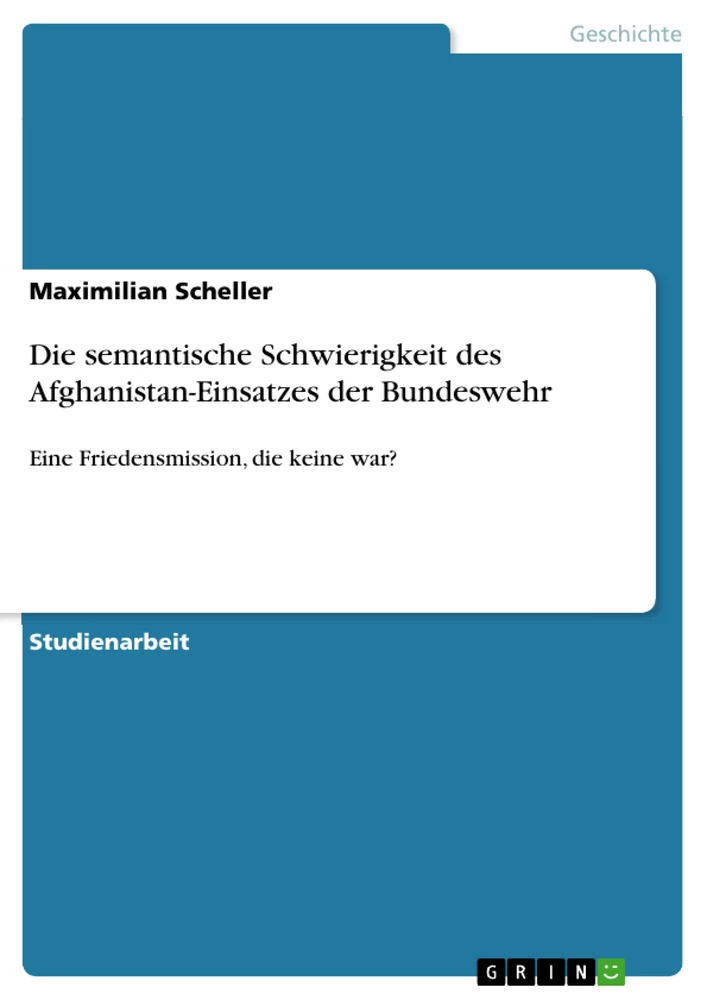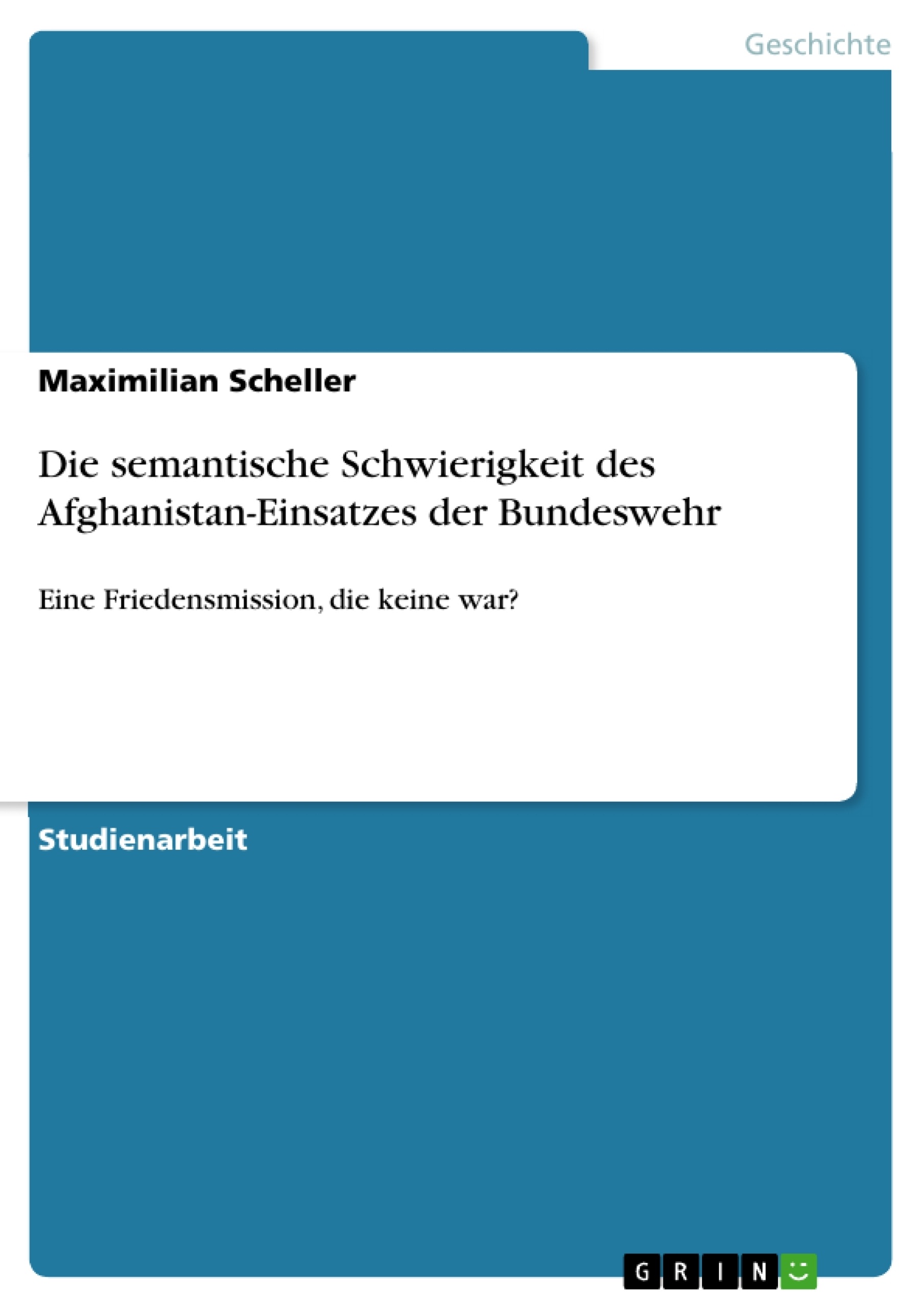Die Hausarbeit untersucht, inwiefern schon 2001 in der politischen Debatte eine gewisse Unschärfe und Uneinigkeit über den Einsatz der Bundeswehr vorherrschend war. Die zugrunde liegende These dieser Arbeit ist, dass die semantischen Darstellungen im Vorfeld der Bundeswehr-Intervention das Bild vom Sinn und Ziel des Einsatzes undeutlich machten. Die Erkenntnis ist, dass missverständliches politisches Vokabular verschiedene Wirklichkeiten schafft und dadurch politische Debatten maßgeblich beeinflussen kann.
Am 29. Juni 2021 endete einer der wohl umstrittensten Einsätze der Bundeswehr. Die Bilanz des fast 20 Jahre andauernden Afghanistan-Einsatzes fällt ernüchternd aus. Schon kurz nach dem Abzug der deutschen und amerikanischen Truppen aus dem Land haben die Taliban die Macht in Afghanistan wieder an sich gerissen und das Land zurückerobert. Afghanistan droht nun eine schwere humanitäre Krise und viele Einheimische sind deshalb auf der Flucht. Die dramatischen Bilder vom Flughafen in Kabul waren Sinnbilder von der Angst der Menschen vor Ort.
Über die zwei Dekaden hinweg war die Bundeswehr Bestandteil der Einsätze Operation Enduring Freedom (OEF), International Security Assistance Force (ISAF) und Resolut Support Mission. Hierbei bildete sie örtliche Truppen aus und unterstütze bei Infrastrukturprojekten. In Zahlen waren insgesamt 160.000 deutsche Bundeswehrsoldaten in Afghanistan im Einsatz, von denen 59 ihr Leben ließen.
Die Kosten der Missionen belaufen sich auf 17,3 Milliarden Euro, von denen 12,3 Milliarden Euro für das Militär ausgegeben wurden. Die restliche Summe floss in die Entwicklungshilfe. Doch wie der ehemalige Bundesaußenminister Maas in einem Interview mit dem Spiegel offenbart, fehlte eine klare Definition des Einsatzziels am Hindukusch, nachdem die ursprüngliche Anti-Terrorismus-Kampagne abgeschlossen worden war.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Definitionsversuche und gesellschaftspolitische Ausgangslage
1.1 Begriffliche Annäherungen
1.2 Der Brutkasten Afghanistan und der NATO-Bündnisfall
2 Die politische Rhetorik
2.1 „War is a loaded word in German“
2.2 Friedensmission oder Kriegseinsatz?
3 Die Wahrnehmung des Afghanistan-Einsatzes in der Öffentlichkeit
Schlussbetrachtung
Quellenverzeichnis
Literaturverzeichnis