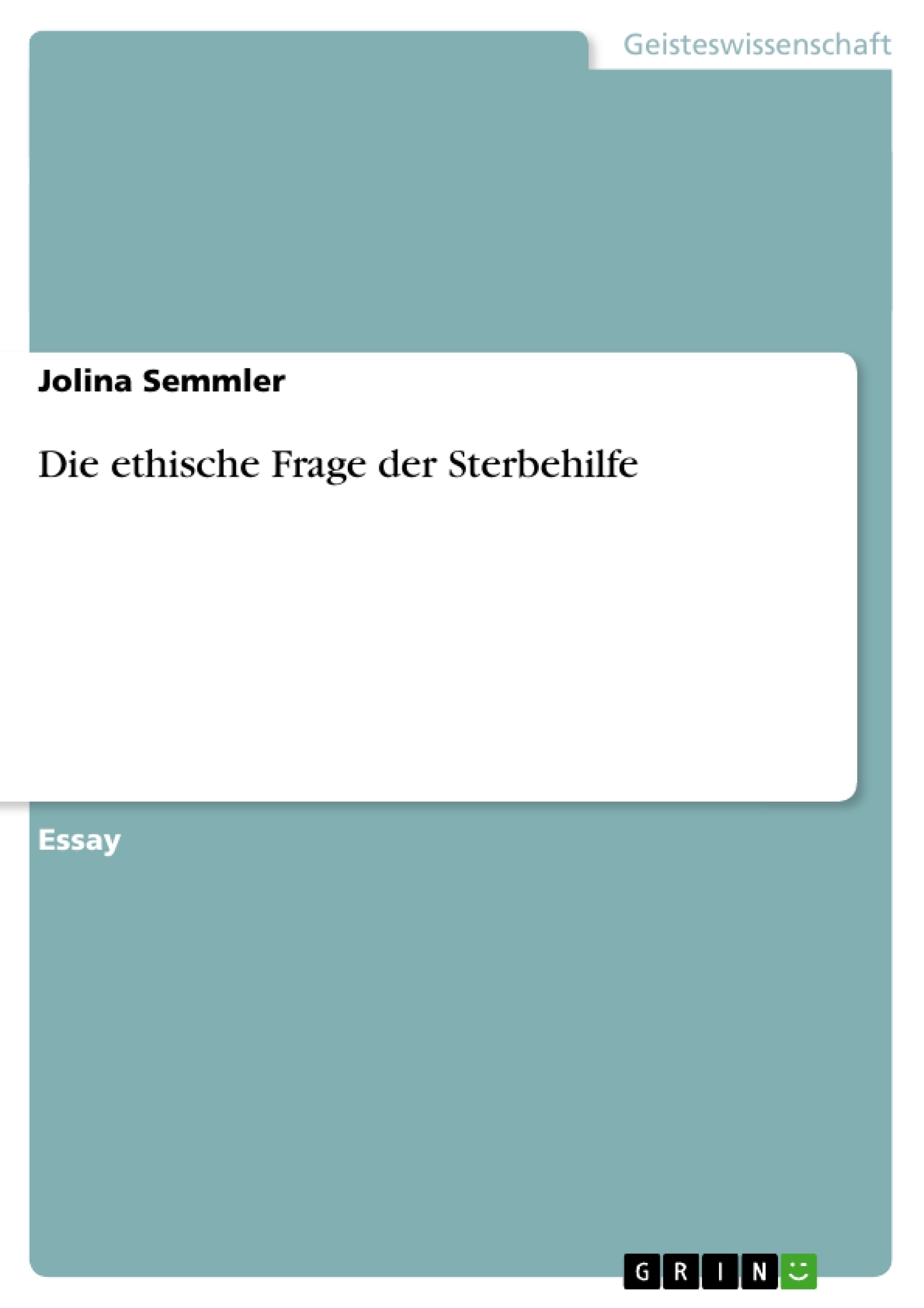Unter Sterbehilfe wird allgemein die von einem Menschen bewusst gewollte Unterstützung durch eine andere Person bei der Herbeiführung des eigenen Todes gemeint.
Die Sterbehilfe in diesem Sinne bezieht sich allerdings nicht nur auf unheilbare kranke Menschen im Endstadium ihres Lebens, sondern beispielsweise genauso auf Menschen mit Behinderungen, Menschen die im Wachkoma liegen oder Menschen mit einer Alzheimer-Erkrankung im fortgeschrittenen Stadium, was gerade in Deutschland noch sehr umstritten ist, da manche Positionen darin die Abgrenzung zu Morddelikten sehen.
Sterbehilfe bedeutet des weiteren im heutigen Sprachgebrauch, den Tod eines Menschen durch fachkundige Behandlung herbeizuführen, zu erleichtern oder nicht hinauszuzögern, wobei in der Regel vom Einverständnis des Betroffenen ausgegangen wird. Hierbei ist die Patientenautonomie, also die Annahme, dass der Mensch Autonom entscheiden kann, die Voraussetzung dafür seine persönliche Entscheidung im Krankheitsfall und wenn es ums Sterben geht, zu respektieren. Erst wenn es diese Autonomie gibt, kann persönliches Handeln verantwortet werden, sich selbst gegenüber, gegenüber den Anderen, gegenüber der Gesellschaft. Die Sterbehilfe ist in Deutschland noch sehr umstritten und bislang untersagt. Allerdings gibt es Verschiedene Arten der legalen Sterbehilfe unter anderem in den Niederlanden und der Schweiz. Ich werde mich jedoch hier im Weiteren mehr auf Deutschland beziehen.
Die ethische Frage der Sterbehilfe
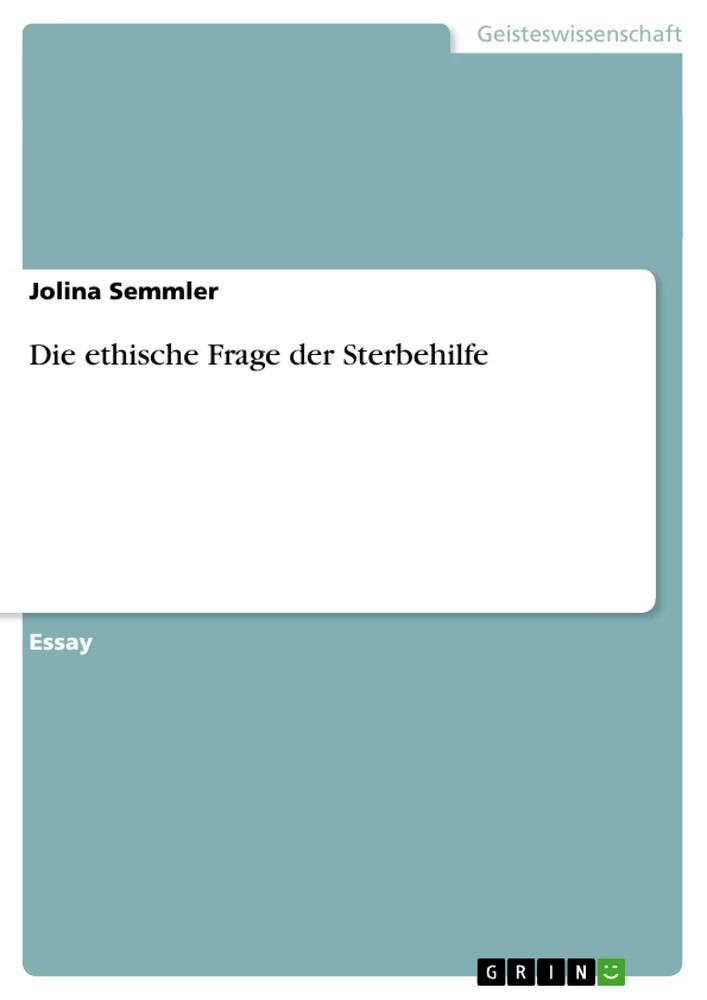
Essay , 2008 , 10 Seiten , Note: 1.7
Autor:in: Bachelor of Arts für Soziale Arbeit Jolina Semmler (Autor:in)
Leseprobe & Details Blick ins Buch