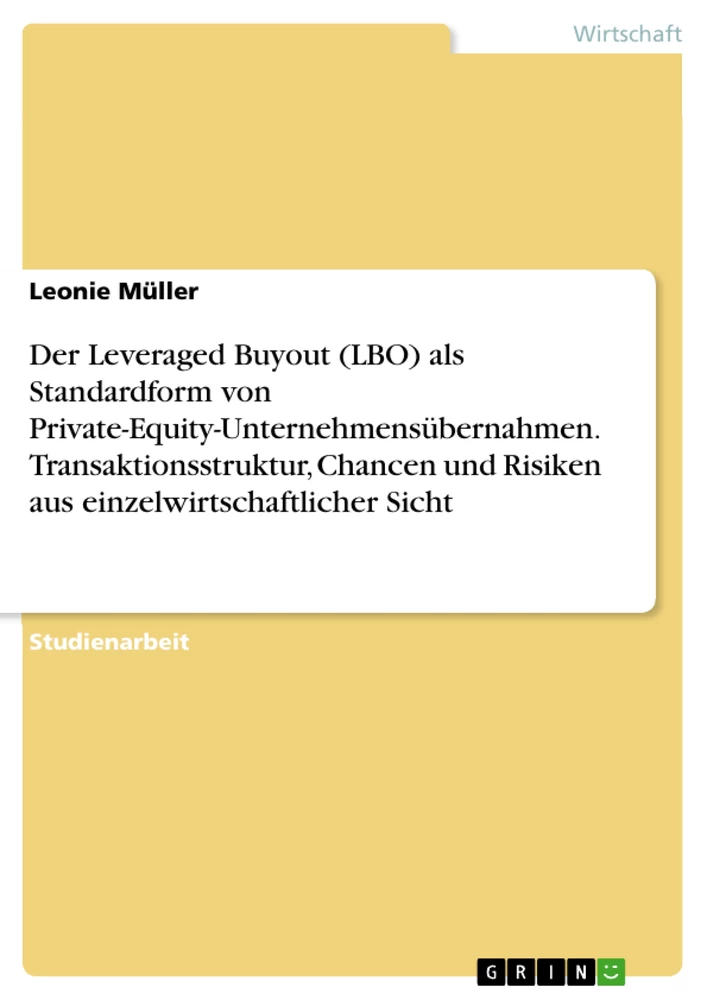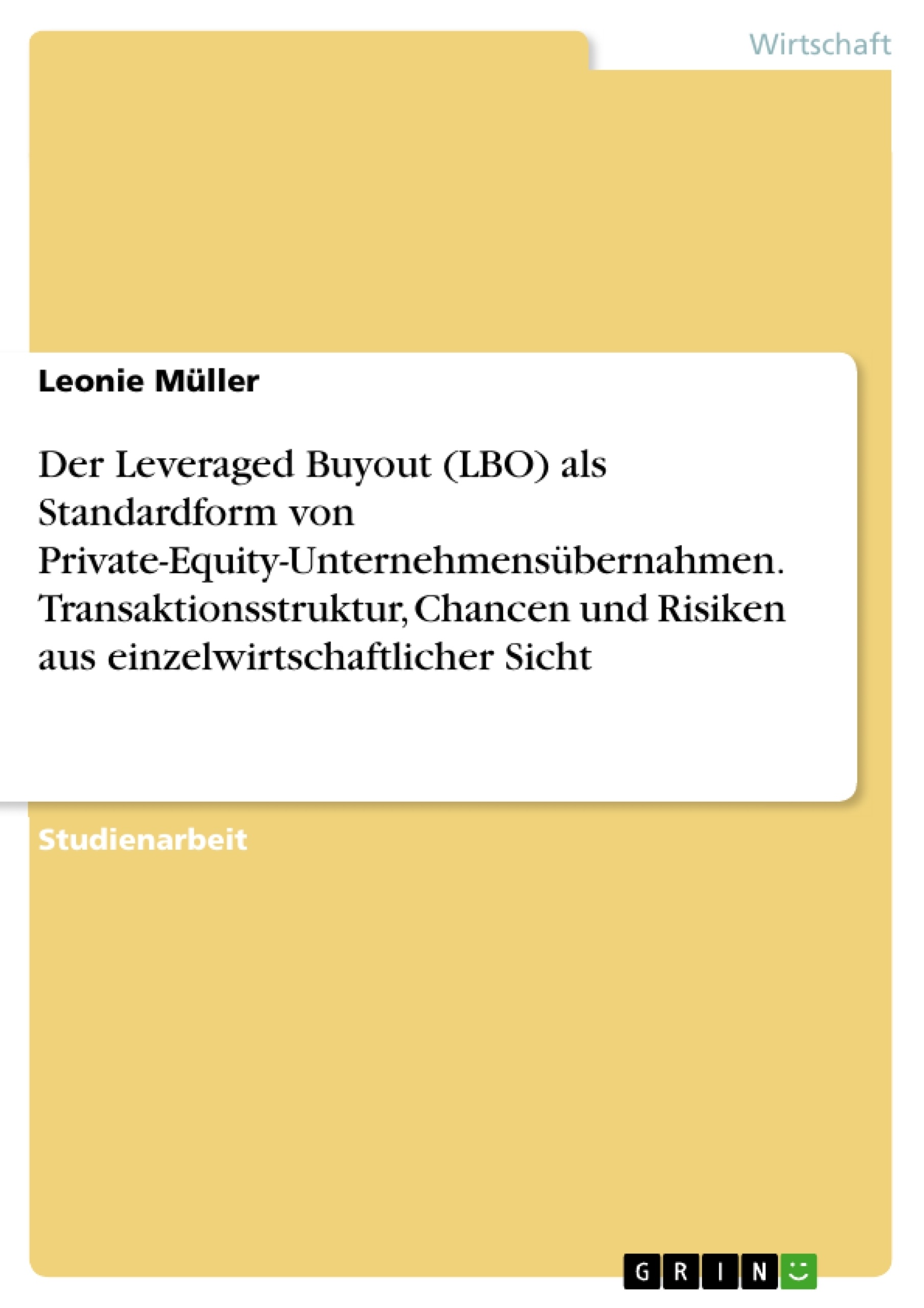Das Ziel dieser Hausarbeit ist es, den Leveraged Buyout (LBO) im Hinblick auf den Leverage Effekt anzuwenden und die Chancen und Risiken der beteiligten Akteure zu diskutieren und zu präsentieren. Weiterhin wird näher auf die Abgrenzung des LBO, sowie die Klassifizierung der LBO Teilnehmer eingegangen. Die Kapitalgeber des LBO folgen auf die Transaktions- und Finanzierungsstruktur. Abschließend wird das LBO im Spannungsfeld von Agency-Konflikten beleuchtet.
Immer mehr Unternehmen werden von Investoren übernommen, die den Unternehmenskauf, überwiegend mit Fremdkapital finanzieren. Jenes Fremdkapital wird von Dritten wie beispielsweise Banken in Form eines Kredits bezogen. Diese Finanzierungsmethode infolge einer hohen Verschuldung wird oft kritisch gesehen, es wird versucht, den Leverage Effekt zu nutzen, um auf diese Weise die Eigenkapitalrendite nach oben zu treiben. Die Sicherung des Fremdkapitals erfolgt durch die Zielgesellschaft, dies erweckt den Eindruck, dass sich die Übernahme des Unternehmens so gut wie selbst finanziert.
Im Rahmen der Principal-Agency-Theorie steht die Frage nach den effizienten Anreizstrukturen innerhalb von Unternehmen im Mittelpunkt. Die Eigentumsübertragung wickelt im Falle des Leveraged Buyouts einen hohen Fremdkapitaleinsatz ab. Das kann laut Fürsprechern des LBO zu effizienteren Kontrollmechanismen und Anreizstrukturen führen. Die Öffentlichkeit, sowie die Wissenschaft sieht das, vor allem im Hinblick auf die Effizienz kritisch. Hierbei ist zu untersuchen, in welchem Umfang ein fremdfinanzierter Unternehmenskauf mit anschließender Liberalisierung und Reorganisation der Unternehmensführung ein wirksames Mittel darstellt, um die Anreizstrukturen zu verbessern. Sowohl die Investoren, als auch die Geschäftsführung des Unternehmens verfolgen bei der Verwendung des Leveraged Buyouts das Ziel, das Gesamtkapital optimal in Eigen- und Fremdkapital aufzuteilen. Somit wird die Rentabilität des Eigenkapitals stark ansteigen und daraus resultiert der Leverage Effekt.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einführung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
1.2 Vorgehensweise und Methodik
2 Einordnung und Bedeutung des Leveraged Buyout
2.1 Bedeutung und Abgrenzung des LBO
2.2 Berechnung und Beispiel des Leverage Effekts
2.3 Chancen und Risiken des Leverage Effekts
3 Der LBO in der Praxis
3.1 Beteiligte Akteure des Leveraged Buyouts
3.2 Chancen und Risiken der Akteure
3.3 Transaktions- und Finanzierungsstruktur
4 LBO im Spannungsfeld von Agency-Konflikten
5 Schlussfolgerungen
6 Literaturverzeichnis