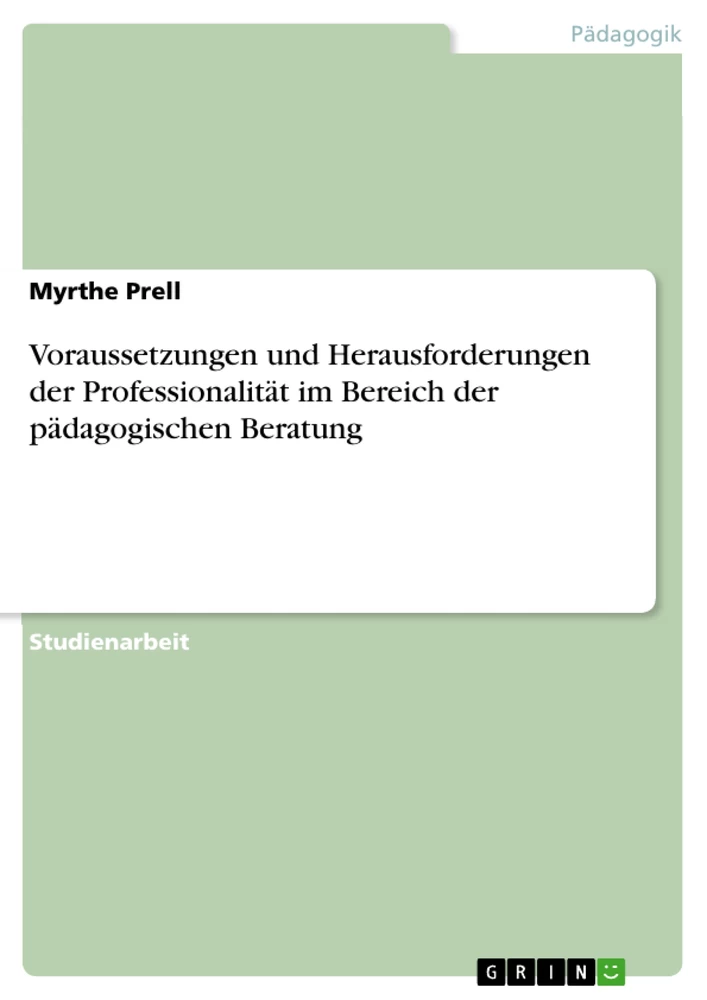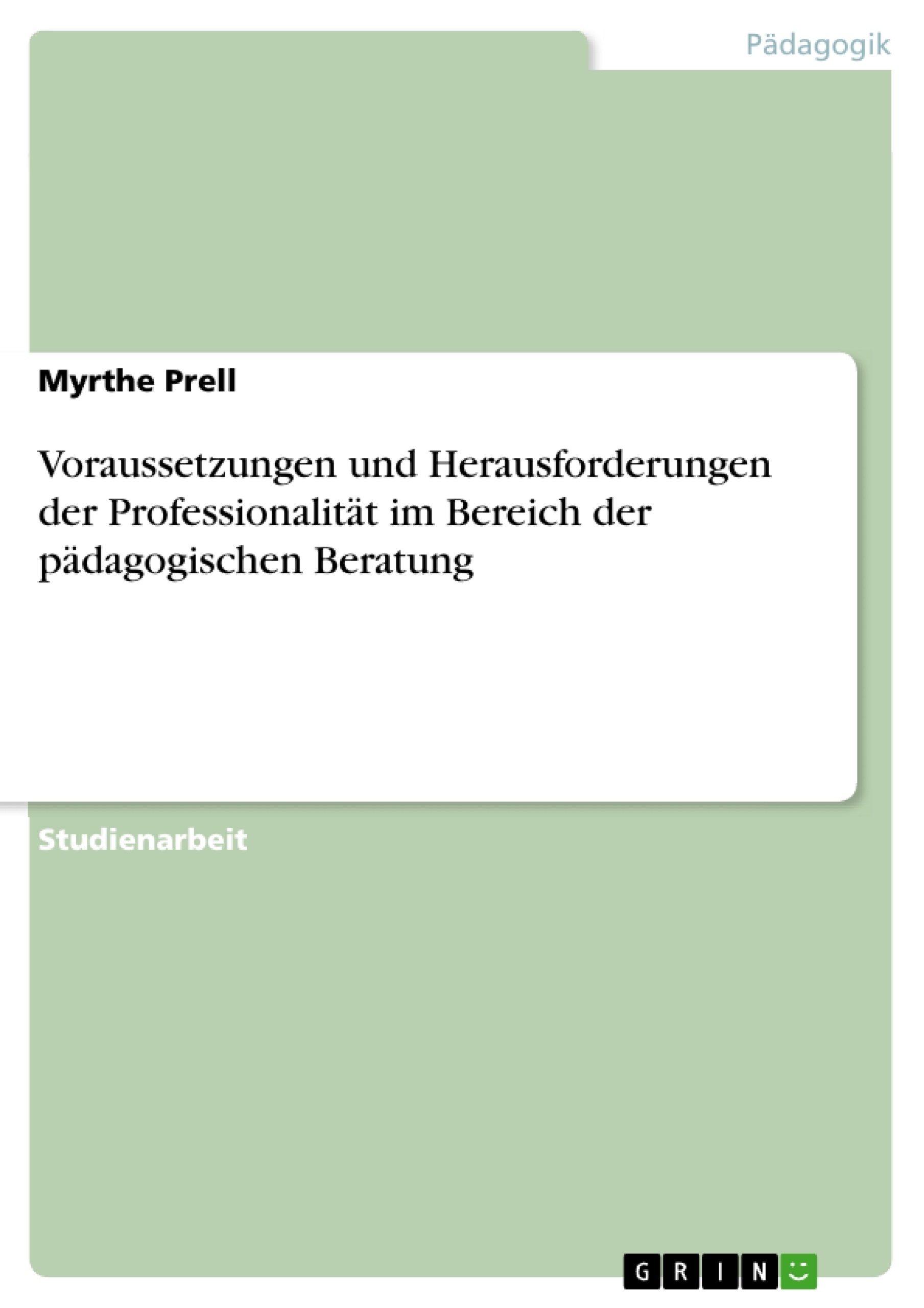In einer immer komplexer werdenden Welt steigt die Nachfrage nach Beratung, da sich Problemstellungen ergeben, welche Menschen ohne Hilfestellung nicht bewältigen können. Um eine hohe Qualität der Beratungen im pädagogischen Handlungsfeld zu erreichen, ist die Entwicklung und Sicherung einer pädagogischen Professionalität unabdingbar. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Entwicklung, die Kennzeichen und die Herausforderungen pädagogischer Professionalität im Handlungsfeld der pädagogischen Beratung darzustellen.
In den beiden Unterpunkten des Kapitels „Definition wichtiger Begriffe“ wird zunächst geklärt, was unter den Bezeichnungen der pädagogischen Professionalität und Beratung verstehen ist. Anschließend wird im nächsten Kapitel, unterteilt in drei Unterpunkte, beschrieben, wie sich die pädagogische Professionalität im Handlungsfeld der Beratung gestaltet. Dabei wird im Unterpunkt 3.1 auf die Professionalisierung der Aus- und Weiterbildungslage der pädagogischen Beratung eingegangen und dargestellt, welche Rolle die Berufsverbände dabei einnehmen. Im zweiten Unterkapitel werden die Voraussetzungen pädagogisch-professioneller Tätigkeit behandelt, wobei besonders der pädagogische Takt und die ethischen Grundsätze pädagogischen Handelns betrachtet werden. Im dritten Unterpunkt wird ein Überblick über die Herausforderungen pädagogischer Professionalität im Beratungsbereich anhand einiger exemplarisch ausgewählter Deprofessionalisierungsrisiken gegeben. Im letzten Kapitel der Arbeit werden mehrere Kriterien pädagogischer Professionalität an einem von der Autorin selbst konstruierten Fallbeispiel aus dem Bereich der Lernberatung reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definition wichtiger Begriffe
2.1 Bestimmung wesentlicher Kriterien pädagogischer Professionalität
2.2 Zentrale Kennzeichen pädagogischer Beratung
3. Pädagogische Professionalität im Handlungsfeld der Beratung
3.1 Professionalisierung der Aus- und Weiterbildung pädagogischer Beratung
3.2 Voraussetzungen pädagogischer Professionalität in der pädagogischen Beratung
3.3 Herausforderungen und Grenzen professioneller pädagogischer Beratung
4. Reflektion pädagogischer Professionalität anhand eines Praxisbeispiels im Bereich der pädagogischen Beratung
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis