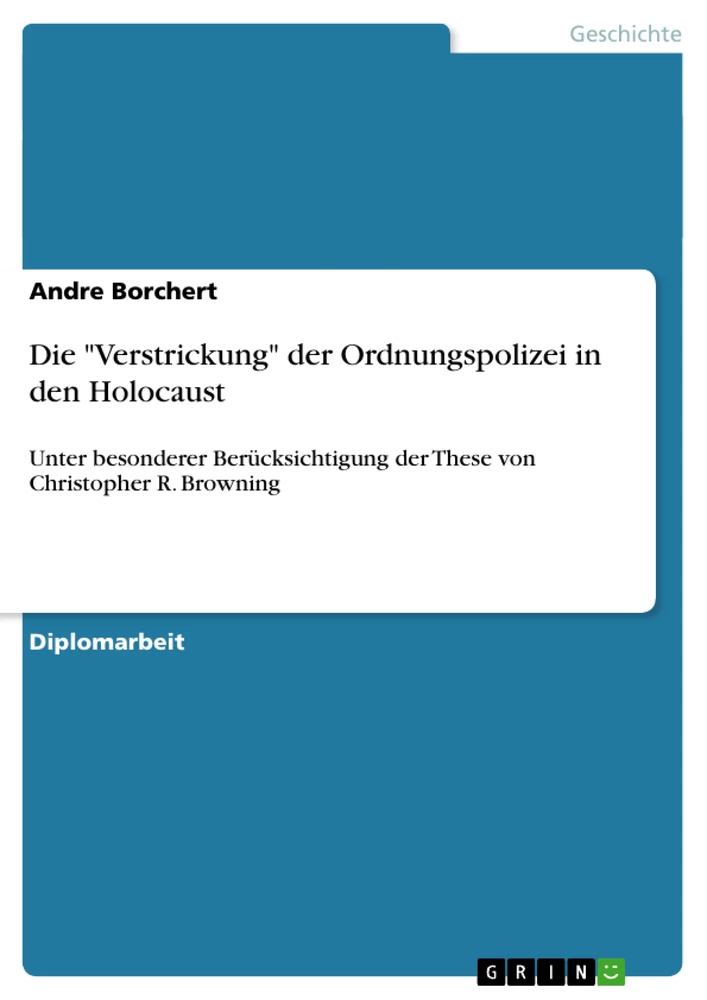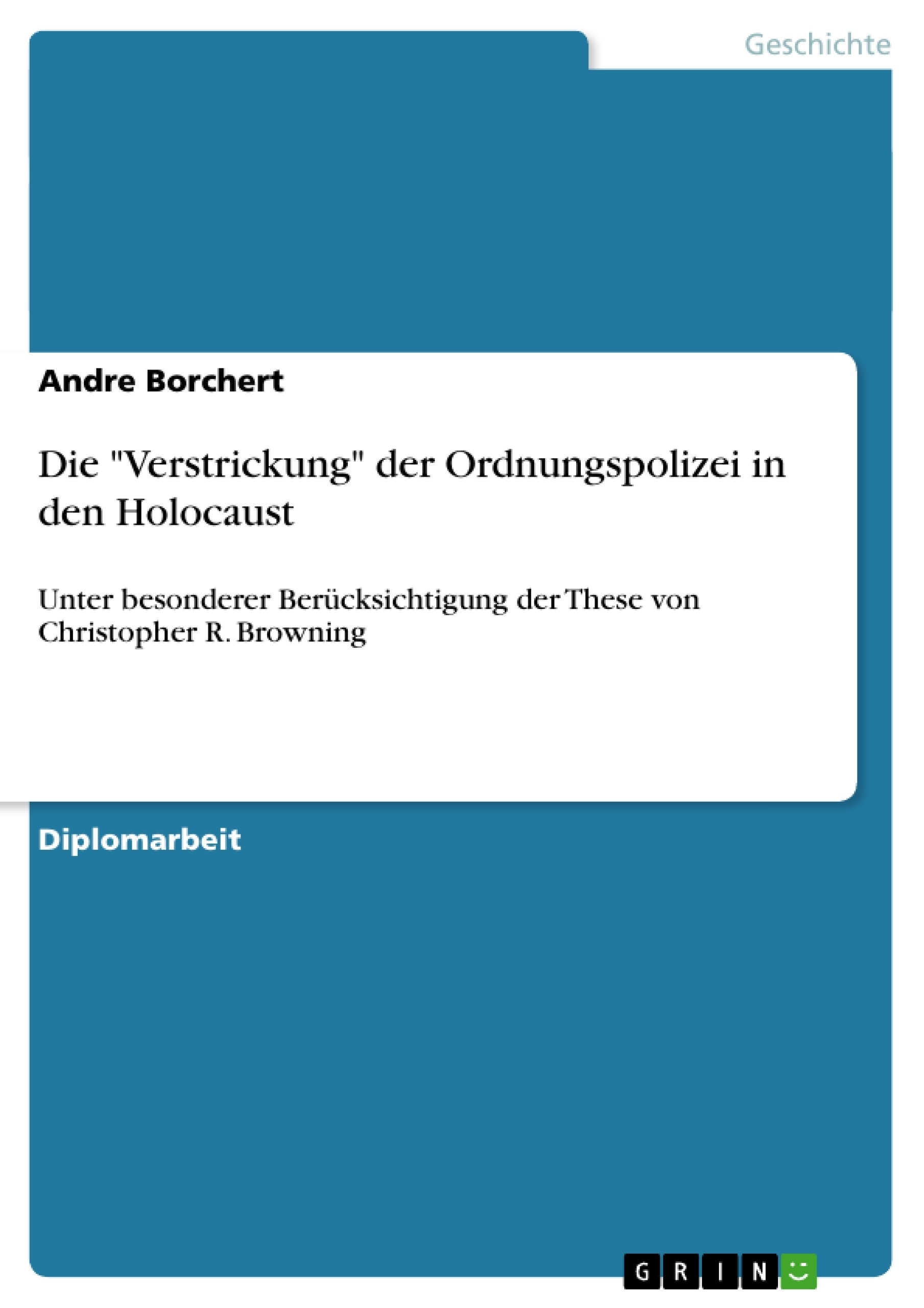Der Holocaust ist das schwerste Verbrechen in der Geschichte der Menschheit. Dennoch wird in der breiten Öffentlichkeit die Meinung vertreten, dass dieser Teil der deutschen Geschichte abgeschlossen werden sollte. Ferner herrscht trotz der Vielzahl von Arbeiten über den Holocaust in weiten Bereichen noch Unkenntnis. Daher muss auch der Einsatz der Ordnungspolizei im "Dritten Reich" und deren Schuld an der Ermordung der europäischen Juden nach neusten Erkenntnissen der Holocaustforschung genauer betrachtet werden. Ziel dieser Diplomarbeit ist es, den Anteil der Ordnungspolizei am Holocaust aufzuzeigen. Dabei werden die Theorien von Christopher R. Browning mit einbezogen, um den "Entscheidungsprozess", der zur "Endlösung" führte, und die Motive der Täter besser darstellen zu können. In dieser Arbeit werden die Besonderheiten des Antisemitismus und die Organisation der Ordnungspolizei in der zentralistischen Diktatur des "Dritten Reiches" untersucht. Ferner werden beispielhaft die Einsätze der Polizeibataillone in den entscheidenden Phasen des "Entscheidungsprozesses" dargestellt und die Motive der Täter erörtert.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Der Weg in den Holocaust
2.1 Der deutsche Antisemitismus
2.2 Der Prozess der Radikalisierung 1933-1939
3 Die Ordnungspolizei im „Dritten Reich“
3.1 Geschichte und Aufbau der Ordnungspolizei
3.2 Einordnung in Himmlers »Polizeistaat«
4 Die Einsätze der Polizeibataillone
4.1 Polen 1939-1940
4.2 Der Vernichtungskrieg in der Sowjetunion
4.2.1 Bialystok Juni/Juli 1941
4.2.2 Polizeibataillone in den Einsatzgruppen
4.2.3 Unter der Führung der Höheren SS- und Polizeiführer
4.3 Im Generalgouvernement 1941-1943
5 Die Browning - Theorie
5.1 Intentionalismus und Funktionalismus
5.2 Der »Entscheidungsprozess« nach Browning
5.3 Die Motivation der Täter
5.3.1 Die Goldhagen-These
5.3.2 Der Erklärungsansatz von Browning
6 Schlussbetrachtung
Abstract
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Spricht man in der heutigen Zeit das Thema des Holocaust in der Öffentlichkeit an, sieht man sich sehr häufig mit der Einstellung konfrontiert, dass es nunmehr doch genug sein müsse, an diese Vergangenheit zu erinnern.
Grund für diese Ansicht ist sicherlich die zeitliche Distanz und das Heranwachsen jüngerer Generationen. Dass diese Meinung falsch ist, zeigt sich u.a. in der Problematik des Rechtsextremismus und der fremdenfeindlichen Übergriffe im heutigen Deutschland. Das Thema des Holocaust ist zeitlos und es muss auch zeitlos sein. Dies machte Karl Jaspers mit folgenden Worten, die er kurz nach dem Krieg niederschrieb, deutlich:
„Was geschah, ist eine Warnung. Sie zu vergessen, ist Schuld. Man soll ständig an sie erinnern. Es war möglich, daß dies geschah, und es bleibt jederzeit möglich. Nur im Wissen kann es verhindert werden.“.1 Ohne Zweifel handelt es sich bei der Ermordung der europäischen Juden um ein Jahrhundertverbrechen. Wie schwer es ist, diesen zu erklären, zeigt die Tatsache, dass unter den Historikern die unterschiedlichsten Erklärungsansätze vorherrschen. Bereits kurz nach dem 2. Weltkrieg haben sich namhafte Historiker mit dem Phänomen »Holocaust« beschäftigt. Historiker wie Eberhard Jäckel, Hans Mommsen und Martin Broszat versuchten, den Mord an den europäischen Juden zu erklären. Im Verlauf der fortschreitenden Forschung bildeten sich dabei zwei verschiedene Erklärungsansätze heraus. Die Historiker unterscheiden in Intentions-Theorie und strukturalistisch-funktiona- listischen Ansatz. Die Holocaustforschung spricht hier von einer Zweiteilung der Interpretationsmeinungen.2 Die starre Trennung in diese beiden Lager ließ lange Zeit keinen Raum für neue Denkansätze. Beide Theorien spielen auch in der jüngeren Geschichtsaufarbeitung eine wichtige Rolle und werden in dieser Arbeit noch näher betrachtet werden.
Die wissenschaftliche Aufarbeitung des Holocaust wird bis in die Gegenwart fortgeführt. Insbesondere nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, konnten bisher unbekannte Quellen eingesehen werden. Hierbei findet in der Forschung der Zugang zu Unterlagen der Staatssicherheit der DDR und zu Ermittlungsakten von sowjetischen Behörden große Beachtung.3
Von besonderer Bedeutung ist auch der Blick zurück, weg von der Stufe der hochtechnisierten, industriellen Massenvernichtung, hin zu den manuellen Tötungsvorgängen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Werke von Christopher R. Browning und Daniel Jonah Goldhagen richtungweisend.4 Browning beschäftigt sich in seinen Werken unter anderem mit den Menschen auf einfachster Ebene, die über einen längeren Zeitraum tausende von anderen Menschen umbrachten und den Holocaust so erst ermöglichten.5 Für weltweites Aufsehen sorgte Goldhagens Buch »Hitlers willige Vollstrecker«. Auch hier stehen die Menschen als Täter sowie die Frage, warum sie so dachten und handelten, im Mittelpunkt.6
Bei ihren Arbeiten über den Holocaust richten beide Forscher ihr Hauptaugenmerk auf die Organisation der Ordnungspolizei. Die Verantwortung der Ordnungspolizei stellte in der früheren historischen Aufarbeitung des Genozids an den europäischen Juden nur einen Randbereich dar. Daher ist es auch keine Überraschung, dass dieser Teil der deutschen Polizeigeschichte in weiten Teilen der heutigen Polizei relativ unbekannt ist. Dabei war die Beteiligung der Ordnungspolizei am Holocaust bereits kurz nach dem Krieg bekannt. Trotzdem geriet diese Vergangenheit der deutschen Polizei schnell in Vergessenheit. Erst durch die Arbeiten von Browning und Goldhagen wurden die Tätigkeiten dieser Organisation in das Licht der Öffentlichkeit gerückt. Aber auch deutsche Historiker wie Stefan Klemp und Heiner Lichtenstein haben mit ihren jüngsten Werken einen großen Anteil an der Aufarbeitung der deutschen Polizeigeschichte. Für diese Forscher ist es besonders wichtig, dass Angehörige der Polizei in unserem demokratischen Staat erfahren, wozu ihre Vorgänger in Polizeiuniform fähig waren.7 Denn gerade die deutsche Polizei leistet einen wichtigen Beitrag für die Einhaltung von demokratischen Werten in Deutschland und im Rahmen von Auslandseinsätzen in anderen Ländern der Welt. Ein weiteres Thema in den Arbeiten von Browning ist der Verlauf des Entscheidungsprozesses. Hierbei geht es um die Frage, wann und wie der Schritt zum Völkermord vollzogen wurde. Dies kann anhand der Tätigkeit der Ordnungspolizei, insbesondere in der Betrachtung der Einsätze der Polizeibataillone, sehr gut nachvollzogen werden.
Ziel dieser Arbeit ist es, insbesondere jungen Polizeibeamten zu verdeutlichen, dass sich der Täterkreis im Holocaust nicht nur auf die SS und die Wehrmacht beschränkte, sondern auch deutsche Polizisten daran beteiligt waren. Dabei wird die Ordnungspolizei als eine Organisation im nationalsozialistischen Deutschland dargestellt, ihre Einsätze im Holocaust nachvollzogen und ihre Rolle bei der Vernichtung der europäischen Juden verdeutlicht. Ferner wird der Entscheidungsprozess nach Browning vorgestellt und dieser anhand der Einsätze der Ordnungspolizei nachvollzogen. Schließlich werden die Motive der Täter in einem Vergleich der unterschiedlichen Meinungen von Browning und Goldhagen verdeutlicht.
Unter den schätzungsweise fünf bis sechs Millionen ermordeten Juden waren ca. drei Millionen polnische und über 700 000 sowjetische Juden.8 Somit wird das Hauptaugenmerk der Betrachtungen dieser Arbeit auf den Ereignissen in Polen und in der Sowjetunion liegen.
Eine Arbeit über den Holocaust erfordert zwangsläufig auch eine Erklärung des deutschen Antisemitismus. Hierauf wird im folgenden Abschnitt eingegangen. Als ein Schwerpunkt dieser Arbeit werden die Einsätze der deutschen Ordnungspolizei und ihre „Aufgaben“ in Polen und in der Sowjetunion dargestellt. Ferner wird im Rahmen einer Gesamtbetrachtung die Browning-Theorie vorgestellt. Anschließend wird in der Schlussbetrachtung ein Resümee erörtert.
2 Der Weg in den Holocaust
Wenn man den Holocaust betrachten und Erklärungsansätze erarbeiten will, muss man sich zunächst mit dem Antisemitismus in Europa auseinandersetzen. Anfang der 30'er Jahre des 20. Jahrhunderts blickte man auf annähernd 2000 Jahre christlicher und jüdischer Geschichte zurück, die von Feindseligkeit und Intoleranz gekennzeichnet war. Antisemitismus war in ganz Europa verbreitet. So wurden im mittelalterlichen Spanien die spanischen Juden aus ihrer Heimat vertrieben. Zur gleichen Zeit galten in England die Juden als die angeblich Schuldigen bei Kindesmorden. Ferner kommen in der Geschichte des zaristischen Russland immer wieder Pogrome gegen Juden vor. Die Juden sahen sich somit in vielen Ländern mit Hass und Klischees ihnen gegenüber konfrontiert. Dieser religiöse Antisemitismus war im Laufe der Jahrhunderte gewachsen. Seit dem ersten Jahrhundert sagte man den Juden nach, die „Mörder Christi“ zu sein. Im vierten Jahrhundert wurde unter der Herrschaft Konstantins das Christentum in Rom zur Staatsreligion erhoben. Fortan machte der Staat Kirchenpolitik und die katholische Kirche bestimmte den Umgang mit den Juden.9 Die nachfolgenden Jahrhunderte europäischer Judenpolitik waren gekennzeichnet durch Bekehrung, Vertreibung und Auslöschung. So war Martin Luther von der erfolglosen Bekehrung der Juden enttäuscht und sprach in seinem berüchtigten Werk „Von den Juden und ihren Lügen“ seinen Hass auf die Juden offen aus.10
Der Antisemitismus war demnach keine Erscheinung in einem einzigen Land, sondern auf dem ganzen Kontinent verbreitet. Aber was unterschied den deutschen Antisemitismus von dem in anderen Ländern? Wieso verlief dieser in Deutschland so radikal?
2.1 Der deutsche Antisemitismus
Der Antisemitismus durchlief in Deutschland, verglichen mit anderen Teilen Europas, einen eigenen Weg. Dieser deutsche »Sonderweg« wurde von den Historikern mit unterschiedlichen Ergebnissen thematisiert. So macht Friedrich Meinecke den preußischen Militarismus für das Abgleiten in den radikalen Antisemitismus verantwortlich. Hans Mommsen vertritt die Meinung, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung die nationalsozialistische Utopie annahm.11 Goldhagen sieht die Ursache in dem tief verankerten Hass der Deutschen gegen die Juden.12
Ein Teil der Historiker sieht eine Erklärung des »Sonderweges« in der kulturell-ideologischen Entwicklung. Bedingt durch die napoleonisch- französischen Eroberungen, wurden den Deutschen Anfang des 19. Jahrhunderts revolutionäre Veränderungen aufgezwungen. Dies führte gleichzeitig zu einem Ressentiment der Deutschen gegenüber Liberalismus, Parlamentarismus und Demokratie, was sich dann teilweise in der ablehnenden Haltung gegenüber der Weimarer Republik widerspiegelte. Andererseits vollzog sich auch in Deutschland die technische Revolution. Dies führte zu einem Spannungszustand zwischen reaktionären Strömungen und der Modernisierung Deutschlands.
Zu einem ähnlichen Schluss kommt der sozial-strukturelle Ansatz. Demnach entwickelte sich zum einen Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland eine immer moderner gestaltete Gesellschaft und Wirtschaft. Andererseits wurde dieses Land seit der Reichsgründung von 1871 von einem autokratischen Monarchen und einer traditionellen Elite regiert. Dies wiederum erschwerte demokratische Reformen.13 Beide Erklärungsansätze spiegeln die Situation Deutschlands zu Beginn des 20. Jahrhunderts wider. In dieser Zeit erlebte das deutsche Judentum im Vergleich zu dem im Osten Europas eine Phase des sozialen Aufstiegs. Der rassische Antisemitismus stellte eine Randerscheinung dar. Zentrale Bedeutung behielt dagegen der traditionell christlich geprägte religiöse Antisemitismus.14 Trotzdem waren die deutschen Juden patriotisch eingestellt und zogen zu tausenden in den Reihen der kaiserlichen Armee in den 1. Weltkrieg.
Die aufgeführten Erklärungsansätze waren die Grundlage eines deutschen »Sonderweges«. Der entscheidende Unterschied gegenüber anderen Ländern Europas vollzog sich in Deutschland aber erst nach dem 1. Weltkrieg. Die Niederlage und die anschließende Revolution spalteten das Land in viele gegensätzliche politische Lager und stürzten es ins Chaos. Dies waren denkbar schlechte Voraussetzungen für die junge Demokratie der Weimarer Republik. Die enormen wirtschaftlichen Probleme, bedingt durch die Belastungen des »Versailler Vertrages« und der Weltwirtschaftskrise, bereiteten den Nährboden der politisch Rechten und deren radikalen Kräfte. Mit dem Aufstieg der NSDAP zur Regierungspartei rückte der rassische Antisemitismus als Kernidee dieser Partei von einer Randerscheinung in den Blickpunkt der deutschen Öffentlichkeit.15 Der deutsche Jude Klemperer schreibt am 25.10.1941 in sein Tagebuch: „Ich frage mich immer: Wer von den <arischen> Deutschen ist wirklich unberührt vom Nationalsozialismus? Die Seuche wütet in allen, vielleicht ist es nicht Seuche, sondern deutsche Grundnatur.“.16 Für Yehuda Bauer stellt die Ausbreitung des Antisemitismus innerhalb der intellektuellen Elite ein ganz eigenes deutsches Phänomen dar. Innerhalb dieser Elite befanden sich die ersten Befürworter der NSDAP. Als diese an die Macht kam, konnte sie sehr schnell die über-wältigende Unterstützung der Menschen gewinnen.17
In der deutschen Bevölkerung war eine aus dem christlichen Antisemitismus erwachsene antisemitische Einstellung verbreitet. Diese verhinderte einen ernsthaften Widerstand gegen die Pläne der NSDAP und war somit die Grundlage für den radikalen Antisemitismus der Nationalsozialisten.18 Bauer und Browning sind sich darüber einig, dass die Ereignisse, die zum Scheitern der Weimarer Republik führten, der Aufstieg der NSDAP und ihrer „Idee“ sowie deren Unterstützung durch eine Schicht intellektueller Eliten den deutschen »Sonderweg« darstellen. Yehuda Bauer kommt zu dem Schluss, dass es zu einem Massenmord an einer Minorität kommen kann, wenn eine »gemäßigte« gesellschaftliche Ächtung oder eine »gemäßigte« Abneigung gegenüber dieser Minderheit besteht. Vorausgesetzt, dass sich gleichzeitig eine intellektuelle Elite mit dem von ihr etablierten Regime identifiziert, welches die oben genannte Minderheit eliminieren will.19
Die von Browning und Bauer aufgeführten Argumente stellen eine schlüssige Grundlage für eine Radikalisierung des Antisemitismus in Deutschland zu Anfang der 30'er Jahre des 20. Jahrhunderts dar.
2.2 Der Prozess der Radikalisierung 1933-1939
Der jahrhundertealte Kampf von Kirche und Staat gegen das Judentum brachte ein breites Reservoir an administrativen Erfahrungen mit sich. Auf diese Erfahrungen griffen die Nationalsozialisten nach ihrer Machtergreifung zurück.20
Die Vernichtung der Juden vollzog sich schrittweise. Die Jahre 19331939 waren geprägt von Definition, Enteignung und Konzentration. Goldhagen umschreibt diese Phase mit verbalen und physischen Angriffen, gesetzlichen und administrativen Maßnahmen zur Isolierung der Juden von Nichtjuden und Abdrängen der Juden in die Emigration.21 Trotz der Vielzahl von hasserfüllten Reden Hitlers und anderer nationalsozialistischer Größen lässt sich in der Geschichtsschreibung kein Beweis finden, dass in diesem frühen Stadium eine physische Vernichtung der Juden geplant war. Unzweifelhaft ist, dass das vorrangige Ziel der Nationalsozialisten die Vertreibung der Juden vom deutschen Boden war.
Der erste Schritt war die Definition. Bevor man administrative Maßnahmen gegen das Judentum einleiten konnte, musste man festlegen, wer Jude war. Dies erfolgte am 15.09.1935 mit dem „Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“. Anlässlich des Nürnberger Parteitags geschaffen, gingen diese Regelungen als „Nürnberger Gesetze“ in die Geschichte ein.
Ein weiterer Schritt waren die Enteignungen. Dazu gehörten eine Reihe von Maßnahmen. So durften Juden bestimmte Berufe nicht mehr ausüben. Ihnen wurden im Rahmen der „Arisierungen“ ihre Geschäfte genommen. Ferner nahm man ihnen durch gesonderte Steuern ihre Ersparnisse und kürzte ihre Löhne. Am Ende wurde ihnen ihre letzte persönliche Habe genommen. Innerhalb dieser Maßnahmen ist die Entfernung der Juden aus dem Staatsdienst durch das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 07.04.1933 beson-ders hervorzuheben.22 Beispielhaft für die Beschlagnahme des jüdischen Barvermögens ist die »Sühneleistung« vom 21.11.1938. Demnach wurde den Juden eine Vermögenssteuer wegen der Ermordung des Gesandtschaftsrats vom Rath in Paris, Auslöser der „Reichskristallnacht“, auferlegt. Die deutschen Juden hatten 20 Prozent ihres Barvermögens in Raten an das Finanzministerium zu zahlen.23
Unter dem Schritt der Konzentration versteht man die Isolierung der Juden vom Rest der Bevölkerung. So wurden soziale Kontakte zwischen Juden und Deutschen verboten. Für Juden wurden Wohnungsbeschränkungen eingeführt. Ferner wurde die Bewegungsfreiheit eingeschränkt und die Kennzeichnung angeordnet. Für die Umsetzung dieser antijüdischen Maßnahmen bedienten sich die Nationalsozialisten ihrer Opfer. Sie ließen einen jüdischen Verwaltungsapparat für sich arbeiten.24
Das Ergebnis war die Ausgrenzung aus der Gesellschaft. Laut Welzer ist das ganz entscheidend für alles, was darauf folgte. Die Nationalsozialisten veränderten das soziale Gefüge. Die Grenzen der sozialen Zugehörigkeit wurden neu gesetzt.25 Die verheerenden Folgen dieser Ausgrenzung spiegeln sich später in den Motiven der Täter wider. Durch all die oben beschriebenen Maßnahmen wurde es zur Normalität, dass Juden eben nicht zur „Volksgemeinschaft“ gehörten. Am Vorabend des 2. Weltkriegs waren die Juden innerhalb der deutschen Gesellschaft sozial tot.26
3 Die Ordnungspolizei im „Dritten Reich“
In der Nachkriegsliteratur wurden die Verbrechen des Holocaust nur teilweise aufgearbeitet. So wurden die Taten der Einsatzkommandos fast ausschließlich dem SD und somit der SS zugeschrieben. Die SS wurde im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess zur verbrecherischen Organisation erklärt.27 Die Führer der Einsatzgruppen, allesamt Angehörige der SS, wurden im Einsatzgruppenprozess zur Rechenschaft gezogen. Erst Ende des letzten Jahrhunderts begannen Historiker, die Rolle der Ordnungspolizei genauer zu beleuchten.
In diesem Abschnitt werden die Organisation der Ordnungspolizei und ihre Stellung im nationalsozialistischen „Sicherheitsapparat“ dargestellt.
3.1 Geschichte und Aufbau der Ordnungspolizei
Die Ordnungspolizei war eine große, militärisch ausgebildete und bewaffnete Polizeiorganisation. Erstmals traten solche Einheiten nach dem Ende des 1. Weltkriegs in Erscheinung. Offiziere des kaiserlichen Heeres und Beamte hatten sich zu gegenrevolutionären, paramilitärischen Truppen, den Freikorps, zusammengeschlossen. Ihr Ziel war, die Revolution in Deutschland niederzukämpfen. In der jungen Weimarer Republik wurden große Teile dieser Freikorps mit regulären Polizeieinheiten zu großen kasernierten Polizeiverbänden zusammengeschlossen. Diese wurden aber bereits 1920 auf Protest der Alliierten wieder aufgelöst.28
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden die föderalen Strukturen der Weimarer Republik abgeschafft. Dies betraf auch die Polizei. Artikel 2 des „Gesetzes über den Neuaufbau des Reiches“ vom 30.01.1934 übertrug die Polizeihoheit der Länder auf das Reich.29
Richtungweisend für den weiteren Verlauf war die Ernennung Heinrich Himmlers zum Chef der deutschen Polizei im Jahre 1936. Dem „Reichsführer SS“ (RFSS) unterstanden fortan alle Polizeieinheiten im Dritten Reich. Von den 62 000 Beamten der Ordnungs- und Schutzpolizei im Jahre 1938 waren 9000 in Polizeihundertschaften gegliedert. Aus diesen Hundertschaften wurden später die Polizeibataillone (PB) gebildet.30 Diese Polizeiverbände wiederum waren mobile, flexibel einsetzbare Einheiten. Sie waren der Teil der Ordnungspolizei, der am stärksten in den Holocaust verwickelt war.31 Die Polizeibataillone stellen daher einen Schwerpunkt der folgenden Betrachtungen dar. Daneben gab es die einzeldienstliche Komponente, die sich in Schutzpolizei und Gendarmerie gliederte. Beide übernahmen den allgemeinpolizeilichen Aufgabenbereich, wobei die Schutzpolizei in den Städten zuständig war und die Gendarmerie die ländlichen Bereiche übernahm.
Bis zum Beginn des 2.Weltkrieges wuchs die Ordnungspolizei auf eine Stärke von 131 000 Mann an. Das Wesen und die Aufgabenbereiche der ursprünglichen Berufspolizei veränderten sich während des Krieges stark. So mussten bereits im Krieg gegen Polen ca. 25 000 Mann aus den Reihen der Polizeibataillone der Wehrmacht zur Verfügung gestellt werden. Im Gegenzug wurde der Ordnungspolizei gestattet, 26 000 Mann der jüngeren Jahrgänge, 6000 Volksdeutsche und 91 500 Reservisten zu rekrutieren. Infolgedessen war ihre Stärke Mitte 1940 auf beträchtliche 244 500 Mann angewachsen. Die Zahl der Polizeibataillone wuchs auf 101. Die Reservisten wurden zum Auffüllen der bereits in Polen eingesetzten Bataillone herangezogen. Aus diesen Einheiten wurden die Reserve-Polizeibataillone (RPB) gebildet. Diese sind unter anderem Gegenstand der Täterstudien von Browning und Goldhagen. Aus den 26 000 jungen Freiwilligen wurden neue Einheiten mit den Nummern 251 bis 256 und 301 bis 325 gebildet.32 Diese Verbände machten sich insbesondere in der Sowjetunion einen „Namen“ und werden noch Teil der folgenden Betrachtungen sein.
Eine der Hauptaufgaben der Ordnungspolizei war es, die besetzten Gebiete zu „befrieden“. Daher ist es nicht verwunderlich, dass ihr Personal mit zunehmender Kriegsdauer stetig stieg. Allein in den besetzten Gebieten der Sowjetunion waren im Mai 1943 insgesamt 327 543 Mann eingesetzt.33 Ab Juli 1942 wurden die Polizeibataillone in die Polizeiregimenter 1 bis 28 eingegliedert.34 Ab dem 24.02.1943 wurden alle Polizeiregimenter in SS-Polizeiregimenter umbenannt.35 Im Verlauf der sich stetig verschlechternden Kriegslage wurden beträchtliche Teile dieser Einheiten an den Fronten eingesetzt.
3.2 Einordnung in Himmlers »Polizeistaat«
Um die Einsätze der Ordnungspolizei, insbesondere ihrer Polizeibataillone, nachvollziehen zu können, muss man sich zunächst ein Bild über die Struktur der Polizei im „Dritten Reich“ machen. Dabei gilt es, zwei Fragen zu klären. Wo war die Ordnungspolizei in diesem zentralen Gebilde eingeordnet? Wie waren die Befehls- und Unterstellungsverhältnisse?
Die Ernennung zum Chef der deutschen Polizei am 17.06.1936 verschaffte Himmler einen enormen Machtzuwachs. Er war fortan nicht nur Herr der parteieigenen SS, sondern auch Befehlshaber aller Polizeikräfte in Deutschland. Bezeichnend für seine Allmacht war die weitgehende Unabhängigkeit gegenüber Reichsinnenminister Frick. Himmler war dem Innenminister zwar persönlich und unmittelbar, aber nicht geschäftlich unterstellt. Weisungsgemäß konnte sich der RFSS stets auf die höhere Autorität Hitlers berufen.36 Hilberg misst der Macht Himmlers größte Bedeutung bei. Auch er ist der Meinung, dass sie auf seiner Unabhängigkeit beruhte.37
Himmler gliederte seinen neuen Machtbereich in zwei Hauptämter. Das Hauptamt Sicherheitspolizei, zu dem die Gestapo und die Kriminalpolizei gehörten, übernahm Reinhard Heydrich. Das Hauptamt Ordnungspolizei wurde von Kurt Daluege geführt.38 Im September 1939 wurde durch die Zusammenlegung von Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst (SD) das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) geschaffen. Die Leitung übernahm wiederum Reinhard Heydrich. Ziel des RSHA war die Errichtung eines integrierten Systems von Überwachung, Anzeige und Inhaftierung.39 Ferner war es der Koordinator des Völkermordes an den europäischen Juden. Das RSHA übernahm die zentrale Leitung im Vernichtungsprozess.40 In dieser Funktion erteilte es Weisungen und hatte in diesem Zusammenhang auch Einfluss auf Einheiten der Ordnungspolizei. Dies wird am Beispiel der Einsatzgruppen und der Institution der Höheren SS- und Polizeiführer (HSSPF) deutlich.
Die Einsatzgruppen waren ursprünglich Verbände der Sicherheitspolizei und des SD. Sie wurden vor jedem „Eroberungsfeldzug“ neu aufgestellt und dienten der Verfolgung politischer Gegner.41 In den Einsätzen in Polen, Jugoslawien und insbesondere in der Sowjetunion wurden verstärkt Einheiten der Ordnungspolizei den Einsatzgruppen zugeteilt. Die Einsatzgruppen unterstanden dem RSHA und erhielten ihre Befehle von Heydrich.42
Eine weitere Institution im Machtgefüge von Himmlers „Polizeiapparat“ waren die HSSPF. Für Himmler waren sie der verlängerte Arm und die persönlichen Vertreter. Die HSSPF waren regional zuständig. Ihre Aufgabe war es, die in ihren jeweiligen Gebieten stationierten SS- und Polizeieinheiten zu beaufsichtigen und gemeinsame Einsätze zu koordinieren. Insbesondere die drei auf sowjetischem Territorium eingesetzten HSSPF waren massiv am Massenmord an den sowjetischen Juden beteiligt. Ihre Weisungen erhielten sie aus dem RSHA direkt von Heydrich. Für deren Umsetzung konnten sie auf die in ihrem Gebiet stationierten Kräfte der Sicherheits- und Ordnungspolizei sowie der Waffen-SS zurückgreifen.43 Mit der Person des HSSPF ergab sich für die Ordnungspolizei eine gesonderte Befehlskette, die parallel zur originären verlief. Ferner fanden eine Reihe von Polizeibataillonen Verwendung in den Reihen der Wehrmacht zur Sicherung der rückwärtigen Heeresgebiete.
Neben diesen „Sonderaufgaben“ in den Einsatzgruppen, in Unterstellung für den HSSPF sowie innerhalb der Wehrmacht, hatten die Einheiten der Ordnungspolizei hauptsächlich Besatzungsaufgaben zu leisten. Wie in diesem Fall die originären Befehls- und Unterstellungsverhältnisse waren, wird am Beispiel des Generalgouvernements deutlich. In keinem Land Europas, waren die Folgen des Vernichtungsfeldzuges der Nationalsozialisten gegen die Juden verheerender als in Polen.44 Das Generalgouvernement war das Herzstück der Vernichtung.
Nach der Niederlage Polens wurde das polnische Staatsgebiet, dem Hitler-Stalin-Pakt entsprechend, aufgeteilt. In die östlichen Gebiete rückte die Rote Armee ein. Den Rest hielt Deutschland besetzt und teilte es noch einmal auf. Große Teile wurden in das Altreich eingegliedert. Es entstanden die neuen Reichsgaue Oberschlesien, Warthegau, und Danzig-Westpreußen. Das Gebiet Zentralpolens nahm eine Sonderstellung ein. Hierzu zählten die Städte Warschau, Krakau und Lublin. In diesem Gebiet wurde mit dem Generalgouvernement eine eigene Verwaltungseinheit gebildet, in der bereits ca. 1,4 Millionen Juden lebten.45 Diese Verwaltungszone wurde wiederum in die vier Distrikte Warschau, Radom, Krakau und Lublin unterteilt. In diesen Gebieten wurden starke Kräfte der Ordnungspolizei stationiert.
Jeder der oben genannten Distrikte erhielt einen SS- und Polizeiführer (SSPF) sowie einen Kommandeur der Ordnungspolizei (KdO). Dem KdO wurde jeweils ein Regiment der Ordnungspolizei unterstellt. Ferner wurden in allen größeren Städten Schutzpolizeidienststellen eingerichtet. Gendarmerieposten in den mittleren Städten vervollständigten das Netz.
Die KdO unterstanden dem Befehlshaber der Ordnungspolizei (BdO) im Generalgouvernement, der seinen Sitz in Krakau hatte. Dieser arbeitete eng mit dem HSSPF im Generalgouvernement zusammen, dem wiederum die SSPF unterstanden. Die vorgesetzte Stelle des BdO war letztendlich das Hauptamt unter Daluege in Berlin. Ende 1942, als der Massenmord an den Juden in vollen Zügen entbrannt war, befanden sich im Generalgouvernement 15 186 Mann der Ordnungspolizei.46
Die hier aufgezeigten Strukturen an den Beispielen der Einsatzgruppen, des HSSPF und der Aufstellung der Ordnungspolizei im Generalgouvernement zeigen eine enge Vernetzung der beiden Hauptämter. Wobei das RSHA den dominierenden Part einnahm und auch formal für die Umsetzung der Rassenpolitik zuständig war. Nitschke spricht der Polizei sogar den Status einer staatlichen Institution ab und sieht sie neben der Waffen- und Allgemeinen SS als eine dritte Säule im Imperium von Heinrich Himmler.47 Dies wirkte sich erheblich auf die Befehlskette aus.
[...]
1 Jaspers, S.190.
2 Vgl. Kershaw, S.169.
3 Vgl. Klemp (2005), S.17; vgl. auch Browning (2002b), S.8f.
4 Vgl. Welzer, S.86f.
5 Vgl. Browning (2002a), S.13.
6 Vgl. Goldhagen, S.11.
7 Vgl. Lichtenstein, S.17.
8 Vgl. Friedländer (Band2), S.662 und 692; vgl. auch Hilberg, S.1300.
9 Vgl. Hilberg, S.11.
10 Vgl. ebd., S.13.
11 Vgl. Bauer, S.135.
12 Vgl. Goldhagen, S.439.
13 Vgl. Browning (2003), S.19f.
14 Vgl. Friedmann (Band1), S.97.
15 Vgl. Browning (2003), S.23f.
16 Klemperer (Band 1), S.681.
17 Vgl. Bauer, S.55.
18 Vgl. ebd., S.136f.
19 Vgl. ebd., S.60.
20 Vgl. Hilberg, S.16.
21 Vgl. Goldhagen, S.170.
22 Vgl. Hilberg, S.85ff.
23 Vgl. ebd., S.142f.
24 Vgl. ebd., S.165.
25 Vgl. Welzer, S.248.
26 Vgl. Goldhagen, S.171.
27 Vgl. Lichtenstein, S.26f und 29.
28 Vgl. Browning (2002a), S.23.
29 Vgl. Lichtenstein, S.18.
30 Vgl. Klemp (1998), S.17.
31 Vgl. Goldhagen, S.219.
32 Vgl. Browning (2002a), S.25ff.
33 Vgl. Nitschke, S.59; vgl. auch Klemp (2005), S.69.
34 Vgl. Klemp (2005), S.15.
35 Vgl. Lichtenstein, S.26.
36 Vgl. Nitschke, S.58.
37 Vgl. Hilberg, S.210.
38 Vgl. Lichtenstein, S.21.
39 Vgl. Friedländer (Band 1), S.217.
40 Vgl. Kershaw, S.207.
41 Vgl. Hilberg, S.212.
42 Vgl. Friedländer (Band 2), S.161.
43 Vgl. Browning (2003), S.346.
44 Vgl. Browning (2002b), S.137.
45 Vgl. Hilberg, S.205.
46 Vgl. Browning (2002a), S.27.
47 Vgl. Nitschke, S.60f.