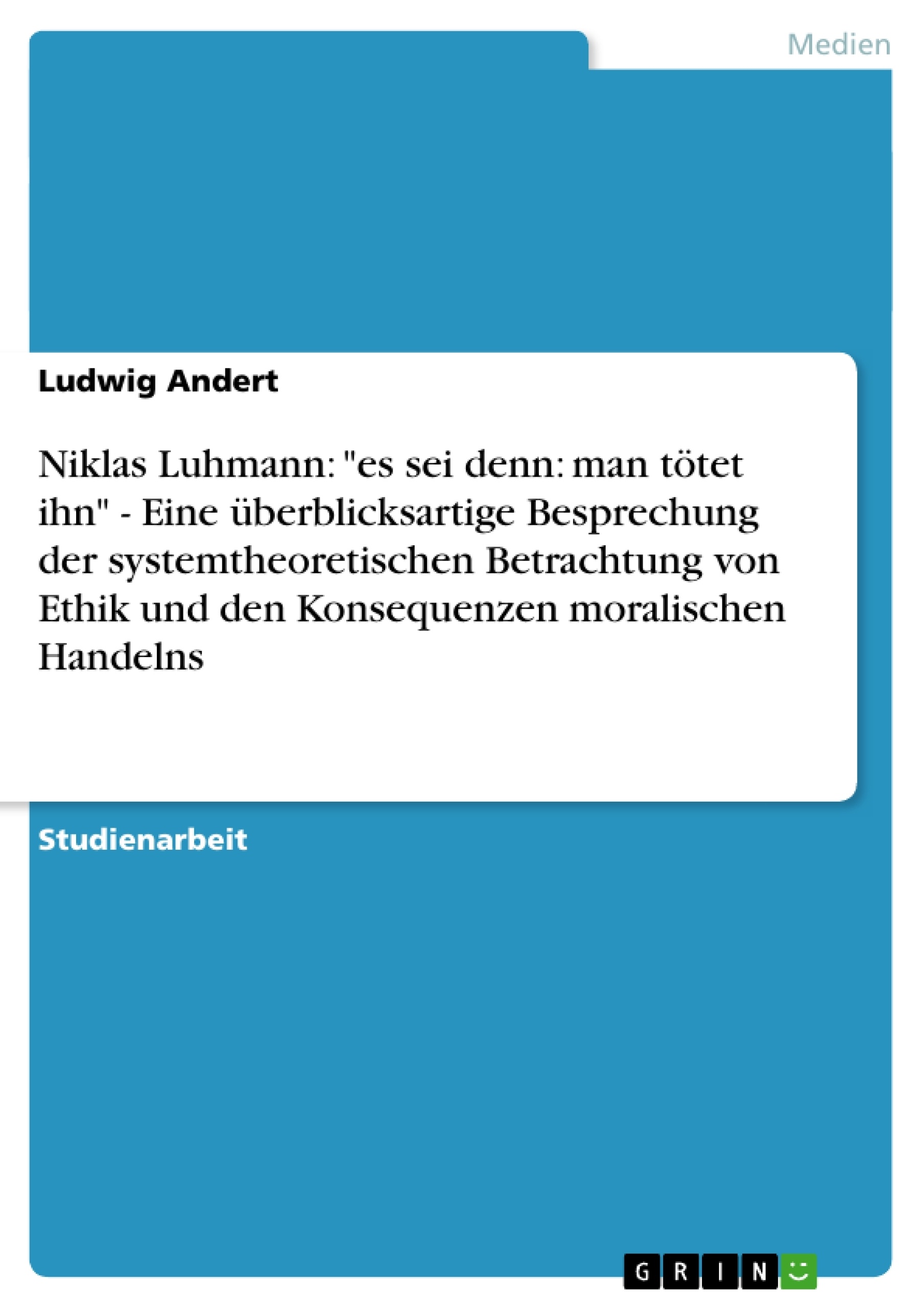Am Beispiel der wissenschaftlichen Reflexion von Moral zeigt Luhmann, dass eine rücksichtslos vereinfachende Vorgehensweise zu einer „Infektion“ führen kann, so dass ein Wissenschaftler am Ende nicht mehr wissenschaftliche, sondern moralische Urteile fällt. Damit ist er einem zentralen Problem jeder Ethik auf der Spur: Letztlich soll ein Theoriegebäude der Moral dazu dienen, die Begründung der Moral von einem seinerseits moralischen Urteil unabhängig zu machen. Doch wenn eine Ethik nicht moralischen Kriterien genügen muss, wie kann sie dann Basis für Werturteile wie „gut“ oder „schlecht“ sein?
Der vorliegende Text wird Luhmanns Vorschlag beleuchten, Ethik als Problemlösungsstrategie moralischer Reflexion zu verstehen, die historisch unter dem Einfluss moralexterner Rahmenfaktoren steht und zwischen diesen und der konkreten Ausformulierung von Moral vermittelt. Außerdem soll ein Blick auf die Konsequenzen der Ethiktheorie Luhmanns geworfen werden.
Niklas Luhmann: "es sei denn: man tötet ihn" - Eine überblicksartige Besprechung der systemtheoretischen Betrachtung von Ethik und den Konsequenzen moralischen Handelns
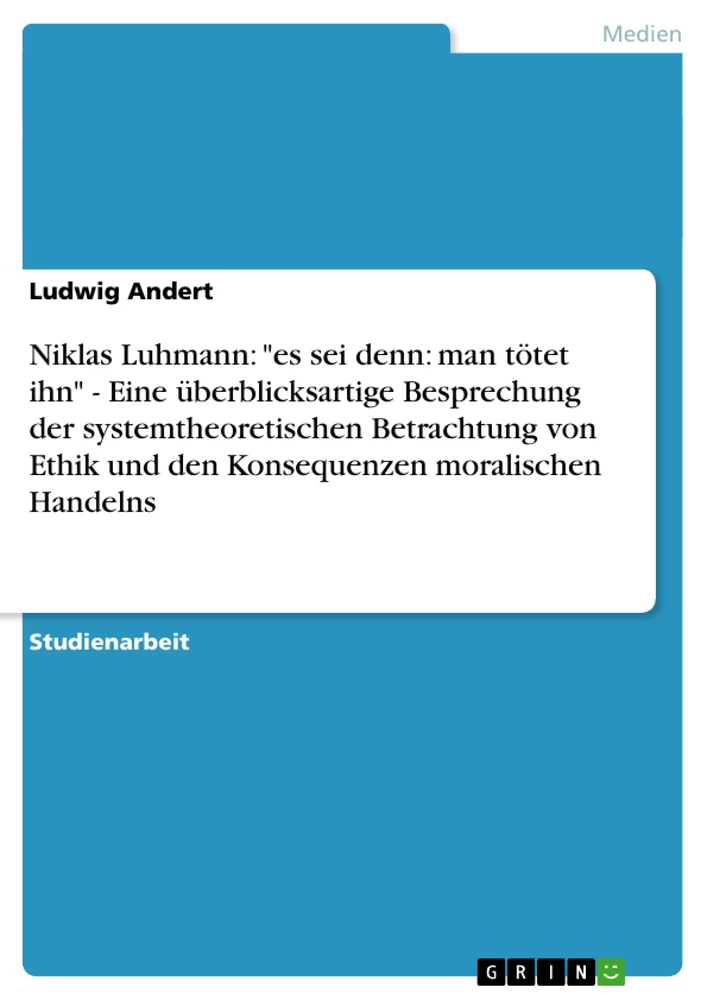
Seminararbeit , 2009 , 10 Seiten , Note: 1,0
Autor:in: Ludwig Andert (Autor:in)
Medien / Kommunikation - Medienethik
Leseprobe & Details Blick ins Buch